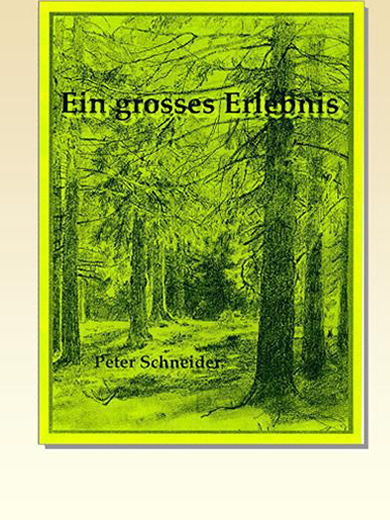 |
|
||||||
EIN GROSSES ERLEBNIS |
|||||||
|
Wer es weiss, wie es einem Wanderer zumute ist, der nach langer und anstrengender Tageswanderung gegen Abend hin merkt, dass er sich verlaufen hat und weiss, dass es auf dem Gebirge, auf welchem er sich befindet, nicht gut ist, in der Dämmerung oder gar in der Nacht auf unbekannten Wegen und Stegen zu gehen, der weiss in welcher Situation ich mich befunden hatte, als ich zu einem ebenso schönen wie merkwürdigen Erlebnis kam. Eher kahl und wild und stellenweise auch verdorrt war die Landschaft der eben durchwanderten Bergflanke, obwohl über mir sich noch ein gutes Stück Wald dahin zog, das ich aber nicht erreichen konnte, weil zu steile Felshänge diesen von dem Schotterkegel trennten, den ich zu durchwandern hatte. Erst kurz vor dem Abend kam ich zu einer Stelle, da der Weg über einen mir bis dahin kaum sichtbar gewesenen kleinen Nebengrat sich bog, wo ich alsbald im Bergesschatten mich befand, welcher meinen Augen den abendlichen Sonnengruss zu sehen verwehrte. In dieser eher kühlen Bergpartie war der Wald bis weiter in das Geröllfeld gewachsen, sodass ich für die kommende Nacht, die ich wohl oder übel im Freien zubringen musste, doch einen kleinen Windschutz hatte und ein wenig das Gefühl von etwas Geborgenheit. Emsig suchte ich während ich weiter schritt nach einem schönen und geeigneten Platz, der mir zur Lagerstatt hätte dienen mögen. Der Weg zog sich nun wieder etwas aufwärts, und bei einer kleinen Lichtung, die mir die Sicht etwas frei gab, bemerkte ich unweit von mir eine kleine Erhöhung, die so hoch lag, dass sie bereits wieder von der Abendsonne beschienen wurde, sodass ich mich entschloss, bis dahin noch zu gehen. Als ich in ihrer Nähe dann schon die ersten rötlichgoldenen Sonnenstrahlen durch die dunkeln Tannenäste auf den braunen Boden fallen sah, den sie vor meinen Augen wärmend zum Erglühen brachten, sodass ich die unzähligen Tannennadeln, die sich zu einem herrlich weichen Teppich gestalteten, alle einzeln sah, da bemerkte ich oberhalb des Weges, über einem kaum zwölf Meter hohen Fels, unversehens eine junge Frau oder Tochter, die von einem Seile, das zwischen zwei Tannen gespannt war, Wäsche abnahm. Sie schien mich nicht bemerkt zu haben, während ich vor Überraschung stehen blieb und, etwas erleichtert über diese unerwartete Wendung meiner Situation, freier aufzuatmen begann. Ich sah nicht ohne Vergnügen und heimliche Bewunderung, wie sich ihre jugendlich schöne Gestalt, vom goldenen Abendsonnenschein völlig übergossen, streckte, während sie ihre Arme in die Höhe hob, um ein Wäschestück nach dem andern vom Seil herunter zu nehmen. So schön war dies Bild und so herrlich und friedlich wirkte es auf mich, dass ich einen Augenblick lang völlig vergass, was diese unvermutete Begegnung für mich sonst noch bedeuten konnte. Aber ein kühler Luftzug brachte mich wieder auf den Boden der Wirklichkeit zurück. Und da ich nicht sicher war, ob sich von meinem Wege eine Abzweigung auf jenen Fels finden wird, so rief ich hinauf und fragte, ob sich hier in der Gegend noch eine Gelegenheit zur Übernachtung finden liesse. – "Ausser bei uns gibt es in der Nähe wohl keine Gelegenheit", rief sie zurück und erklärte mir, dass dieser Weg ohnehin zu ihrem Hause führe. Ich beschleunigte bald meine Schritte und gelangte nach wenigen Minuten auf eine kleine, etwas freie Ebene, auf welcher am rückwärtigen Waldesrand ein kleines Haus zwischen den ersten grösseren Bäumen stand, vor welchem dieselbe Tochter, welche ich vorher die Wäsche abnehmen sah, mit einem kleinen Kinde, einem Mädchen, spielte. Als sie mich erblickte, rief sie mir ein Willkommen zu und zeigte sich erstaunt, dass ich diesen Weg her gekommen sei, indem sie mir erklärte, dass kaum eine Viertelstunde durch diesen Wald zu gehen sei, bis man zur Passstrasse gelange, wo eine Postautohaltstelle in der Nähe sei, und dieser von mir begangene schmale Fussweg bis hin zur Einmündung in den Gemeindeweg eigentlich nur ihnen selbst diene, wenn sie auf kürzerem Wege ins Nachbardorf gehen wollten. Während des kurzen Gespräches trat aus dem Hause ein Mann mit einem munteren Knaben. Er begrüsste mich kurz und sagte, ich könne bei ihm übernachten, indem zu dieser Zeit kein Postauto mehr fahre und er zwei Zimmer für jeweilige Feriengäste im Moment frei habe. Er schien nicht eben unfreundlich zu sein, aber einladend wirkte er trotzdem nicht. Er fragte, ob ich noch etwas essen wolle, was ich verneinte, da ich einerseits dieser Familie nicht Ungelegenheiten machen wollte und anderseits ja genügend Proviant bei mir hatte, umso mehr, als ich ja nun wusste, dass ich anderntags notfalls mit dem Postauto in die nächste grössere Ortschaft fahren konnte. Der Mann wollte mir nun das Zimmer zeigen, damit ich mein "Zeug" – wie er sagte – loswerden könne; und so gingen wir ins Haus, wo er mir kurz das Zimmer und die Toilette zeigte, mich das Gepäck abstellen hiess und sich danach entschuldigte, dass er im Hause noch Arbeit habe und mich bald alleine liess, während die Tochter sich mit dem kleinen, ebenfalls mit ins Haus gekommenen Mädchen wieder ins Freie begab. Sie sagte mir dabei, dass ich sie noch etwa eine halbe Stunde im Freien treffen werde, falls ich noch irgendetwas benötigen sollte. Mein Zimmer war schön und in ausgewogener Proportion mit einer herrlichen Sicht auf den nahen Wald, der mittlerweile bereits in dunklem Rotgold und nur noch gedämpft ins Fenster meines Zimmers leuchtete. So schön und harmonisch der Raum gestaltet war und so abgerundet und weich in der Form auch alle Möbel darin erschienen, so war doch nirgends ein Prunk oder gar nur überflüssige Zierde. Zweckmässigkeit gepaart mit subtilster Einfachheit, die eher zierlich als nackt oder phantasielos erschien, war hier in einer Art vereint, wie mir bisher noch nie vorgekommen war. Eine Wärme strahlte aus allen Dingen und Verhältnissen, die unmöglich nur aus den überall schönen, reinen und warmen Farben der Einrichtung resultieren konnte. So stark wirkte diese Atmosphäre auf mich ein, dass ich mir darin wie fremd und unpassend vorgekommen war, so wohl mir das alles auch tat. Das mag auch der Grund gewesen sein, weshalb ich nochmals aus dem Zimmer trat und etwas ins Freie ging. Draussen ersah ich wieder die Tochter. Sie sass auf einer Bank unter dem etwas vorspringenden Dache und strickte. "Ein unerhört schöner Abend!" rief ich ihr zu, und sie erwiderte: "Aber nur für die, welche Zeit haben, ihn zu betrachten." Ich verstand den Sinn ihrer Worte nicht so recht und überlegte einen kurzen Moment, ob das wohl eine versteckte Einladung sei, bei ihr Platz zu nehmen. Als ich sie deshalb genauer ansah und merkte, wie sie so emsig strickte und von mir keine weitere Notiz zu nehmen schien, da fiel mir daneben auf, wie ungemein schlicht diese Frau gekleidet war. Nichts zierte ihre schöne, jugendlich frische Gestalt, als die reinen, warmen Farben ihrer Kleidung, die wieder so schlicht war, dass kein Muster die Nüchternheit der schönen Form verbrämte. Nicht einmal dem schönen, leicht welligen Haar wurde gestattet, ihr fein geschnittenes und gerundetes Gesicht zu reichlich zu zieren, indem es kurz geschnitten war. Sie hatte ein Erscheinen, wie ich es nicht nur nicht gewohnt war – nein, so eindrücklich und andersartig war es, nebst ihrem Benehmen, dass ich mir beinahe zu überlegen begann, ob man das noch natürlich nennen konnte, oder ob sie die wohl längere Einsamkeit so unbeschreibbar schlicht und schön zwar, aber auch so absolut unzugänglich werden liess. Da wurde mir plötzlich wieder bewusst, dass ich selbst eigentlich ein Gespräch begonnen hatte, welches sie mit ihrer unklaren, merkwürdigen Antwort fortgesetzt hatte, sodass es nun eigentlich an mir läge, es weiter- oder zumindest zu Ende zu führen. Und mir kamen die folgenden Worte ohne weitere Überlegung wie von selbst: "Ja, Sie werden kaum Zeit haben, den Abend zu betrachten, wenn Sie sich so auf ihre Arbeit konzentrieren". – "Ich spüre den Schein der Sonne auf mir ruhen und fühle, wie diese Wärme mich löst und belebt, während die kühle Abendluft sonst eher meine Muskeln verspannen würde, hätte ich nicht noch zudem die Wärme der Hauswand hinter meinem Rücken, da, wo die Sonnenstrahlen mich nicht treffen können. Wenn ich das jeden Augenblick bei meiner Arbeit dankbar wahrnehme, nehme ich mir dann nicht Zeit, das Wesen dieses Abends zu betrachten? Sein äusseres Bild aber kenne ich von vielen solchen Abenden her und es hat mich auch manches gelehrt. Berühren aber kann mich viel tiefer sein Wesen." Sie sah am Ende ihrer Antwort auf, und zu mir hin, wie eine, der eine schöne und gute Arbeit gelungen ist, und die sich über die Trefflichkeit ihrer Arbeit nun freut. Dabei empfand ich es förmlich, wie die auf ihrer Gestalt und ihrem Gesicht ruhenden, allerletzten Sonnenstrahlen ihr wohler tun mussten, als eine noch so innige, menschliche Berührung ihrer Haut es vermocht hätte. Ich spürte gleichsam, wie sie zu ihrem Herzen drangen, und ich vermeinte, etwas vom Grunde ihrer ungemeinen Schlichtheit, die eben ihre Schönheit ausmachte, zu erfassen. Ich setzte mich auf ein aufgestelltes Stück Rundholz, nicht ahnend, nun ein Kapitel über ausgelebtes Evangelium zu erfahren, als ich ihr erwiderte: "Ja, Sie haben es gut hier oben. Sie können wohl das Bild solcher Abende kennen und sich daher mehr dem Wesen hingeben als dem Bilde. Aber unsereiner, der von der Stadt herkommt, braucht schon Zeit, sich nur mit dem Bilde eines solchen Abends zu befassen, bevor er sich auch ganz seinem Wesen hingeben kann". Das nachfolgende Gespräch ist mir seiner Wirkung nach noch derart frisch in Erinnerung, dass ich den äussern Verlauf nicht mehr wortgetreu wiederzugeben vermag; aber dem Sinne nach sagte sie etwa: Der Mensch sei ein Wesen, das äusserlich und innerlich zugleich lebe, solange er auf Erden weile. Dem Äussern nach lebe er in seinen Werken, die er tue, und in der Betrachtung der Natur. Dem Innern nach aber lebe er in seinen Gedanken und Vorstellungen, in seinen Träumen auch, die er bei Tag und bei Nacht haben könne. Bei Tage solche, die aus seinen Wünschen sich ergeben, und bei Nacht solche, welche ihm seinen Zustand in entsprechenden Bildern widerspiegeln. Der Abend – wie vorher auch schon der Morgen – seien Übergänge seiner Tätigkeit vom Äusseren ins Innere oder – des morgens – vom Innern in sein äusseres Wesen. Aber jeder Mensch habe einmal in seinem irdischen Leben einen grossen Morgen und einen grossen Abend. Und zwischen diesen beiden liege der Mittag seines Lebens – die schwere Bürde der Pflichten in der heissen Glut der Entscheidung zwischen Gut und Böse, zwischen innerem und äusserem Dienst. Den Lebensmorgen habe der Mensch in seiner Kindheit, in welcher er erst langsam von einer tief innerlichen Erlebniswelt mit grossen Gefühlseindrücken sich nach und nach in seinen Verstand begebe, der die äussern Dinge zu beurteilen beginne und dessen Tätigkeit dann langsam sich erhitze, bis schliesslich nur beinahe noch der kalte Verstand das Leben beherrsche anstatt die Liebe, die das Gefühl beinhalte und damit das Leben selbst sei; und dass die Hitze des Lebensmittages eben von der Enge herrühre, in welche die Liebe durch den Verstand gedrängt wird. Das Licht der Verstandeserkenntnis scheine dabei erbarmungslos in die nach Liebe dürstende Seele und gaukle ihr – wie eine Fata Morgana – eine Welt von Folgerichtigkeiten und unbeeinflussbaren Abläufen vor, welche die Liebe – und das Verlangen der Seele nach ihr – als absolut über-flüssig, nutzlos und sogar hinderlich erscheinen lasse. Erst wenn sich dann mit der Zeit der Mensch überzeuge, dass die Werke des Verstandes nicht alles – ja, im eigentlichen Sinne fast gar nichts – verbessern, sondern die Probleme nur auf eine andere Ebene verlagern, aber damit dem Gefühl der Seele entziehen und sie selbst, zusammen mit ihrer Liebe, als unnütz erscheinen lasse, so würde sich die Seele dann nach und nach von ihrem Erkenntnislicht der äussern Welt – eben dem Verstande – zu trennen beginnen, sodass der Wert des Verstandes bei ihr tiefer und tiefer zu sinken beginne, und damit der Abend vor der Türe stehe, das heisst die Erkenntnis, dass mit und trotz allem Verstande der Mensch dennoch von seinem Äussern einmal in sein Inneres dringen müsse, das alleine von seiner Liebe erhellt werden könne. Dabei erscheine dieses Innere dann aber den meisten Menschen wie das Nichts oder Nichtsein, da sie ja vorher in ihrer Weltlichkeit ihr Sein auch ganz ins Äussere verlegt hätten, obwohl sie doch haben wissen müssen, dass das Äussere für einen jeden einmal aufhören müsse ( beim Verlassen dieser Welt). Wer sich nun dem äussern Naturbilde eines Abends hingebe, müsse darum durch die Entsprechung, welche in ihm liege, tief berührt und auch gerührt werden. Denn die rötlichgoldene Färbung der letzten Sonnenstrahlen lasse den Menschen ahnen, dass die letzten Dinge seines Lebens nur in der Liebe begriffen werden können, und lasse ihn aber zudem fühlen, dass diese Liebesstrahlen nicht so kräftig sind wie ehedem die Erkenntnisstrahlen des Verstandes, weil sie nie gebraucht, geübt und dadurch vermehrt worden sind wie vordem das Licht des Verstandes. Darum breite sich im Gefühle die kalte Nacht des Todes rings um diese vereinsamte – weil ungebrauchte oder für das Äussere vergeudete – Liebe aus. Wer sich hingegen eher dem Wesen des Abends hingeben könne, weil er in seinem Rücken die warme Wand seines Hauses verspüre, welche den Werken seiner Liebe entspräche, während er der fürsorgenden Liebe seines Vaters im Himmel vertrauend entgegensehe und dadurch innerlich zu tiefster Liebe zu seinem treu sorgenden Vater gerührt werde, der verspüre dabei wohltuend, dass sich diese Liebe, die sich ihm durch sein irdisches Leben als äussere Führung dargestellt habe, in ihm gesammelt habe und ihn nun von innen heraus neu gestalte und neu belebe, gleichsam wiedergebäre. Das sei dann die unverlöschbare Sonne des Geistes im liebenden Herzen, welche in sich schönere Verhältnisse, ja ganze Landschaften enthalte, die es in solcher Reinheit und Innigkeit im Äussern nicht gebe. Diese ganze Rede wirkte auf mein Gemüt wie eine Predigt, die fortwährend durch die Vorgänge in der Natur bestätigt erschienen. Denn als sie beendet war, war es dunkel geworden, und mir schien, dass nur die Worte oder die Rede dieser jungen Frau in meinem Gefühl ein Licht gewesen waren, und nicht die letzten Sonnenstrahlen, ansonst ich ja ihr allmähliches Verschwinden hätte bemerken müssen. Das Kind war unterdessen wohl ins Haus gegangen. Ausser uns beiden sah und empfand ich nichts mehr, ausser einer unendlichen Stille, die auf mir lastete, so dass ich förmlich auf erneute Worte hoffte – etwa wie ein Kind in der Nacht auf die Stimme seiner Eltern hofft. Nur war es nicht die Nacht selbst, die mich zu erdrücken schien, sondern die unendliche Stille, die mir meine eigene, innere Stummheit bewusst werden liess angesichts dieses Evangeliums, das ich da gehört hatte und das ich vorhin bereits in der schlichten Natürlichkeit dieser Menschen zu fühlen begann. In mir tauchten dabei die Worte eines Kanons wieder auf, den ich in meiner Kindheit manchmal gesungen hatte: "Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneiget". Wie zog es mich bei dieser Erinnerung so gar mächtig zu diesen Menschen und ganz speziell zu dieser Frau, durch deren Mund mir Worte zukamen, wie ich solche noch in keinem Buche gelesen und noch weniger je in einer Rede gehört hatte, und schon gar nicht aus dem Munde einer Frau. Als sie mich nun einlud, der Kühle des Abends wegen, das Gespräch doch im Wohnzimmer fortzusetzen und ich ihr ins Haus folgte, bemächtigte sich meiner das Gefühl, als ob ich ihr nachfolge in ihr allerinnerstes Wesen, als ob sich mir dadurch etwas eröffne, wie eine Türe in eine zwar ferne, aber im Augenblick ungeheuer deutlich wahrnehmbare, fremde Welt, die dennoch so auf mich zu wirken schien, als wäre sie die Meine und als hätte ich sie bloss in meiner allerfrühesten Kindheit verloren. Als wir in der gemütlichen Wohnstube Platz genommen hatten, sass ich ihr gegenüber an einem Tische und ich ersah im Lichte der Lampe ihr jugendliches Gesicht, umrahmt von den nur kurzen, ganz leicht gewellten Haaren. Ihre Augen waren hell und gross, aber sie sahen nicht mich, sondern die Welt, von der sie mir erzählte. Sie suchten nichts, sie freuten sich nur ob dem Bilde. Eine Zeitlang sassen wir uns schweigend gegenüber. Sie gewiss ganz versunken in ihre Welt, und ich selber sah mit einem Auge in die mir offenbarte Welt und mit dem anderen etwas verstohlen auf diese Frau. Ich war froh, als sie sagte, dass sie einen warmen Tee machen wolle und dazu in die Küche ging. Denn ich beschäftigte mich gerade mit dem Gedanken, wie ein Leben an der Seite einer solchen Frau sich wohl gestalten würde. Und diese Frage begann mich brennend zu interessieren, obwohl ich erstens ein Alter hatte, das dafür nicht das richtige war und zudem ja selber verheiratet war. Aber es ging dabei auch nicht um dasjenige, das gewöhnlich zu vorderst bei solchen Absichten steht, sondern darum war es mir zu tun, zu ergründen, ob eine solche reine Innerlichkeit überhaupt auszuhalten wäre, ob eine solche Geradlinigkeit der Gedanken und ein solcher Reichtum an Gefühlen nicht auch beengend sein musste sowohl für den, der sie besass, als noch vermehrt für den, der sie eben nicht besass, aber doch durch eine Ehe an sie gebunden ist. Diese Welt, die sie mir draussen enthüllt hatte, war so warm und so traulich, dass ich alles hätte darum zu geben vermögen, aber sie war so aussergewöhnlich und anders als die äussere Welt, dass ich mir bewusst wurde, wie einsam man mit dieser innern Welt in der äussern stehen werde. Und dennoch spürte ich die Natürlichkeit und die offene Zuneigung dieser Frau, die nicht meiner Person gegolten hatte, sondern nur dem Menschen vor ihr. Sie konnte nicht einsam sein, die Tochter dieses Hauses! – – Oder war sie wohl nur angenommen worden? Ist sie wohl aus bösen Verhältnissen gekommen, sodass sie sich erst hier so richtig öffnen und entfalten konnte, denn wohl etwas alt – im Gegensatz zu den beiden andern Kindern – war sie wohl. Als sie wieder ins Zimmer trat und drei Tassen auf den Tisch stellte und zwei davon mit Tee füllte, war sie etwas verändert. Sie wirkte nicht mehr so verinnerlicht, es schien eher, sie geniesse die willkommene Abwechslung eines Besuches. Als sie sich setzte, wollte ich endlich wieder das Gespräch aufnehmen, fand aber keine passenden Worte, da bei mir diese vorher enthüllte, innere Welt bereits wieder etwas abgeschwächt war und ihre Veränderung mir zusätzlich vorkam wie eine Zuwendung zur realen Welt. So kamen mir bloss die Worte: "Schön habt ihr es eingerichtet hier". – Sie schien sichtlich erfreut über mein Kompliment und hiess mich doch trinken. Der weitere Verlauf unserer Unterhaltung war denn eher konventionell und stand in einem gewissen Gegensatz zu der früheren Innerlichkeit. So angenehm das Gespräch auch sein mochte, so stimmte es mich doch eher wehmütig angesichts des Verlustes der vorher enthüllten innerlichen Welt, sodass ich richtiggehende Trauer zu empfinden begann darüber, dass das vorher Erlebte nicht so real war, wie ich es mir mittlerweile immer mehr gewünscht hätte. Und dabei begann ich erstmals den Wunsch zu fühlen, dass ich doch eindeutig alle Welt darum gäbe, wenn ich dafür das vorher Erlebte als stets gegenwärtig empfinden könnte. Mir wäre plötzlich alle Einsamkeit recht gewesen, wenn sie zum Schutze dieser verinnerlichten Welt gedient hätte. In diesem Zwiespalt der Gefühle fragte ich dann vielleicht etwas ungeschickt, wie es denn gekommen sei, dass sie mir draussen so tief innerliche Aufschlüsse habe zukommen lassen und wie sie nun so gar natürlich-vernünftig rede, als gäbe es das Vorhergehende überhaupt nicht. Diese Frage musste sie getroffen haben, denn ihre Augen wurden dunkler, und erst nach einer kurzen Weile sagte sie mir, dass sie mir eingestehen müsse, dass das daher käme, dass alles, was sie vorher gesagt habe, aus der Liebe ihres Mannes gekommen wäre, während sie nun aus ihrer eigenen Liebe rede. Es sei indessen nicht so, dass sie dasjenige ihres Mannes nicht liebe, sondern sie liebe es wie ihren Mann selbst, aber nicht mit derselben Heftigkeit wie ihr Mann. – "Ja, dann – – sind sie also – die Mutter der beiden Kinder, die ich gesehen habe?" fragte ich ungläubig, und etwas traurig antwortete sie mit "Ja". – "So, wie Sie meine Frage beantwortet haben, glaube ich, dass Sie das traurig stimme", fragte ich behutsam nach. Aber sie blieb mir ihre Antwort eine geraume Zeit lang schuldig, sodass ich mir Vorwürfe zu machen begann, diese Frau mit meinen Fragen so arg bedrängt zu haben, und ich entschuldigte mich bei ihr für meine Neugierde und schlug ihr vor, auf meine Frage nicht einzugehen. Dieser Vorschlag aber schien sie sehr zu erregen, sodass ich mein Bedauern aussprach, dass ich sie nun ohne meinen Willen noch mehr bedrängen würde, nach all dem Schönen, das sie mir vorhin, draussen vor dem Hause, habe zukommen lassen. Sie aber schien dadurch noch erregter zu werden, und endlich sagte sie zu mir: "Sie müssen sich nicht entschuldigen, denn Sie trifft keine Schuld", und weiter sagte sie, sie sei auch nicht darüber traurig, Mutter dieser Kinder zu sein, sondern darüber, dass sie sich gefreut habe, durch diese Frage ausgezeichnet worden zu sein – um ihrer Jugendlichkeit willen. Denn sie wisse es wohl, dass sie gerne ausgezeichnet sein möchte, dass aber jede Auszeichnung eine Zeichnung in diese Welt hinein sei, und dass dies bereits die zweite Auszeichnung sei, die sie heute erhalte. Die erste ihres Gespräches wegen, das sie allerdings nicht ihrer Auszeichnung wegen geführt habe, sondern meinetwegen, der ich hier Gast sei. Aber ihre eigene gute Meinung über ihre Jugendlichkeit habe sie durch meine Frage schon auszeichnen lassen für diese Welt. Ich wollte sie dämpfend beschwichtigen, aber sie wehrte ab, indem sie sagte, die wahre Jugend sei die Liebe, wenn sie rein sei. Denn dann würde sie eine solche innerliche Welt zu gestalten vermögen, wie sie sie vorher vor mir entworfen habe. Aber ihre Liebe sei weder so stark, noch so rein, weshalb solche Bilder nicht ihr selbst gehörten, sondern sie seien von Gott im Himmel und ersichtlich würden sie im Haupte der Seele erst, wenn das Herz in grosser Liebe erregt würde, sodass das göttliche Licht in ihm seine Strahlen auf das Haupt zu werfen beginne, wo sie dann erst sichtbar würden dem Verstande und der Vernunft. Das Haupt aber eines wahrhaftigen Weibes sei sein Gemahl und des Mannes Haupt sei Christus. Dass sie also diese Bilder weitergegeben habe, sei nicht nur ihr Recht, als Leib ihres Hauptes, sondern auch ihre Pflicht; aber dass sie sich daran freue, sie zu haben anstatt daran, dass sie sie empfangen dürfe, das sei falsch und eitel, weil sie sich dadurch mit diesen Bildern schmücke, anders aber sei es, wenn sie sie bloss empfange, weil sie dann denjenigen ehren, der sie schuf – den Vater im Himmel nämlich – und höchstens denjenigen schmücken, bei welchem sie sichtbar würden. Alle diejenigen aber, die sie dann mit ihrer Liebe ergriffen, können durch sie bereichert werden – ob das ihr Mann sei oder sie, oder ich selbst, dem sie sie vorher weitergegeben habe. "Sehen Sie", fuhr sie dann in ihrer Rede fort, "als mein Mann mich kennen lernte und mir antrug, mit mir zusammen die Welt zu durchwandern, da sagte er dabei zu mir: 'Ich möchte deine mir liebwerte, schöne Brust schmücken mit dem wahren Leben, wie ich es von Gott erhalte und in mir selber wahrnehme. Du darfst sie aber dabei nicht auch äusserlich schmücken und mit Ketten und Geschmeide belasten, weil sie sonst zu meinem Vorhaben untauglich würde. Und deine Finger dürfen nicht geziert sein, ausser mit dem Ring der Treue zu mir und gegebenenfalls zu dem, was dir an mir gefällt; im Übrigen aber nur durch edle und gute Taten. Du sollst auch keine Damenhandtasche tragen mit allerlei Inhalt, der dich zieren könnte oder mit einem Spiegel der Eitelkeit. Dein wahrer Spiegel sei die Wirkung, welche du in deinem Nächsten hervorrufst, aber nicht die zeitliche, sondern die zum Ewigen taugliche, denn nach der zeitlichen Wirkung wäre wohl jede Hure zufrieden mit ihrem Spiegelbild. Deine Hände habe allezeit frei zur Hilfe an deinem Nächsten, dabei kannst du kein Täschchen brauchen. Denn siehe, ich habe dich ausserordentlich lieb und möchte dich glücklich machen und dir geben, was ich nur habe. Aber diese Dinge der Welt würden mich hindern, es dir geben zu können, weil sie all das in dir in Beschlag nehmen würden, was zum Empfange himmlischer Vorstellungen nötig wäre, so wie ich sie von meinem Vater im Himmel erhalten habe'. – Wie Sie sehen, habe ich mir meine Hände zwar allezeit frei erhalten, aber in meiner Brust regt sich manchmal wieder der Wunsch nach Zierde und Auszeichnung, und das verdüstert mir die Bilder jener Welt, in der ich einmal ewig leben werde". Ich begann nun den Preis zu erfassen, der für diese Welt gezahlt werden will. Die Frau war für mich nicht mehr dergestalt unfassbar wie vorher, sondern sehr viel realer geworden, und durch ihre Realität auch einladend zugleich, es ihr gleich zu tun. Alleine, was mir bei ihrem freimütigen Bekenntnis als "Demut" aufgefallen war, wurde vom inzwischen hereingekommenen Ehemanne als blosse Liebe zur Wahrheit dargestellt. "Denn die Dinge sehen zu wollen, wie sie sind, ist Liebe zur Wahrheit, und nicht Demut", sagte er weiter und fuhr dann fort, "Demut ist erst der Wunsch, die Dinge mögen so gestaltet sein, dass man selbst stets am schlechtesten wegkommt. Und erst diese Demut gewährt einem die Garantie, nicht bei Sichtweisen vergnüglich stehen zu bleiben, die einem irgendeinen Vorzug vor andern geben, sodass dadurch nicht etwa seine stete Vervollkommnung gefährdet wird." Auf meine Frage hin, ob sie denn in irgendeiner Glaubensgemeinschaft seien, sagte der Mann folgendes aus: "Die Glaubensgemeinschaften alle sind solche, welche durch Auslegung klug werden wollen. Klug wird man aber nur durch die Erfahrung! Also gibt es keine allgemeingültige Auslegung, als jene des Herrn selbst, und dann die Erfahrung nach der gebotenen Tat des Wortes. Wären die Glaubensgemeinschaften nicht so stolz, anstatt demütig, so würden sie nicht auf die Richtigkeit ihrer Auslegung pochen, sondern demütig bekennen, dass sie nichts verstehen, dass sie aber voll Glauben und Hoffnung seien, dass der liebende Vater im Himmel seine noch ungeschickten Kindlein schon so führen werde, dass sie aus der Tat nach seinem Worte ersehen mögen, ob sie das Evangelium richtig aufgefasst und ausgelegt haben oder nicht. Wenn sie aber alles getan haben, und am Ende nicht aus voll gefühlter Einsicht bekennen können, dass sie bei all ihrem Tun allzeit nur faule und unnütze Knechte waren – wie es die Schrift fordert –, so war offenbar das Evangelium falsch ausgelegt und angewendet worden. Seit Moses haben die stolzen Grossen der jüdischen Glaubensgemeinschaft fast alle Propheten verfolgt und sie der Gotteslästerung bezichtigt! Seit Christi Tod am Kreuze haben das alle christlichen Gemeinschaften, aller und jeder voran die katholische, so weiter gehalten, sodass die stets präzisere Auslegung des Herrn, wie sie selbst durch neuere und neueste Propheten geschehen ist, in das Dunkel der Vergessenheit geraten mussten, nur deshalb, weil der Eigendünkel solcher Gemeinschaften sich das Recht nahm, selber auszulegen, dass weiters keine Propheten und Seher mehr sein dürfen, sondern nur noch ihre eigene falsche Auslegung". – Aus diesem Grunde, so fuhr der Mann fort, seien sie selbst in keiner besonderen Gemeinschaft ausser der Landeskirche, die sie aber nie besuchten. Dafür hielten sie es mit der Tat nach dem Worte und mit der Auslegung wie sie von Gott Erleuchteten in fast allen Jahrhunderten gegeben wurde, wie etwa von einem Swedenborg oder einem Lorber und vielen anderen. Mir wurde dabei stets deutlicher, dass die beiden Eheleute einen ungemeinen Ernst in der Sache des Glaubens an den Tag legten, und das Gefühl der Geborgenheit und des endlichen Zuhause-Seins schien mir immer klarer von einer tatsächlichen Anwesenheit eines Vaters im Himmel – wie sie selber Gott nannten – herzurühren. Denn auf dieselbe Art, wie mir seine Gattin die geistige Entsprechung des Abends zeigte, erklärte mir der Mann nachher beinahe eine jede Erscheinung in der Natur, auf welche wir im Verlaufe unseres langen Gespräches noch gekommen waren, so dass die ganze Natur ein Evangelium Gottes zu sein schien zur Stärkung eines jeden, der in der Liebe zu Gott so stark würde, dass er bei allem nur zuerst den Bezug auf Ihn suche, und erst daraus dann auf die etwa notwendige Handlung bei einer Sache schliesse. – Beide empfanden das Leben auf dieser Erde als äusserst hart und aufreibend, obwohl sie anderseits immer wieder betonten, dass sie kaum eine Sorge plage in jener Art, wie die Menschen sie sonst kennen, nur eben die Sorge, endlich einmal so vernünftig, einsichtig-liebevoll zu werden, wie es das Evangelium verlangt – also die Sorge nach dem Reiche Gottes, welches sich nur in dem Masse im Menschen ausbreite – wie mir der Mann erklärte –, in welchem Masse der Mensch dafür tauglich würde. Vieles wurde noch die halbe Nacht hindurch besprochen, bis endlich – gegen das Morgengrauen hin – die Gastgeber sich noch zu einem kurzen Schlafe legen wollten, während ich in mein mir zugewiesenes Zimmer ging. Die Stille, die sich nun verbreitete, wärmte mich diesmal und liess das nochmalige Aufleben dieser ganz eigenen und so traulichen Welt nochmals möglich werden, während wie ein fernes und verblichenes Schwarzweissbild die vom fahlen Mondlicht beschienene Naturwelt durchs Fenster zu mir hin zu dringen versuchte. "Einmal wird diese da draussen auch für mich persönlich so verblassen, wie ich sie jetzt sehe", dachte ich. "Werde ich dann bereits eine so schöne, wärmende eigene Welt aus der Hand des himmlischen Vaters mein eigen nennen?" 13.8.1991 Aus der Reihe: "Wenn wir christlich leben würden" |