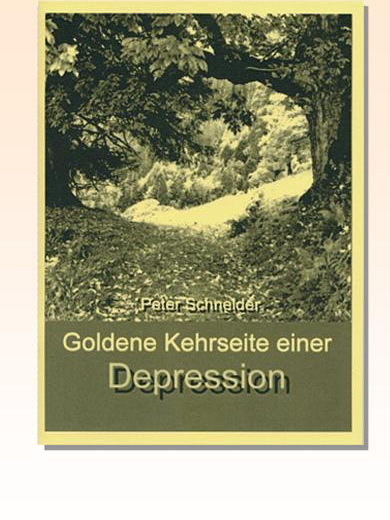 |
|
||||||
GOLDENE KEHRSEITEN EINER DEPRESSION |
|||||||
|
In meinen frühern Jahren hatte ich einmal die Gelegenheit, in unserm Hause einen Mann näher kennen zu lernen, der mir soviel zu berichten wusste wie niemand mehr seither. Zwar wohnten wir schon längere Zeit in demselben Hause, aber man sah ihn nie, man wusste einfach, dass die Wohnung besetzt war; und wie ihr Eigentümer hiess, konnte man am Glockenschild lesen. Einmal aber, als ich die Treppe hoch ging, stand er gerade in einer eher unschlüssigen Weise vor seiner Wohnungstür, sodass ich mich veranlasst sah, ein freundliches Wort zu ihm zu reden. Dabei, ergab ein Wort das andere und er lud mich im Laufe des Gespräches ein, doch in seine Wohnung zu kommen, wo es sich besser sprechen lasse als im Treppenhaus. Weil mich alle seine Worte oder Aussagen sehr interessierten und auch, weil ich spürte, dass er sehr zurückgezogen, in sich gekehrt und dadurch wohl auch etwas einsam war, konnte ich ihm seinen Wunsch nicht unerfüllt lassen, umso mehr als es ein Samstag war, ein Werktag also bloss nur für meine eigenen Bedürfnisse. Im Laufe des ferneren Gesprächs fiel mir seine grosse Kenntnis in der Philosophie auf; aber auch im psychologischen Bereich förderte er ungemein Vieles zutage, das ich so noch nie gehört oder gelesen hatte, dem ich aber sehr gut folgen konnte, ohne dass ich mich selber schon einmal in einer der von ihm beschriebenen Situationen befunden hätte. Alles, was er sagte, hatte Hand und Fuss, war so in die Natürlichkeit der Begebenheiten gebettet, dass es mir wie von selbst einzuleuchten begann. Später erfuhr ich von ihm dann auch, dass er sich auf seine Weise sehr eingehend mit Gott beschäftigt hatte und dabei zu einem ungewöhnlich vertrauten Verhältnis zu ihm gekommen war; aber dann begann ich auch zu merken, wieso er eigentlich derart zurückgezogen war. Er musste in seinen früheren Jahren wirklich fast ein Verhältnis wie von Du zu Du mit Gott gehabt haben, hatte sich dann aber, wie er sich ausdrückte, übernommen – zuviel auf sich selber zugute gehalten – und so seinen vertrauten Umgang mit ihm verloren. (Die Worte, die er für diese Schilderung brauchte, waren so natürlich, mehr noch: so einleuchtend einfach, dass ich es wie selbstverständlich hinnehmen musste, dass es so etwas gab, oder hatte geben können, obwohl ich selber bis dahin noch nie, auch nur im Entferntesten, Ähnliches vernommen hätte.) Er spüre wohl, sagte er, dass Gott auch heute noch sein einziger Beschützer sei, aber er spüre es auch recht deutlich, dass er ihm immer erst an der alleräussersten Grenze zu Hilfe komme, dort, wo er schon die Katastrophe wähne; und das sei darum so, weil er sich wie der verlorene Sohn zu weit an die äusserste Grenze eines vertrauten Liebeverhältnisses gewagt habe oder vielmehr verführen habe lassen. Denn: alles nur von Einem zu erhalten und dabei sich dennoch selber reich zu wähnen, das sei schon so viel, wie nach dem Erbe seines Vaters zu verlangen. Gewiss, das waren strenge oder kategorische Worte, und ich hätte sie leicht in den Bereich religiöser Verstiegenheit einzuordnen Grund gehabt, wenn ich nicht vorher auf sein wirklich grosses Wissen und seine reichlichste Erfahrung aufmerksam geworden wäre, die eine Dimension besitzen musste, in welcher religiöse Verstiegenheit nicht mehr vorkommen konnte, weil diese doch immer nur aus sehr engen geistigen Blickwinkeln heraus erwachsen kann. Die grosse Breite an gemachten Erfahrungen würde schon den Ansatz zu einer Verstiegenheit in die Weite der selbst erlebten Möglichkeiten versinken lassen, in das Meer der grenzen-losen Verschiedenheit aller Vorkommnisse und aller Deutungsversuche daraus. Nein, dieser Mann, der nun so ruhig, wenn auch sichtlich etwas wehmütiger als zuvor, mit mir sprach, war in keiner Weise fanatisch, heftig, oder gar rechthaberisch – viel eher etwas gebrochen erschien er mir. Er sagte mir auch, dass er schon früh erkannt habe, nach welchen Gesetzen der Welt Lauf sich richte. Aber früher habe er Distanz dazu gehabt, während er heute gewissermassen mit einbezogen sei; nicht dadurch oder darin, dass er dasselbe tue, sondern nur darin, dass er in sich das Gegenteil davon nicht mehr handelnd finde. Er sähe es zwar wohl, aber es würde in ihm nicht aktiv. Er müsse es sich jedes Mal in einer Situation von Gott erbitten, und er erhalte es immer erst dann, wenn er schon in der Not des Verlierens seines eigenen Standpunktes zu versinken begänne. Das sei sowohl in der Einsamkeit möglich, wenn sie sich ins Innerliche zu erstrecken begänne, aber viel öfters oder beinahe immer, wenn er unter Menschen sei. Nur ganz wenige gäbe es, in deren Nähe er das nicht verspüre oder sogar Gegenteiliges empfinde; so auch nun, während dieses Gespräches. Er pflichtete mir bei, als ich ihm gegenüber vorsichtig erwähnte, ob das nicht eine Art Depressionen seien. – "Reden Sie ruhig, wie Sie es sehen; Sie können mich nicht erschrecken", sagte er, "ich sehe es schon klar genug, ich drücke mich nur geflissentlich etwas undeutlich aus, damit ich Sie mit dem Druck nackter Tatsachen nicht zu sehr überrasche. – Auch wäre es mir sehr recht, dieses Gespräch würde unter uns verbleiben." Das sicherte ich ihm natürlich zu. In der Folge traf ich ihn noch öfters einmal, aber stets vor seiner Wohnungstüre; denn irgendwie tat mir der Gemütsreichtum dieses Mannes wohl, und seine Verlassenheit und unscheinbare Existenz erweckten in mir das Verlangen, ihm zu wieder etwas mehr Boden in dieser Welt zu verhelfen. Als ich ihn einmal an einem Sonntag Morgen vor seiner Wohnungstüre traf und mit ihm wieder ins Gespräch kam, da wollte ich ihm vorschlagen – damit wir uns nicht immer wieder in seiner "Klause" besprechen müssten –, wir könnten doch heute einmal in den nicht weit vom Haus gelegenen Wald etwas spazieren gehen. Das verunsicherte den Mann sichtlich, und ich verspürte eine Unruhe von ihm ausgehen während er weiter sprach. Ich relativierte meinen Vorschlag als einen blossen Gedanken, der mir gekommen sei, und dass es überhaupt nicht sein müsse, und schon gar nicht jetzt gerade. Das wiederum beruhigte ihn sichtlich, aber in seinem Gemüt schien sich dennoch Vieles zu bewegen. Es schien mir, als musste er in sich eingehenden Rat halten. Der Ernst und die Bewegtheit seiner innern Vorgänge, die sich in die Züge seines Gesichtes zeichneten, berührte mich sehr. Dann begann er mir zu gestehen, dass er schon viele Jahre – sicher über zehn – nie mehr in die Natur spazieren gegangen sei. Dass er nun zwar eigentlich schon gerade Lust dazu hätte, aber ich wisse ja, dass er in der Welt draussen keinen eigenen Gegensatz zu ihr in sich mehr spüren könne und dadurch sich leicht verliere in einer Hilflosigkeit, die ihm panische Angst einjagen könne. Darum wäre es ja vielleicht eben gut, sagte ich zu ihm, er würde in Begleitung eines Menschen gehen können, der um seine Probleme wisse und darum nicht gleich erschrecke, wenn es ihm schwierig werden sollte. Zudem könne er die Dauer des Spazierganges bestimmen. Diese Worte mussten ihn mit einer gewissen Zuversicht erfüllt haben, denn er ward – zwar äusserlich gespannt – doch ruhiger im Sinne von: bestimmter; und er sagte mir darauf zu, sofern es jetzt gleich geschehen könne. Und das konnte es, denn ich hatte nichts vor und es drängte mich, diesen Mann wieder mehr ins Gleichgewicht zu bringen. Er zog sich in seiner Wohnung rasch Schuhe und einen Kittel an, während ich bereits Schuhe trug und einen Kittel des warmen Wetters wegen nicht benötigte; und so gingen wir dann zusammen in den nahen Wald. Das kurze Stück Weges über ein Feld war er sehr konzentriert und schweigsam. Im Walde selbst schienen sich seine Züge etwas zu lösen, aber nur für kurze Zeit. Bald einmal fragte er mich, wie weit ich zu gehen gesonnen sei. Ich aber entgegnete ihm, dass das sein Spaziergang sei und ich mich darum nach seinen Bedürfnissen richten werde. Aber, wenn er nicht zu tief in den Wald gehen möchte, so schlage ich ihm vor, den Weg dem Innern des Waldsaumes entlang zu gehen. Da könnten wir gemütlich hin und her gehen, sodass wir jederzeit bald wieder zu Hause sein könnten. Dieser Gedanke schien gut zu sein. Denn seine Züge entspannten sich zusehends und es kehrte eine gewisse Natürlichkeit in ihn zurück. Aber er sprach nicht viel. Er schien in sich selber sehr beschäftigt zu sein, sodass auch ich nur hin und wieder ein kleines Wort verlor, um ihn nicht zu stören. Mit der Zeit begann ich so etwas wie eine tiefe Dankbarkeit in ihm zu fühlen. Irgendwie war er sehr bewegt, aber wohl doch glücklich. Es war für mich eine eigene Lust, neben diesem Glücksgefühl – wie es mir beinahe vorkam – einhergehen zu können. Doch mit der Zeit begann ich die Bewegtheit seines Gemütes eher wieder als ein "Leiden" zu fühlen und ich sagte ihm darum, dass er mir sagen müsse, wann er wieder nach Hause wolle. "Ja ja", sagte er abwesend, und etwas später setzte er hinzu, wenn es mir nichts ausmache, so wolle er in der nächsten Zeit dann schon wieder nach Hause. Ich wollte dabei gleich umkehren, aber er meinte, es müsse nicht gerade gleich sein; aber nach einer kleinern Weile bat er mich dann, doch umzukehren, und wir gingen zusammen nach Hause, wo er sich recht herzlich bedankte und mich fragte, ob es mir nichts ausmache, wenn er nun etwas alleine sein möchte. Natürlich machte mir das nichts aus, und so war dieser erste Spaziergang für ihn seit über l0 Jahren glücklich vollendet. Als ich ihn kurz darauf wieder einmal vor seiner Haustüre traf, vor der er sich sichtlich immer mehr etwas zu schaffen machte – vielleicht nur, wenn er mich zu treffen glaubte –, bedankte er sich nochmals sehr herzlich, fast Anteil nehmend an meinen Umtrieben, die ich mit ihm gehabt habe; worauf ich ihm zur Antwort gab, dass es für mich schön gewesen sei, an seiner Seite gehen zu können und zu bemerken, wie tief ihn alles berührt habe – im Gegensatz zu andern Menschen. "Sie haben das gespürt?" fragte er vorsichtig und fast ungläubig nach. "Darf ich Ihnen dann erzählen, was ich dabei alles erlebt habe?" – "Ja, das würde mich aufrichtig interessieren", sagte ich und er lud mich ein, in seine Wohnung zu kommen. Als wir uns setzten, begann er sich etwas unruhig zu erkundigen, ob er mir nicht etwa zu viel Zeit abnötige, welches Bedenken ich ihm mit dem Hinweis entkräftete, dass ich ihm ja extra erwähnt habe, dass es mich interessieren würde. Darauf erklärte er mir, dass er den Wald als eine gewachsene Einheit sehe und empfinde, so etwa wie die Seele des Menschen auch eine Einheit sei. Wie im Walde die Bäume, so würde auch in der Seele so manche Eigenheit sich bilden und formen auf dem Grunde ihrer Liebe. Manche schön und erhaben wahrzunehmen, viele eher beiläufigen Charakters und dazwischen aber auch hässliche, disharmonische. Alles im Wesensraum der Seele sei darum auf der einen Seite ebenso erfüllt wie der Raum des Waldes, aber es resultiere aus dieser Fülle dann ebenfalls eine gewisse Dunkelheit des Erkennens sowohl in der Seele wie im Walde. Der Boden des Waldes sei jenem der Seele gleich, sowohl dem Wesen wie der Gestaltung nach. Dem Wesen nach sei der Boden im Walde für den Auftritt des Fusses eines Besuchers weich durch das abgefallene Laub des Vorjahres, auch wenn es noch nicht verrottet ist; in der Seele hingegen eher durch die spontane Frische der Empfindung, die nur bei solchen Menschen erhalten bleibe, welche alle Empfindungen aus vorhergehenden Ereignissen oder Erlebnissen möglichst voll aufgearbeitet haben. Unverarbeitete Ereignisse und Erlebnisse, die im Gehirne haften – den toten Blättern entsprechend – seien eher dem Sand der Wüste gleich. Sie können zwar ebenfalls einen weichen Tritt gewähren, seien aber gefährlich, weil sie sich nicht zu einem festen und lebendigen Boden verbänden, weil ihnen die Liebefeuchtigkeit noch mangele, die sie zusammenhalten und verbinden würde. Und in der Gestaltung sei der Boden des Waldes jenem der Seele ähnlich, weil er ebenfalls sehr unterschiedlich beschaffen sein könne: Zum grossen Teil meist eben oder sanft hügelig gestaltet, hie und da auch schroffe Brüche im felsigen Untergrund mit gefährlichen Felsvorsprüngen, aber auch morastige Gräben, welch letztere beiden sich ebenso vorzüglich im gemütstiefen Wesen der Seele vorfinden und weniger im offenen und dadurch besser durchleuchteten Feld des Verstandes oder den Feldern der Natur. Die Verwerfungen und Felsvorsprünge können allerdings auch völlig kahl und offen, also unbewachsen sein wie im Hochgebirge, wo sie dann den fürchterlichen Taten der Menschen entsprechen würden, die zwar auch alle auf dem Boden des Gemütes einer Seele vorhanden sein müssen, aber in und mit dem Verstande erst in aller Offenheit ausgeführt werden und so erst von weit her jedermann ersichtlich werden. Im Walde hingegen seien sie erstens verhüllt und darum nicht schon von ferne sichtbar, wie die Anlagen der Seele auch in unzähligen Bildern und Möglichkeiten – Andeutungen im Gefühle gleich – verhüllt zutage treten und nicht sogleich offen liegen wie eine vollendete Tat. Denn der Boden einer jeden Handlung, auch eines jeden Wunsches, bildet die Liebe eines Menschen. Je nach ihrer Artung ist dieser Boden ebenmässig oder, von den Leidenschaften hin und her gerissen, verhärtet in der Selbstsucht und zerklüftet mit vielen Vorsprüngen der Eigenliebe. Der Verstand, der aus den Wirkungen der Gefühle und der Vorkommnisse die notwendige Erfahrung gewinne, sei dem Laub entsprechend, das von den (Erkenntnis-)bäumen übrig bleibe und – besonders im Alter – die eher örtlichen Unebenheiten der Bodengestaltung ausgleiche. Grosse Verwerfungen in der Liebestruktur, als dem Boden des Gemütes, müssen durch die Erkenntnisbaumformen, die das Licht der Liebe erschafft, auf Grund deren Wurzelkraft in ihrem Gefüge zersprengt und mit der Zeit auch aufgelöst werden, möglichst bevor sie zu eigentlichen Taten werden, oder bevor sie von grossen, den ganzen Boden erschütternden äussern Ereignissen zerstört werden müssen. Jeder Mensch habe und kenne in seinem Gemüte solche Gräben, wenn er achtsam sei und ehrlich zu sich selber. "Wie viel tut der Mensch wider seinen eigentlichen Willen; ja, wie viele Begehren spürt er in sich, die er mit dem geläuterten Verstande nicht gutheissen kann", sagte er und fuhr dann weiter "Aber in der Tiefe der Seele besteht für den wandernden Beschauer – wie in der Tiefe des Waldes auch – die Möglichkeit, aus solchen Gräben wieder herauszukommen, weil auch in einem solchen Graben Bäume und Sträucher wachsen können, oder in der Seele sich Bilder gestalten können, an denen der Wanderer durch diese Erdenzeit sich wieder hochziehen kann von Baum zu Baum, von Bild zu Bild, bis er die Verwerfung überwunden hat und sie der weitern Wirkkraft solcher Bäume oder Bilder überlassen kann." So sehr mich diese Erklärung innerlich auch angesprochen hatte, so sehr wollte ich sie auch in einem Beispiel erhärtet sehen. Zu schön waren solche Bilder, als dass ich sie wirklichkeitsfremd hätte stehen lassen mögen. Aber mein Mann hatte auf diese meine Sorge unzählige Beispiele parat. Er sagte unter anderem: Wenn zum Beispiel ein Jüngling, hingerissen von der anmutigen Form eines Mädchens, diesem zu unerwartet einen Antrag macht, so kann es geschehen, dass sie sich von ihm abwendet, dass sie ihm gar sagt, dass sie bereits eine Bekanntschaft habe; dabei war sie doch noch wenige Augenblicke vorher so angetan vom frischen Ernst und Mut des Jünglings. Wenn aber der Jüngling dabei traurig und mutlos sich zurückzieht, so hat die Maid hernach genügend Zeit, um in sich zu überlegen, wie die Dinge wirklich stehen und Mittel und Wege zu finden, einen eventuellen Fehler wieder gut zu machen. Stattdessen kann sie sich aber auch bemüssigt fühlen, ihre Position, die doch offensichtlich völlig quer in der Landschaft steht, in sich selber entweder zu entschuldigen, oder im schlimmeren Fall gar zu verteidigen. Und so sehr sie auch in spätern Jahren – vielleicht gar in der Ehe mit einem andern – an diesen Jüngling zurück denken muss, so sehr wird sie ihn dabei aber auch immer wieder von neuem verkleinernd betrachten mit der Hilfskonstruktion des Gedankens, dass dieser, wenn er sie wirklich geliebt hätte, sie schon noch einmal gefragt hätte. Aber darauf kommt sie nicht, dass sie, die ihrem Liebhaber einen zwar unbeabsichtigten, aber dennoch äusserst derben Schlag einer Absage erteilt hat, zum "Verletzten", ja in seiner Hoffnung gar fast Getöteten hinginge, sich zu ihm setzte und ihm erklärend sagte, es wäre ihr mörderischer Schlag gegen ihn nicht aus dem wahren Grunde ihres Herzens gekommen, sondern sei nur eine ungeschickte Reaktion gewesen, die sie nun umso mehr bedaure, als sie sehe, wie sehr sie ihn damit getroffen habe, obwohl sie sich damit zu noch nichts weiterem entschlossen habe. Wenn so tief empfundene Anträge und Absagen in der heutigen Zeit ständiger äusserer Ablenkungen auch weniger mehr üblich sein werden, so ist das Prinzip dennoch immer dasselbe – sofern noch etwas Gemütsleben überhaupt vorhanden ist. Wo das aber ganz fehlt, da fehlt auch jede Grundlage zur Betrachtung eines Lebens. Was aber ist nun schuld an der Lage in diesem geschilderten Beispiel? Nichts anderes, als das Nicht-zugeben-Können eines Fehlers, nichts anderes also, als Eitelkeit, als der Wunsch, nach aussen perfekt und ohne Blössen zu erscheinen. Wenn denn ein Mensch das schon einmal erlebt hat – sei es an sich oder an andern in seiner Gegenwart – so müsste er doch in seinem Gemüte nach Möglichkeiten suchen, solche Gräben oder Verwerfungen verkappter Selbstüberhebung zum Zerfallen zu bringen, oder doch Formen und Möglichkeiten – oder entsprechend Bäume – zu finden, auf Grund derer er den Graben wenigstens in den entscheidenden Momenten überwinden kann, damit er hernach dann mit der Kraft der Wurzeln solcher "Bäume" das harte Gestein zerbröckeln lassen kann. Wie leicht aber kommt es vor, dass ein solcher Pechvogel von einem Brautwerber von der ganzen zugegen gewesenen Gesellschaft später immer wieder hochgenommen wird und damit sein Leid des Zurückgestossenseins noch verstärkt wird. Dabei spürt wohl jeder Einzelne in dieser Gesellschaft das Bestreben, sich gesellschafts-konform zu verhalten, obwohl ihm anderseits das Weh des Betroffenen nicht unbekannt sein kann. Könnte er in seinem Gemüte nicht Formen finden, die ihm die Möglichkeit verschafften, zum Verlassen des Grabens seiner eigenen Charaktersschwäche zu kommen um damit auch dem Betroffenen wieder eher zurecht zu helfen? Vielleicht müsste er oder sie dann mit dem Verlassen der eigenen Schwäche auch gleich die Gesellschaft verlassen, um dem Betroffenen besser beistehen zu können. Aber just das kann er zumeist nicht, sosehr er doch anderseits einsehen muss, wie wenig wert eine solche Gesellschaft ist. Und mit diesem Problem stehen wir schon mitten im äussern Alltag; so spielt er sich im Geschäft, in der grossen Gesellschaft, in der Politik ab, kurz: überall in der Welt. Im innern Alltag der jeweils Betroffenen sieht es aber anders aus: sie sind ausgeschlossen, weil sie lebendige Gefühle haben, die sie nicht verleugnen wollen. Das weiss der Mensch instinktiv, darum wagt er sich nicht in die Tiefe des Waldes seiner Seele, weil er die darin vorkommenden Dinge kaum ertragen, geschweige denn überwinden könnte, und weil er vor allem auch spürt, dass wenn er sie da überwunden hätte, er sie im noch schwierigeren Äussern ebenfalls überwinden müsste Darum ist es dann nicht verwunderlich, wenn dem im Beispiel angenommenen Jüngling dann später die absurdesten innern Regungen und Wünsche kommen, wenn er zuvor erlebt hat, dass eine Schöne ihr äusseres, früher oder später der Vergangenheit angehörendes Gesicht mehr zu schützen bestrebt war als ihr weit sensibleres, weil lebendigeres inneres Gesicht des Mitgefühls. Denn das innere verdeckte sie bloss mit einer einmaligen ungeschickten Aussage, das äussere Gesicht suchte sie vor sich selber mit unzähligen Entschuldigungen und Begründungen zu wahren. Es ist darum keine Frage, woher es einem solchen Jüngling kommt, dass er später auch im Äussern bei einer neuerlich Begehrten durch Blossstellungen prüfen will, wie weit sie diese ertragen kann, oder wenn er ihr wehe tun will, um zu erfahren, wie viel sie auf sich nähme seinetwegen, um zu sehen, wie schön sie wirklich – weil im lebendigen Innern – ist. Dabei ist der geschilderte Fall aber immer noch der beste unter allen möglichen Fällen. Wie oftmals mehr geschieht es, dass die Frauen durch äusseres Schmücken sich noch extra begehrlich gestalten und dann sogar eine Wonne darin finden, so manchen Mann damit innerlich zu treffen und den innerlich Blutenden und sich Windenden dann genüsslich sich selbst zu überlassen. Was Wunder, wenn in einem solchen Menschen dann umgekehrt Gefühle und Gedanken aufkommen, im Gegenzug einmal eine solche – wenn dann auch durch eine äussere Handlung – zu "verletzen", um es geniessen zu können, wie sie sich dabei vergeblich windet. Wer soll, wer kann dann solche Entwicklungen in einem Menschen bremsen, als alleine eine Person, die das in ihm wachgerufene und an einer unschuldigen Person ausgeführte Begehren aus Liebe und Verständnis auf sich nähme und ertrüge, um ihn wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Aber wer kann das?! Und wenn er es schon einmal, einer grossen Zuneigung wegen, könnte, könnte er das auch immer wieder von neuem, sooft sich die alte "Verletzung" wieder regen würde?! Darum ist es besser, der Verletzte versucht bloss in innern Bildern dasjenige zu tun, zu was er sich gedrängt fühlt. So kann er dann auch alle Konsequenzen aus seinem Handlungsdrange erfühlen, abwägen und in der Rückwirkung auf ihn selber betrachten und daraus erkennen, wann, wo und wie viel Unrecht er damit auf sich laden würde. Vielleicht würde er auch spüren, dass ihrem Äussern nach weniger Ausgezeichnete ihn auch weniger konfrontieren würden, und dass bloss in ihrem innern Wesen Schöne ihn viel sachter ansprechen würden, sodass er nur allmählich ihres Reichtums gewahr würde, dessen Tiefe er dann nicht mutwillig antasten wollte. Dadurch verlöre aller äussere Glanz für ihn jeden Wert, ohne dass auch er sich irgend an jemandem mit noch so geringfügigen Handlungen schuldig gemacht hätte. Dieses Vorgehen entspricht dann dem Gang in die Tiefe des innern Waldes, wo zwar oft auch wilde, tierische Leidenschaften hausen und unwegsames Gelände sich findet, wo aber auch eine Bestie die andere in ihrem Bereich begrenzt oder sie gar vertilgt und damit unschädlich macht und unzählige Lebensformen der Pflanzenwelt fast jeden Graben überwindbar machen. Und weil diesen Gang so viele scheuen – viele aus Angst, die allermeisten aber aus Bequemlichkeit –, darum musste am Ende der Schöpfer aller Menschen selbst in völliger Prunklosigkeit in einer finstern Nacht, von allen abgelehnt, in einem Stalle in diese Welt geboren werden, um all die vielen Schulden der Menschen zu tilgen, durch welche andere innerlich und äusserlich verwundet worden sind, und diese Wunden damit heilen, dass er fast nackt – auch nackt von jeder Weltehre – am Kreuze aus voller Liebe zu uns Menschen sein Blut vergossen hat." Mit dieser mit grosser Begeisterung und tiefer Anteilnahme ausgeführten Erklärung war er wieder bei der Religion und bei Gott, der ihm irgendwie so nahe sein musste – so fern oft seine Hilfe für ihn in Momenten zu sein schien. Und er fuhr dann etwa folgendermassen fort: "In dieses Dunkel wage ich mich in der Natur nicht, weil ich schon in meiner Seele in dieser Dunkelheit bin. Dunkel deshalb, weil das Vorhandene mir viel zu gross erscheint meiner schwächlichen Kraft gegenüber, welche durch die Wucht aller Eindrücke, die ich nicht zuletzt auch von aussen, von den andern scheinbar unbeteiligten Menschen her empfinde, noch stetig weiter geschwächt wird. Zu sehr wird durch das entsprechend äussere Bild dann das innere belebt, als dass ich seinem Eindruck auf mich standhalten kann. Hätte ich ein gediegeneres Zuhause in mir selbst, so wäre ich der im Innern einwirkenden Gewalt der andern nicht in dem Masse ausgesetzt und könnte dann die Gewalt äusserer Eindrücke auf mich eher verkraften. Aber dieses Zuhause habe ich leider nicht mehr. Wohl weiss ich, dass es die Demut und die Bescheidenheit wäre, und in Ihren Augen bin ich vielleicht sogar demütig und bescheiden. Aber es gleicht diese Demut und Bescheidenheit jener eines Bettlers: Ihm bleibt nämlich nichts anderes übrig, er will sie beide nicht, er muss sie einfach haben, um überleben zu können! Sie sind nicht sein! Und mir geht es da genau gleich. Ich habe mich einmal übernommen, und seither muss ich es bitter fühlen, wie wenig an mir selber ist, wie wenig Eigentum ich noch habe. Wenn ich mich völlig darein schicke, so erfahre ich jeweils noch die meiste Hilfe von oben. Wenn ich aber nur im Geringsten im Äussern etwas scheinen möchte – sogar nur wie ein so genannter normaler Mensch – dann muss ich es wieder erfahren, wie gar nichts ich habe. Erst wenn ich mich wirklich damit abfinde, effektiv nicht einmal das Minimum eines "Normalen" zu haben, dann werde ich spürbar gehalten. Aber wenn ich vor Ihnen so rede, so ist das schon ordentlich eine Kunst. Nur, wenn ich mir denke, dass Sie einem psychisch Kranken zu seiner Entlastung zuhören, dann kann ich in kindlichem Vertrauen so voll aus mir schöpfen; sowie ich aber Ihre Achtung zu spüren beginne, gerate ich wieder mehr unter Druck. Darum hat mich dann auch der Spaziergang auf dem Wege innerhalb des Waldsaumes so herzlich tief erquickt. Ich spürte wohl, dass Sie es genau wissen mussten, mit wem Sie es in mir zu tun haben: mit einem nicht ganz völlig Zuverlässigen; aber ich spürte zugleich, dass Sie mir das zu geben bereit waren, was ich von Ihnen brauchte. Ich war nicht voll, fühlte mich auch nicht verpflichtet, voll zu sein und konnte darum zu meiner Armut stehen, umso mehr als ich es als Seligkeit empfand, als Armer von Ihnen etwas erhalten zu können, das Sie sichtlich nicht ärmer, sondern eher reicher werden liess – wie ich es fühlte. Und so gesehen war der Spaziergang darum auch meiner innern Situation entsprechend: Wir gingen beide am innern Rande unseres Gemütsfeldes spazieren. Ich sah den Wald und spürte dabei seine Tiefe an meiner Seite, ohne befürchten zu müssen, ihr in meiner Schwäche plötzlich anheim zu fallen. Und Sie selber verspürten wohl diesen Waldesbeginn in meinem Gemüte, ohne ihn freilich genau zu erkennen, aber sich doch erfreuend an dem Umstand, dass es einen solchen gibt. Darin waren wir so völlig eins wie im Lichte der Sonne, das sich zeitweilig zwischen dem Schatten, welchen die Zweige und Blätter warfen, über uns ergoss. Und neben uns, durch eine nur lockere Baumreihe leicht verdeckt, lag das offene Feld, dem Verstande und dessen Beurteilung der Situation entsprechend, die wir beide doch haben mussten, weil wir sonst nicht so ohne Worte zurechtgekommen wären. Auf diesem offenen Felde des Verstandes tummeln sich die meisten Menschen ihrer Seelenbeschaffenheit nach. Es kann für seinen Betrachter leicht zu einer Wüste werden, weil er sich mit seiner selbstbewussten, senkrechten Gestalt hoch über seiner Ebene hinbewegen kann und sich deshalb nicht mit den vielen Dingen, die in diesem offenen Felde liegen, identifizieren muss, wie es die Liebe täte, sodass er innerlich einsam und damit wie in einer Wüste bleibt, die einzig ihre Unterlage als Tatsache ins Wesen des Wanderers einfliessen lassen kann, was ihn jedoch niemals bereichern kann. Das gefühlstiefe Gemüt hingegen nimmt seinen Betrachter völlig in sich auf, oder schliesst ihn ein wie der Wald seinen Wanderer. Mich beengt darum das offene Feld, weil es dem Verstande zu sehr gleicht, der zwar alles offen einsehen kann, sich aber mit nichts vereinen kann. Zudem gibt es über allem Verstande auch Dinge, die dennoch wirksam sind, auch wenn sie jeweils ausser seiner Möglichkeit liegen, es zu verstehen. Diese spürt man nur in der Atmosphäre der Liebe und ihres vertrauenden Glaubens; und diese beiden lassen dem Menschen dort die Freiheit, wo sie der Verstand aus seiner Erfahrungswissenschaft heraus einengen will und den Menschen damit unfrei macht, indem er ihn an das bereits Erfahrene bindet. Im Walde erst – den Bildern des Gemütes entsprechend – gibt es eine Atmosphäre der Anteil nehmenden Liebe und ihrer Hoffnung, die mich umgibt, ja durchdringt, und in welcher ich mich zuhause fühle, eben weil sie mich völlig umgibt, und mir nicht bloss zur Unterlage dient. Nur eben – – ertrage ich seine Tiefe in der äussern Natur noch immer nicht, solange meine Anteilnahme nicht ausschliesslich im Guten stattfindet; so sicher und heimisch ich mich in meiner Jugend darin auch gefühlt habe. Und weil wir beide den Saum dieses äusserlichen symbolischen Bildes eines Seelenterritoriums abgeschritten hatten, so wurde mir wohl dabei und Dankbarkeit erfüllte mich. Ich hoffe, Sie haben es gefühlt und haben sich ebenfalls erfreuen können." – Natürlich konnte ich ihm das bestätigen, und zwar gerne, denn es floss ein solcher Reichtum aus seinem kleinen Spaziergangerlebnis, dass ich richtig schon mit dem Gedanken gespielt hatte, ihn öfters ins Freie zu begleiten. Er musste irgendwie noch ganz unbeschadet seine Depressionen überstehen können, dachte ich und deutete ihm das auch an; was er nicht nur bestätigen konnte, sondern durch die Feststellung überhöhte, dass er im Gegenteil unendlich viel an Tiefe und Fülle gewonnen habe. Zwar habe er auch in seiner Kindheit diese Fülle gekannt, aber nicht in solcher Hingegebenheit an die höhere Kraft Gottes in ihm. Und darum hatte es ihn in seiner Jugend auch immer wieder gejuckt, aus dieser Fülle sich das eine oder andere heraus zu nehmen, bis er sich einmal zuviel genommen habe. Nun aber könne er es bescheiden und dankbar Gott überlassen und seine Ordnung in seiner Seele und seinem Körper akzeptieren. Wohl sehne er sich zuweilen danach – wie ein gesundes Kind zu seinem Vater – ein Verhältnis zu Gott zu haben, den er ja bisweilen auch seinen Vater nannte. Denn ein gesundes Kind, das seinen Vater liebe, gehe in des Vaters Spuren und auf des Vaters Wegen und werde von seinem Vater ebenfalls geführt, ohne dass es gleich getragen werden müsse, wie das bei einem kranken oder schwachen Kinde nötig werde, das durch seine Schwäche des Vaters Kraft ungleich mehr beanspruche als ein Gesundes. Aber sein Trost sei es, aus Erfahrung zu wissen, dass Väter ihre zu sehr nach aussen orientierten Kinder oftmals noch gerne herumtrügen, wenn sie durch einen durch ihre Eigenwilligkeit verursachten Unfall zeitweilig gelähmt wurden, und dass es wohl oft gut zu spüren sei, dass das dabei oft noch viel innigere Verhältnis zwischen beiden den Vater nicht etwa belaste, sondern im Gegenteil erfreue. Wie unendlich tief Depressive empfinden können, das erlebte ich an dem, was mir dieser Mann sagte. Aber es wurde mir daneben auch klar, dass die Tiefe und der Reichtum dieser Empfindungen, die durchaus nicht alle angenehm waren, dass diese Tiefe auch nur von Menschen erfasst oder gar genutzt, aber auch ertragen werden können, welche die Ordnung der äussern Verhältnisse auf einen gütigen und sorgenden Vater zurück führen können. Was hätte die Schwäche oder die nicht mehr ganze Zurechnungsfähigkeit seiner innern Kraft diesem Menschen doch schaden können – durch das darin bedingte Unvermögen in vielen Dingen alleine schon, aber auch durch die dabei erlebte innere Ausgrenzung vom "Normalen" anderseits –, wenn er sich nach der Evolutionstheorie nur als eine Mutation eines blinden Zufalls verstanden hätte. Nein, dieser schöpfte offenbar aus der rechten Quelle und darum auch aus der Fülle, wenngleich er damit das Leibliche seines Wesens bis jetzt noch nicht wieder ganz zu machen vermocht hatte. Es wurde mir bei diesem Gespräch und den mir dabei gekommenen Gedanken und Einsichten stets noch klarer, dass ich mich weiterhin gerne und auch stets etwas intensiver mit ihm unterhalten werde und ihn insbesondere noch auf manchem Spaziergang begleiten wollte. Der Mann, der nach seiner eigenen Aussage schon mindestens zehn Jahre lang nie mehr ins Freie spazieren gegangen war – er machte wunderschöne Zeichnungen und Radierungen, welche seine Frau jeweils in entsprechenden Geschäften aber auch privat verkaufte – hatte sich mit bloss sechs bis acht Spaziergängen in meiner Begleitung innerhalb eines Sommerhalbjahres so schnell an das Gehen, auch bergauf, gewöhnt, dass er ohne weitere Übung schon bei seinem vierten oder fünften Spaziergang ein Schritttempo entwickelte, dem ich zwar gerade noch gut folgen konnte, das aber ein Gespräch kaum mehr zuliess. Dabei dauerten solche Spaziergänge oder kleine Wanderungen schon über zwei Stunden, ohne dass er dabei müde geworden wäre. Die einzige Sorge war ihm immer nur, nicht allzu weit zu gehen, da er immer noch befürchtete, dass er sonst nicht mehr zurückkehren könnte, wenn er einmal zu stark tangiert würde. Wenn wir einen neuen Weg gingen, den er noch nicht kannte, und er merkte, dass ich mich über seine Länge getäuscht habe, so wurde er sehr gespannt und schien manches Mal auch wie abwesend, während er sonst, für mich fast spürbar, alles unendlich tief in sich hinein empfand, was er sah. Beim jeweils ersten Aufstieg musste er manchmal ungewöhnlich tief atmen; dann verkürzte er auch seine Schritte, die er aber immer im gleichen Takt tat. Nach einigen Minuten war diese Phase jeweils vorbei und er konnte bergauf und bergab so schnell und zügig gehen wie in der Ebene. Immer erschien er mir sehr beschäftigt, ähnlich einem Kinde, das sich intensiv mit einer neuen Sache auseinandersetzt. Das war gut spürbar und für mich äusserst köstlich zu empfinden. Eine solch innige innere Tätigkeit mit solcher Konzentration hatte ich bis dahin überhaupt noch nie erlebt. Das könnte ich zwar alleine aus dem Gefühl heraus bezeugen; aber ich hatte auch genügend Gelegenheit, das von mir Wahrgenommene bestätigt zu erhalten. Denn oftmals erzählte er mir nach Tagen Dinge, Vorkommnisse und daraus resultierende Überlegungen, die er auf einem genau beschriebenen Wegstück wahrgenommen hatte, dessen Durchschreiten kaum eine Minute gedauert haben konnte. Wenn ihn etwas plötzlich oder zu heftig bewegte, dann sprach er auch einige kurze Worte im Walde selbst. Aber die Worte waren so gewählt, dass ich nachher oft noch fünf bis zehn Minuten lang daraus resultierende Verhältnisse und weitere Folgerungen erkennen konnte, die er zwar nicht direkt erwähnte, aber wohl so eingesehen haben musste. Denn das eine oder andere Mal habe ich ihn über eine solche (eigene) Folgerung befragte die ich aus seinen wenigen Worten schloss, worauf er mir noch viele weitere Folgerungen angab, bis er wieder auf die ersten Verhältnisangaben zurück kam. Auch bemerkte ich, dass er alle Bäume und Sträucher kannte und sich je nachdem verwundernd über eine untypische Gestalt eines Gewächses äussern konnte. Als ich ihm das einmal in seiner Wohnung erwähnte, in welcher ich mich stets öfters aufhielt, und ihn fragte, wie er bei seinem Schritttempo sich so genaue Naturkenntnisse aneignen konnte, da erzählte er mir, dass er früher – als Kind, als Jüngling und auch noch als junger Erwachsener – oft und gerne in den Wald ging, und dass er damals nicht so schnell gegangen war, sondern eher umgekehrt, bei jedem Baum, bei allen neuartigen oder auch nur schön gruppierten Waldstauden stehen geblieben war und sich jeweilen kaum mehr davon trennen konnte. Eine schöne Blüte beispielsweise musste er berühren, wenn sich ihr Liebreiz auf ihn bei längerer Betrachtung zu sehr gesteigert hatte. Stämme schöner Bäume musste er berühren und konnte sich dabei oft nur schwer von ihnen trennen. Alles nahm er ganz und gar in sich auf. Aber nach solchen Spaziergängen sei er jeweilen sehr "auf den Hund gekommen"; oft habe er zwei bis drei Tage gebraucht, um sich von ihnen zu erholen. Es sei ihm der Grund dafür nie so recht klar geworden, obwohl er in denselben Jahren auch ein gegenteiliges Erlebnisgebiet kannte. Es war die Eisenbahn. Wenn er mit ihr fuhr, so erzählte er mir, so begann er sich richtig in sie zu verlieben. Zum einen liebte er die starke und unermüdliche Lokomotive, die so bescheiden wie die ihr angehängten Wagen sowohl in der Grösse, wie auch in ihrem Äussern war – einfach, dass sie noch einen Stromabnehmerbügel hatte. Dann empfand er aber auch liebend die zuchtvolle, ordentliche Nachfolge aller Wagen hinter ihr. Natürlich wusste er, dass das nur eine Folge der ehernen Schienen war, aber dennoch bewirkte diese Nachfolge in ihm den Eindruck von Einordnung und Bescheidenheit. Auch die etwas raue und matte graugrüne Farbe und die gerundeten, gefälligen Formen der lang gestreckten Wagen, wie der Lokomotive, verstärkten in ihm den Eindruck der Bescheidenheit. Aber im Innern waren, dieselben Wagen hell und freundlich ausgestattet. Ein richtiges Symbol für einen wahrhaftigen Menschen – so kam es ihm vor: Zuvorderst eine kraftvoll willensstarke Lokomotive mit einem starken Liebezug in die Natur hinaus, hinter ihr in demütiger Bescheidenheit die vielen Wagen, gleich freundlich aufnahmebereiten Kammern des seelischen Menschenherzens mit einfachen, schlichten Worten für schwächliche Menschen, die ohne solchen innern Zug wohl nie oder viel zu spät an ihr Ziel und damit zur Seligkeit gelangen würden. Und in den steilsten Fels-massiven ein untrüglich und klar vorgegebener Weg zum sichern Ziel. Und wenn er jeweils aus dem Fenster sah, was er gerne tat, wie er lachend sagte und dabei einen abzweigenden Schienenstrang, erblickte, so empfand er eine helle Freude, wenn er am unregelmässigen Ton des Fahrgeräusches der Räder spürte, wie jeder einzelne Wagen über die Weiche fuhr. Er empfand dabei die abzweigende Strecke wie eine lockende Versuchung, der die starke und zielstrebige Lokomotive ohne ein leisestes Zögern widerstand und spürte, wie jeder einzelne Wagen oder sinnbildlich: jeder einzelne Wunsch des menschlichen Herzens folgsam sich einordnete hinter den Hauptzug seiner Liebe – zum fernen Ziele der Vollendung hin. So wollte auch er durchs Leben gehen können, denn er erkannte die göttlichen Gebote als den wahren Schienenstrang, als den vorgegebenen Weg in eine harmonisch beseligende Gemüts-Seelenlandschaft. Wenn er sich dann aber einmal satt gefühlt hatte am wunder-schönen Prinzip dieser Eisenbahn, oder sich schon auf einer Bergstrecke befand, dann war er ganz Aug' für die vielen schönen Gegenden, die ihr Gesicht in kurvenreichen Strecken stets wechselten. Wonnevoll empfand er es zum Beispiel, wie er mir mit auch heute noch leuchtendem Blick erzählte, wie sich der Zug entlang einer Bergflanke dahinbewegte, unablässig und gleichmässig schnell, auch gleichmässig an Höhe gewinnend, bis er dann, um eine Bergnase biegend, in eine ganz andere Landschaft kam, wo vielleicht eine kleine Weide oder ein bewaldeter Felskegel das Bahntrasse vom Abhang trennte, oder der Weg durch eine enge Schlucht führte, die nur durch einen Tunnel oder über eine Brücke verlassen werden konnte. Dabei sah er herrliche Pflanzen den schroffen Fels begrünen, empfand das Blau einer Gruppe Glockenblumen wie ein Spiegelbild des freundlichen Himmels über ihm, sah alte bestandene Tannen als treue Streckenwärter oder -wächter und das munter bezweigte Gesträuch am bergwärts steigenden Fels wie das Getolle übermütiger Jungtiere. Sah vom Wetter zerschundene Baumveteranen, unter welchen Jungbäume sich sammelten, um gleichsam die Mitgenommenen zu unterstützen. Überall hätte er stundenlang verweilen mögen, den geknickten Baumriesen mitfühlend berühren mögen, mit dem Gezweige der Kleinbüsche spielen mögend, das Wasser des muntern Bergbaches auf seine Frische prüfen wollend, die Glockenblumen liebkosend umfassen könnend. Aber nirgends hielt der Zug; überall blieb er – eingedenk des fernen Zieles – in gleichmässiger Fahrt, nichts konnte seine Absicht ändern. Wohl glitt er geschmeidig über die kleine, beblumte Bergwiese, umfuhr rücksichtsvoll einen baumbestandenen Schuttkegel, fuhr mutig über die kühn erbauten, hohen Brücken und scheute sich auch vor dem Dunkel des Tunnels nicht; aber nie liess er das Ziel ausser acht und ebenso wenig seine ihm bis dorthin gesetzte Zeit. Das also war ein völlig gegenteiliges Erleben zu seinen damals so saumselig ausgeführten Spaziergängen. Beides gefiel ihm ausserordentlich. Fast noch tiefer empfand er beim Spazieren, aber viel andächtiger und erhebender empfand er beim Fahren mit der Bahn, besonders in der Bergwelt. Nach Bahnfahrten hatte er oft tagelang ein Glücksgefühl und spürte eine Kraft in sich. Nach den Spaziergängen empfand er jedoch, wie erwähnt, eher Kraftlosigkeit, oft auch eine Gedrücktheit der Stimmung, so wie einer empfindet, der vor Unausweichlichem steht. Nie wusste er, was ihm von den beiden Erlebnisarten lieber war. Und auch nie verstand er, weshalb ihn die von allen so gerühmte Natur nicht stärken, sondern nur schwächen konnte. Die technische Errungenschaft der Bahn hingegen konnte ihn erheitern und stärken, ohne dass er sonst das Geringste für Technik übrig gehabt hätte. Bei dieser Frage angelangt, schwieg er einen Moment und sah mich sehr bedeutungsvoll an, ehe er in seiner Rede weiterfuhr und mir sagte, dass er erst nun, 30 Jahre danach zu erkennen beginne, wo der Unterschied lag, und dass er mir auch erst jetzt klar angeben könne, weshalb er bei den gegenwärtigen Spaziergängen so schnell gehen müsse. Wohl habe er schon öfters darüber nachgedacht, wieso er so schnell gehen wolle, und er habe das bald einmal gespürt, dass ihn das auf irgendeine, ihm bisher noch nicht bekannte Weise beselige, sodass er fast danach süchtig werden könne. Aber nun erst erkenne er den gleichnishaften Inhalt der Begebenheiten: Der Mensch müsse sich aus seinen leiblichen Verstricktheiten herausarbeiten, sodass die Seele frei und freier würde und in ihrer Freiheit sich ganz der freien und lichtvollen Höhe des Geistes zuwenden könne. Wenn er aber nun vor jeder schönen, materiellen Form stehen bleibe und diese Form zu lieben beginne, wie könne er dann sich von ihr trennen?! Jede Form, so schön sie auch sei, sei nur der Ausdruck der Liebe ihres Schöpfers. Und unser Ziel sei es, mit dem Schöpfer einmal eins zu werden, und nicht mit seinen Werken. Denn auch wir Menschen sind Werke des Schöpfers! Bleiben wir blosse, schwache Menschen, so bleiben wir auch blosse Werke. Aber in uns Menschen wohnt ein lebendiger Geist, und diesen müssen wir stärken, weil er uns in die Sphäre des Schöpfers führt, der sodann als unser Vater in und durch uns all sein weiteres Schaffen gestalten kann. Wie wäre das aber möglich, wenn wir bei irgendeinem einzelnen Werke stehen blieben, sei es bei uns selbst – wie alle Egoisten, aber auch alle Selbstmitleidigen – oder sei es bei Pflanzen oder Tieren oder gar bei einzelnen Menschen. Alle haben eine Bestimmung: einmal zurück zu kehren in die volle Geistesfreiheit der Liebe unseres Schöpfers, ob einzeln oder miteinander vereint, das sei gleich, aber nie dürfe ein Sich-Vereinen unter den Formen selbst uns vom Ziele abwendig machen, weder der Blickrichtung nach, noch der fortschreitenden Bewegung nach. Das alles wisse er zwar schon lange, aber es sei ihm nie in den Sinn gekommen, das Erkannte auch auf diese seine beiden Erlebnisarten anzuwenden. Ihn hätte bis jetzt gestört, dass die Technik ihm wohler getan hat als die Natur. Nun aber sehe er beides klarer: Die Natur ist nicht unser Ziel, sondern unsere Ausgangslage, und "im Natürlichen zunehmen" sei nur Aufgabe der Kinder, damit sie einmal zur vollendeten Ausgangslage kämen. Danach aber muss die Form der Natur und mit ihr die Naturform selbst überwunden werden, welche Überwindung eben darum notwendig werde, um den Geist zu stärken. Diese Überwindung der Natur sei aber eher eine Überwindung der Naturkraft in uns. Denn sonst wäre ja die heutige Zivilisation mit ihren seelen- und gemütslosen Menschen der Endpunkt. In Tat und Wahrheit müssen wir aber der äussern Ordnung der Natur gemäss handeln, aber nicht wie die Tiere aus innerem, natürlich-stummem Triebe, sondern aus der Erkenntnis, dass die vorgegebene Ordnung für den individuellen Fortschritt aller eine richtige ist. Also nicht aus genusssüchtiger Eigenliebe, sondern aus Liebe zum Plane Gottes zum Wohle aller. Wir müssen alles tun, was erforderlich ist, aber nicht festhalten an Vorläufigem. Dass aber die Materie nur vorläufig ist, beweist ihre Wandelbarkeit. Wer das Essen seines Wohlgeschmackes wegen im Munde behielte, der käme nie zu der lebensnotwendigen Verdauung. Wer esse aus Lust am guten Geschmack, anstatt aus der Notwendigkeit der Sättigung, der bleibe im Natürlichen, richte sein Augenmerk zurück, anstatt nach vorn. Dasjenige, was ihn beim Bahnerlebnis so stärkte, war also nicht die Technik, wie er damals meinte, sondern die mit der Technik dargestellte richtige Vorgehensweise. Das komme ihm erst jetzt. Denn bei den Spaziergängen sei ihm das schon aufgefallen, dass er jeweils zu Beginn sich weidete an den Schönheiten der Bilder und an den Tiefen ihrer Aussagekraft. Aber dabei erleide er dann starke Stimmungsschwankungen, sodass ihm das Gehen dadurch oft erschwert würde. Dann aber denke und konzentriere er sich jeweils eher auf das Gehen selber, indem er denke, dass ein so alter Mann doch anständig gleichmässig gehen können müsste. Dieses Unvermögen aber belaste ihn zusätzlich, sodass er sich wirklich mit der Technik des Gehens beschäftigen müsse. Dabei spüre er, dass der Atem, wenn er tief geholt wird, seine ganzen Eingeweide in Bewegung setze, die durch ihre Arbeit ihrerseits die Regelmässigkeit des Ganges wieder stören können, wenn sich zum Beispiel Wind im Magen oder auch in den Gedärmen entwickle, was zeitweise die Atmung beeinträchtige und durch diese dann auch die Regelmässigkeit des Ganges. Und dass er dann herausgefunden habe, dass es besser sei, die Regelmässigkeit beizubehalten anstatt das Tempo, sodass er dann jeweils bei den Schwierigkeiten, die sich aus dem Atmen und Gehen ergeben haben, weniger Atem geschöpft und kürzere Schritte getan habe, aber dafür in gleichmässigem Takt. Und damit beginne er der Einheit einer harmonischen Zusammenarbeit zu dienen und käme damit zum Dienen überhaupt, anstatt zum Schwelgen in den äussern Bildern. Und dieses Dienen ziehe sich dann wie ein roter Faden mitten durch die schönsten Landschaften, die ihn deshalb aber nicht weniger erfreuen müssen, die ihn dadurch lediglich weniger aus dem innern Gleichgewicht zu bringen imstande seien. "Und so gesehen bin ich dann in mir selber die Verkörperung des Gleichnisinhaltes der Bahn. Auch merke ich, dass ich mit zunehmender Länge des Spazierganges – und damit bei längerer Konzentration auf das Dienen an meinem "inneren System" – in weniger starkem Masse neue Eindrücke von eher gleichgültiger Natur in mich aufnehme, dafür aber die erhöhteren besser und schneller verarbeite, das heisst: ihre innere Aussage zu verstehen und begreifen beginne. Und dazu gehört dann auch z.B. die Erkenntnis, dass die von mir so hoch geschätzte und bewunderte Lokomotive, die mir so herrliche Erlebnisse eröffnete, auch in mir wirksam ist; und dass es nicht Herz oder Muskeln waren, die mir in der Jugend fehlten, sondern die ordnende Koordination und die Unterstellung meines Ichs unter den Dienst anstatt unter die selbstsüchtige Bereicherung. Es fliesst mir ja dennoch alles zu, aber nur in der der ordnenden Schnelligkeit möglichen Zeitdauer und damit weniger lang und mich damit auch weniger aufhaltend oder lähmend. – – Ja, so alt muss man werden, um das zu merken, was man eigentlich schon lange gewusst hat!" schloss er seine Rede mit einem herzlichen und zufriedenen Lachen. "Sie erzählen mir da so von der richtigen Ordnung und dem richtigen Ziel, das für Sie Gott ist, so als sei Ihnen das völlig klar und als könnten sie darin keinen Zweifel haben", bemerkte ich ihm, worauf er mir antwortete: "Wenn Sie einmal an einem Endpunkt der irdisch-leiblichen Laufbahn gestanden haben und spüren mussten, dass dort keine menschliche Kunst mehr etwas zuwege bringt, dann halten Sie sich schon von selbst an das Ihnen noch einzig Übrigbleibende, sofern Sie sich in Ihrer Jugend damit schon so weit abgegeben haben, dass Sie es wenigstens der Wahrscheinlichkeit nach kennen. Und das ist Gott!" Ich verwunderte mich, dass dieser Mann schon einmal so weit war. Er erzählte mir dann von seinen Erlebnissen mit Ärzten, die ihn nachweislich in zwei Fällen völlig falsch behandelt hatten, sodass er alles Vertrauen in sie verlor. Weiter schilderte er mir, wie er einmal selbst bei fliegendem Puls und anhaltender körperlicher Schwäche sich nicht entscheiden konnte, wieder in die unkompetente Hand eines Arztes sich zu begeben und wie er es dabei förmlich zu empfinden begann, dass er nach dem Ende seiner gezählt erschienenen Tage dennoch in Gottes Hand sich befinden werde. Warum also nicht jetzt? Er erzählte mir dann, wie er laut um Gottes Hilfe in Jesu Namen flehte, und wie sich sein Zustand jeweils immer erst ein bis zwei Minuten nach dem Beendigen des Rufens merklich gebessert hatte, sodass er bei dieser wirksamen "Medizin" blieb. Er erzählte mir auch, dass er viel später einmal sich wieder ertappte, wie er – wie die meisten Menschen – wieder über Gott sich Gedanken machte, so als wäre er nicht, oder bloss eine eventuelle Möglichkeit, und dass er dabei nicht sonderlich glücklich war. Da habe er sich gesagt, er wisse doch, dass es ihn gebe und dass und wie er helfe, warum also tue ich, als sei es ungewiss?! Wohl sei er ihm in dieser Zeit dann auch als ungewiss vorgekommen. Aber dann habe er ihn wieder ergriffen und mit aller Gewalt in sein Herz geschlossen, sagend: "Du musst es doch sein, ich brauche dich!" Daraufhin habe sich sein ganzes weiteres Leben wieder harmonisiert, ohne dass es vorher disharmonisch gewesen sei, aber geborgen fühlte er sich erst nach dieser Richtigstellung wieder. Das Geborgensein war immer wieder ein zentrales Thema bei ihm. Und es mutete mich oft merkwürdig an, wie sehr sich dieser Mann geborgen vorkommen konnte in der Schwachheit seiner Widerstandskraft den Weltanforderungen gegenüber. Ich hatte ihn deshalb mehrmals darüber angesprochen. Einmal sagte er, nur die kleinen, schwachen Kindlein könnten sich geborgen fühlen – in der Nähe ihrer Eltern. Der kühne, selbstsichere Mensch jedoch habe nicht ein Gefühl der Geborgenheit, eher ein Gefühl der Beherrschung und der Innehabung aller Möglichkeiten. Und die Schlafenden – damit bezeichnete er das Gros der Menschen, die einfach das von ihr in weltlicher Hinsicht Geforderte tun, jedoch ohne innere Anteilnahme, weder im positiven noch negativen Sinne; und die darum, weil sie als Folge davon keine Orientierung haben, die Zeit ihrer Musse bloss mit träumerischer Zerstreuung ausfüllen – diese Schlafenden also hätten gar nichts als die Kurzweil der Zerstreuung, bei welcher sie allem sie Zerstreuenden bloss nachsehen könnten und sich dabei dann selber verlieren würden. Deshalb seien für noch gefühlsschwache Menschen auch zumeist die Kinderjahre die schönsten, weil ja im noch leichter beeindruckbaren Kindesalter das Geborgenheitsgefühl, auch als ein Gemeinschaftsgefühl im Sinne eines Angehörigkeitsgefühls erlebt werde, allerdings ein Gemeinschaftsgefühl in der strengen Zucht einer ordentlichen Erziehung, welche erst eine wirkliche Entfaltung er-mögliche und durch diese dann auch das Gefühl tiefer Dankbarkeit. Das heute übliche Wir-Gefühl oder auch das Solidaritätsgefühl hingegen sei eher ein Gefühl der Selbstüberschätzung mit Hilfe Gleichgesinnter. Auf Grund dieser Sachlage sei doch ein Geborgenheitsgefühl nur einem Schwachen möglich. Je mehr er die Gefahren spürt oder teilweise gar sieht, desto mehr müsse er sich davon abwenden zu Gunsten eines Hinblicks in jene Richtung, von welcher ihm erfahrungsgemäss alle Hilfe kommt. Das sind bei Kindern die Eltern – und wie leicht bergen sie ihr Gesichtchen in die Hände des Vaters oder den Schoss der Mutter. Beim Erwachsenen, wie es sich bei ihm zeige, komme diese Hilfe von einem gütigen Vater im Himmel. Wenn wir auch manchmal die Wege unseres Vaters im Himmel nicht verstehen, so wie die Kinder so manche Anordnung der Eltern noch nicht begreifen können, so müssen wir dennoch auf Grund der Erfahrung nur trotzdem bei ihm alle Hilfe erwarten, woher sie denn auch bestimmt kommt, sofern wir nicht unser volles Vertrauen eher in Andere, z.B. in den Arzt, setzen. Wohl kann der himmlische Vater uns manchmal auch durch andere eine Hilfe angedeihen lassen, wenn wir im Glauben noch zu wenig gefestigt sind, aber dabei laufen wir dann auch Gefahr, ein nächstes Mal die Hilfe dort zu suchen, von wo sie letztes Mal hergekommen sei, und deshalb dürfe sie dann bei aufgeweckten Menschen auch nicht mehr von dorther kommen, damit sie dann leichter erkenneten, dass alle Hilfe wirklich nur bei Gott liege, wenn er uns auch hin und wieder einmal indirekt durch einen andern Menschen zu Hilfe komme. Oft brauchte ich mehrere Tage, um mir all der Aussagen dieses Mannes und ihrer Tragweite auch so recht bewusst zu werden. Und ich verspürte sogar – durch die manchmal mehrstündige innere Beschäftigung mit ihm bedingt – ein Gefühl wie von Licht, wie von Lichterwerden eines Nebels, dessen ich bis jetzt gar nie so recht gewahr geworden war, den ich vielmehr erst dadurch zu erkennen begann, dass er nun lichter ward. So zum Beispiel wurde mir erst Tage später bewusst, dass dieser Mann, der so viel von einem himmlischen Vater erwartet und augenscheinlich auch erhält, dass dieser Mensch dennoch dazu kommen konnte, Gott, seinen Vater, eher hypothetisch zu betrachten. Das aber zeigte mir eines deutlich: wie wenig dieser Mann religiös verstiegen war. Denn die Verstiegenen finden nicht so leicht zurück – das liegt ja eben am Wesen der Verstiegenheit. Dieser aber kommt unvermerkt wieder zur so genannten Normalität, und erst von dieser wieder zur Frage, wo Gott denn bleibt, und zum Wunsche, wieder dorthin zu kommen in seinem Wesen, wo ihm stets so wohl gewesen ist und ihm auch wieder wohler wird, wenn er nur dort verankert bleibt, wo er wirklich, weil äusserlich und innerlich geborgen ist. Als ich ihn einmal darauf angesprochen hatte, wusste er selber auch nicht so schnell eine Antwort. Aber er wies mich auf die Tatsache hin, die er mir ja schon verschiedentlich gezeigt hatte, dass er das Denken und Trachten der Menschen ständig in sich fühle und dass dieses stete Fühlen seine Widerstandkräfte gegen das ziellose Treiben der Welt ja auch immer wieder schwäche. Er müsse in solchen Fällen, die wohl in besseren Zeiten – leiblich gesehen – vorkommen, innerlich etwas eingenickt sein und würde dann als Folge davon einfach das klare Bild selbst erlebter Tatsachen etwas verlieren und damit die allgegenwärtige Ansicht der heutigen Menschen in sich wirksam werden lassen, die Gott höchstenfalls als Hypothese anerkennen. Aber schliesslich habe ihm Gott geholfen zu einer Zeit, da er noch nicht ein volles Vertrauen zu ihm hatte, sondern nur die Einsicht, dass es in der Welt nichts wirklich Reales, Bleibendes gäbe, und schon gar nicht eine wahrhaftige und wirksame Sicherheit und Kompetenz, sodass das für andere zwar noch unerprobte und nur hypothetisch Reale in seinem Gemüte mehr Gewicht erhalten habe als das zwar Erprobte, aber als unreal Erkannte – das blosse Gewäsch dieser Welt also, das bloss in informativer Gelehrsamkeit bestehe, die jedoch weitab eigener Erfahrung liege und darum – selbst dort, wo sie einmal zufällig richtig wäre – dem Informierten nicht dienen könne, weil er im Leben nicht mit ihr umzugehen gelernt habe, sodass er ihre Bedingungen nicht habe kennen lernen können. Zweifellos musste er die Realitäten verspüren, selbst wenn er sie nicht verstand! So war es ja bei der Eisenbahn: Er erkennt die Wahrheit in den Bildern durch sein Gefühl, ohne dass er sie vorerst versteht. Aber er anerkennt sie dennoch, und verwirft oder überdeckt sie nicht mit unreifen Gedankenkombinationen, wie es die meisten Menschen tun. So hat er 30 Jahre lang die Eisenbahn als das bessere Prinzip als seine Art, zu Wandern deutlich bejahend erkannt, so sehr er in seiner bisherigen Einsicht gegen die Eisenbahn – als Technik – war. Also hat er einen 30-jährigen innerlichen Streit auf sich genommen und ihm auch standgehalten, bis er im Gespräch mit mir die wirklich reale Lösung dieses Knotens fand, die im erahnten und gefühlten Prinzip des stetigen Dienstes an ein höheres Ziel lag (gleichmässiges, stetes Vorwärtsstreben im Geiste, ohne sinnlich genüssliche Unterbrechung), das er dann – noch unerkannt – auf unseren gemeinsamen Spaziergängen oder Wanderungen angewendet hatte. Und das anfänglich wohl nur darum, weil ihm die geschwächte innere Kraft es nicht mehr zuliess, sich so eingehend mit dem Einzelnen zu befassen, weil es ihn sonst zu verschlingen drohte, weshalb er beim ersten Spaziergang ja nicht in die Tiefe des Waldes vordringen wollte. Dieses innere Spüren der Realitäten und das Auf-sie-Achten und sie Geltenlassen, auch wenn sie scheinbar gegen alle Vernunft gerichtet waren, liess ihn mir als "innern Wissenschafter" erscheinen, der nur glaubt, was er verspürt, selbst dann, wenn er es nicht versteht; während die äussere Wissenschaft zwar vorgibt, nur zu glauben, was sie sieht, in Wirklichkeit aber nur sehen will, was sie begreift, und alles andere, noch so Reale, verwirft. Ist ein solcher Mensch nicht vor allem geborgen in der Sicherheit der echten und steten Wahrnehmung der Realitäten durch sein Gefühl? Realitäten, die sich bestimmt auch über dem Grabe einst als real erweisen, da es innere Realitäten sind, die er erfühlt. So erzählte er mir einmal, einige Tage nach einer längern Wanderung im Walde, bei welcher ich gut spüren konnte, dass ihm dieses Erlebnis sehr tief ging, wie er eine solche Wanderung empfinde. Diese Schilderung ist so umfassend und zugleich das ganze Gemüt erhebend schön, dass ich sie zum Schlusspunkt dieser Erzählung machen möchte. Er erzählte mir etwa folgendes: "Bei der Wanderung am letzten Sonntag ist mir wieder einmal eine volle Sicht der innern Dinge auf Grund der in mir aufgenommenen Bilder der äusseren Natur geworden, und in tiefster Geborgenheit nahm ich an all den Belehrungen durch die Formen der Natur teil, die mir durch den Herrn offenbart worden sind: Sehr früh des Morgens waren wir diesmal aufgebrochen, als die Sonne noch kaum über dem Horizont war. In diesem Zwielicht erscheinen die Dinge und Formen besonders eindrücklich, weil eine kleine Ungewissheit oder Unsicherheit in der Erkennung der einzelnen Dinge unsere innere Auseinandersetzung mit ihnen verstärkt. Die Kühle des Morgens lässt einen die eigene, noch ungelenke Verschlafenheit und Steifheit eher empfinden, sodass wir anlehnungsbedürftiger als sonst werden; sodass wir eine gewisse Geborgenheit vermissen. Diese musste ich in mir selber suchen und darum in meinem Herzen, wo ich schon so vieles mit meinem himmlischen Vater besprochen hatte, auf ihn warten, immerzu fragend: woher kommst du, Vater? Diesmal kam er auf einem mir bekannten Wege, dem Wege meiner innern Unruhe, in welcher ich wieder zur Gewissheit komme, dass er mir beistehen wird. Ich musste diesmal beim Aufstieg besonders tief atmen, sodass ich beinahe das Gefühl hatte, es würde mich der Druck der eingeatmeten Luft zersprengen. Ich verkürzte meine Schritte, sodass auch der Atem ein bisschen weniger tief geholt werden musste. Aber bald empfand ich einen unangenehmen Druck im untern Bauch und ein Unwohlsein im Kopfe. In solchen Momenten bin ich zur tiefen Aufnahme äusserer Bilder besonders disponiert, sodass zum Beispiel der leichte Lichtschein des heller werdenden Himmels über dem Geäst mir schon ein tiefes Dankgefühl entlocken konnte ob dem leisen Versprechen der sich nahenden Hilfe – wie mir dieses Bild den Eindruck vermittelte. Wohl war das Bild ein Bild der Natur, aber dass ich in meiner innern Not darauf aufmerksam geworden bin und dessen Sinn verstand, das war nicht Natur, sondern leiser Trost meines Vaters. Jede Wegbiegung, die mir ein etwas anderes Bild des Waldes vermittelte, war mit einer der geringen Zustandsänderung in meinem Leibe zu vergleichen und belehrte mich, dass ich auf diesem Wege der innern Hingabe wohl noch manches erfahren müsse und werde; dass mir aber eben diese steten Veränderungen zeigten, dass nichts, auch noch so Beengendes, fortwährte, sondern bald einem Nächsten weichen musste. Der feste Takt des Schrittes und das leichte, aber ruhige Pochen meines Herzens halfen mir verspüren, dass nur das stete, ruhige Vertrauen vorwärts führe. Und da spürte ich wieder seine Nähe. Wer anders gab denn meinen Füssen in dieser Situation den festen, vertrauensvollen Tritt, meinem Herzen die Kraft, nur ihm entgegenzuschlagen, nicht der noch so schönen Natur – nur ihm alleine, der sie gemacht hat, mir zur Belehrung und zur Freude. Den geraden Stamm eines mächtigen Baumes, dessen Geradheit fast etwas Hartes in sich schloss, empfand ich wie meinen Weg: Unbeirrt hin zum Ziel, dem Liebelichte meines Vaters. Erst dort wird mein Gemüt sich erheitern und sich ausbreiten wie die Äste und Zweige der Krone dieses kräftigen Baumes. Unter solch intensiver Beschäftigung mit meiner innern Natur, unter der Zuhilfenahme der Bilder der äussern Natur, kam ich allmählich in eine stete innere Bewegung, die mein Gemüt erwärmte und erhellte und offen machte für das Einfliessen der Worte des Herrn durch die Bilder der Natur, und ich befand mich beim Weitergehen wie in einem ständigen Gespräch mit ihm und erkannte immer besser und leichter und auch mit stets grösserer Entzückung, Verwunderung und Dankbarkeit den Willen, das Wesen und die Art unseres Vaters, uns Menschen Hilfe zukommen zu lassen. Eine Wärme der Geborgenheit verbreitete sich in meinem Gemüt und zuversichtliche Ruhe durchströmte mich nebst der grossen Hoffnung, an der Seite meines himmlischen Vaters gehend, noch reiche Erfahrungserkenntnisse zu gewinnen. So tief war ich in mir beschäftigt, dass ich beinahe wie erwachte, als sich plötzlich der Baumbestand etwas zu lichten begann und nach den letzten grossen Stämmen eine Wegbiegung mich ein völlig anderes Bild der Natur erschauen liess. Es war der steile Abbruch einer Felswand, die nun aber durch den gut und reichlich gebahnten Weg leicht zu durchschreiten war. So mächtig wirkte diese plötzliche Freie auf mein Gemüt ein, dass ich entgegen meiner Gewohnheit da stehen bleiben musste. Überwältigend empfand ich sowohl die Freiheit und Losgelöstheit von der übrigen Welt, als auch die mächtige Tiefe unter mir, welche die Spitzen auch der höchsten Bäume noch lange nicht meinen nunmaligen Standpunkterreichen liess. Aber auch die absolute Kahlheit der felsigen Wand überwältigte mich, indem sie mir die Kraft und die Wucht dieser Kräfte im Stein so tief fühlen liess, dass ich nicht wusste, sie bewundern, oder davor erschauern zu müssen. Lange Zeit stand ich wie von einem grossen Ereignis getroffen da, noch in der traulichen Nähe meines Vaters zwar, aber immerhin schien er wie hinter mir zu stehen, damit ich voll dem mächtigen Eindruck ausgesetzt bliebe. Zwei Dinge waren es, die mein Gefühl am meisten mit Fragen bestürmten: Die grosse Höhe und – der grosse Abstand zur Welt. Bei der grossen Höhe, die mir unglaublich erschien angesichts des so erfüllten und dadurch kurzweiligen Aufstiegs, begann ich zu empfinden, dass es wohl des Vaters Wunsch sein musste, dass ich diese scheinbare Unglaublichkeit besser begreife: Es ist nämlich eine grosse Höhe nur von aussen gesehen hoch. Von innen her betrachtet jedoch nicht. So kann zum Beispiel einer im obersten Stockwerk eines hohen Hauses wohnen und sich daselbst in allem Guten und Nützlichen betätigen, ohne dass er je der Höhe gewahr wird, die er ja vorher im geschützten, inwendigen Treppenhaus hat erklimmen müssen. Erst, wenn er das Fenster öffnet und hinaus schaut, oder gar hinab schaut, wird er seiner Höhe so recht gewahr. Aber selbstverständlich auch einer, der unten – also ausserhalb des Hauses – steht, und hinauf schaut. – Oder es kann einer innerhalb irgendeines Faches in seiner Erkenntnis laufend zunehmen und so eine kleine Stufe um die andere erklimmen. Von Stufe zu Stufe sind es nur ganz geringe Höhenzuwachse. Trifft er dann aber unverhofft einmal auf einen Laien oder einen Anfänger in diesem Fache, so beginnt er den Höhenabstand plötzlich drastisch zu verspüren. Denn die ihm allergeläufigsten Überlegungen, Ausdrücke und Grössen sind dem andern völlig unverständlich und unerreichbar – so gross ist die Höhenferne schon geworden. Wer also still und bescheiden für sich bemüht ist, sein Ziel zu erreichen, der wird in kurzer Zeit schon eine beträchtliche Strecke zurücklegen. Wer hingegen die andern stets mitziehen will, der beginnt durch den Widerstand der andern zu verspüren, wie sehr er sich immer mehr von ihnen entfernt. Und der beginnt die Erklimmung einer Höhe als äusserst beschwerlich und mühsam zu empfinden, und die Höhe selbst dann als eine wahre Errungenschaft, auf die er sich manches zugute hält. Darum ist es besser, als Schwächling in der Welt tätig zu sein und in seiner Schwachheit mit der inwendigen Hilfe des Herrn weiterzukommen. Denn das ist der Sinn des Bibelwortes, dass der Herr in den Schwachen mächtig sei. Seine Macht kann nur vom Schwachen angerufen werden. Die Starken haben schon selber eine eigene Macht. Sie ist zwar wohl auch von Gott, denn woher sonst hätte der Mensch sein Leben? Aber sie ist ihm mit seiner Natur zu eigen gegeben auf so lange, als er sich damit nicht überhebt. Wer aber in seiner Schwäche mit der Kraft des Herrn über die steilsten Höhen getragen wird, der überhebt sich nicht so schnell. Wohl stand ich nun ebenfalls selber und mit meiner ganzen Schwachheit auf dem Wege mitten durch diese schreckliche Wand äusserer Höhe, und ich konnte im Hinblick auf die ferne Welt auch des Gefühls gewahr werden, über ihr zu stehen. Aber angesichts des so vertrauten Aufstieges mit dem Herrn gab mir dieser Anblick kein berauschendes Gefühl, sondern ein erleichtertes bloss, darum dass ich die Ebene der bloss materiellen Betrachtungsweise der Welt endlich verlassen hatte mit Hilfe der vom Herrn mir verordneten Schwäche, um mit seiner weitern Hilfe diese dann an seiner geistigen Hand noch völlig zu über-winden. Darum auch liess er mich nicht nur einen Blick abwärts tun, sondern auch aufwärts, die ebenso kahle wie steile Wand entlang, die zu überwinden meine fernere Aufgabe war. Denn die eigene Materialität oder Natürlichkeit ist es, die dem Menschen im Wege steht zu seinem Ziel, dem Himmel; und doch kommt er nur entlang eben dieser Natürlichkeit in seine Nähe. Das begann ich ebenso zu begreifen, wie der Umstand, dass diese Stelle jener in meinem Leben entsprach, an welcher ich mich – auf dem Wege zum Ziel – schon einmal befunden hatte, wo ich mich aber von der äussern Betrachtung meiner Höhe überwältigen liess, sodass ich mit dem Übergewicht dieser selbstbewussten materiellen Masse meine eigene Natur zerriss, wie der ehemals wohl überhängende Fels durch seinen Überhang zur Welt die Natur seines Steingefüges zerrissen haben musste, als er zu Tale stürzte. Wie gut, war ich diesmal in meiner Schwäche an der Hand meines gütigen Vaters im Himmel geführt worden! Dieses Erlebnis war wie eine Generalpredigt für mich, und in grosser Dankbarkeit konnte ich mich danach wieder zum Gehen wenden. Wieder wurde mir so wohl und traulich im mich umhüllenden Walde. Und dieses Traute war so beruhigend, so angenehm, dass ich fast wie in einen Schlaf zu versinken begann, während welchem ich rein mechanisch einen Fuss vor den andern setzte. Aber dieser Umstand wollte mir auch wieder nicht gefallen. Kam ich mir doch wie ein Kleinkarierter vor, der, unbekümmert aller Welt, seiner eigenen Lustbarkeit frönte. So hatte ich den vorherigen Aufstieg ja gar nicht verstanden! Irgendwie empfand ich nun, dass auch die Wucht der äussern Ereignisse oder Tatsachen – wie der vorigen Felswand – in mir eine Schwäche erzeugen konnte: die Schwäche der erneuten Hingabe an die blosse Sinnlichkeit, anstatt an die darin verborgenen Worte des Vaters; und dass es auch in dieser Schwäche nur der Aufblick zu meinem Vater sein kann, der mir hilft, sie zu überwinden. Immerhin erkannte ich nun, bei diesen Gedanken, in jenem dramatischen Bilde auch die Grösse und Stärke des Vaters darin, dass er solche mächtigen Berge entstehen liess, und dieser übergewaltige Eindruck liess mich wieder kleiner und seiner Hilfe bedürftiger erscheinen. Ich begann zu begreifen, dass der innere Aufgang zwar wohl unbeschwerlich sei, dass er aber auf dieser, im geistigen Teile mehrheitlich sehr flachen Welt zu grossen Konsequenzen – zum Beispiel zu innerer Sorglosigkeit – führe, die man ebenfalls kennen und verstehen müsse und deren Gefahren man auszuweichen lernen müsse. Also war ich im Verlaufe des weitern Weges mit dieser für mich völlig neuen Tatsache beschäftigt und ich begann meinen Vater im Himmel darum zu lieben, dass er mich – innerlich erkennend – im Natürlichen wieder an jene Stelle zurückgeführt hatte, an welcher ich in mir selbst einmal Schiffbruch erlitten hatte, damit ich auch diese Stelle noch in meinem irdischen Leben einmal – mit ihm zusammen – richtig passieren lernte. Wie ein dramatisches Werk meines Vaters kam mir das tief in mir sitzende Bild vor. Aber ein solches, im Grunde denn doch nicht einer gewissen Sinnlichkeit entbehrendes Bild sollten wir nur an der Hand unseres Vaters – also in der Hingegebenheit an ihn alleine – betrachten, wenn wir nicht früher oder später ein zweites Mal im Strudel des Sinnenrausches, und einer gewissen Selbstzufriedenheit aus ihm, fallen wollen; das spürte ich auch. Und dabei kam mir die fast sinnlich erfahrbare Tatsache, dass ich an der sichern Hand meines Vaters ging, wesentlich weniger kleinbürgerlich vor. Und in meinem Gemüt erwachte ich wieder zur vollen Kindlichkeit – zur Hingabe an ihn, statt an mein Glück. Dabei merkte ich, dass wir inzwischen auf eine sehr nördlich gelegene Seite des Berges kamen, wo das sonst frische Grün eher einem Bläulich- bis Gräulichgrün Platz machte, wo der Weg glitschig wurde und der Boden des Waldes Feuchtstellen aufwies. Kalt war es da! Mehr noch im Gemüte zu empfinden als auf der Haut, die von der innerlichen Tätigkeit der Organe beim Gehen erwärmt blieb. Ich spürte die flache Seichtheit dieser Situation. Die Leben zerstörende und den Pilz fördernde Feuchtigkeit, die überall zugegen war, aber mehr in der Luft zerstreut als gesammelt in der Tiefe eines Teiches; die vielmehr auch auf dem Boden nur Pfützen bildete der Flachheit der Topographie wegen; die überall wirkte, aber nirgends fördernd, sondern nur hemmend. Wie gut, gingen wir auch da mit der uns angewöhnten Stetigkeit des Trittes vorüber, mit welcher wir vorher schon so manche schöne Stelle passiert hatten, wo es uns eher zum Verweilen eingeladen hätte. Wie leicht dringt diese abweisende Kühle in unser Gemüt ein und bewirkt da eine Art Resignation, eine Art widerwillige Ergebung in die äussere Tatsache. Einziger Trost für mich blieb unser steter Schritt. Aber mit der Zeit fragte man sich wieder: Wozu der stete Schritt, wenn er nicht aus dieser lebenswidrigen Gegend führt? Ist er nur deshalb gut, dass man nicht wirklich ganz und gar diesem Zustande anheim fällt? – Da, auf einmal wurde ich einer paar von der Sonne beschienenen Baumwipfel gewahr, die sogar noch eher etwas unterhalb des Weges im nur leicht abfallenden Gelände standen, aber ihrer Grösse wegen dennoch etwas über die andern Baumkronen ragten. Wie ein Gruss meines himmlischen Vaters, wie eine äussere Aufmunterung zum Durchhalten kam mir dieses so köstliche Lichtzeichen in den Kronen der wenigen, hohen Bäumen vor. Mir wurde leichter. Ein einziges, wenn auch bloss in die Natur gezeichnetes Wort meines Vaters genügt, mich seiner wieder mehr zu erinnern und in seiner Nähe aus seiner überreichen, weil über-lichtvollen Sicht der Dinge das Geschehen um mich auch in der Tiefe meiner eigenen Seele zu begreifen: Diese, dem göttlichen Sonnenlichte stets abgekehrte Nordseite des Berges entspricht der Sinnlichkeit, die an den aus dem Licht und der Wärme hervor gegangenen Formen ein eigenes Behagen hat, welches sie aber eben vom Licht und der Wärme selber, die sie schufen, trennt. Diese Sinnlichkeit sucht die abgerundeten, geschliffenen Formen, die durch ihre, blosser Sinnlichkeit angepassten, Rundungen fast den ganzen Charakter und allen Inhalt verloren haben, so, wie sie uns in den üblichen Umgangsformen der Höflichkeit vieler Menschen begegnen oder uns entgegentreten: Überall eine Möglichkeit, sie zu brauchen und doch nirgends einen Ort, da sie Nutzen brächten. Wie schillernd reich, aber alle Wirklichkeit weit umgehend ist doch eine solche Höflichkeit! Wie dumm und wie schal ist es doch, mit einem andern vom Wetter zu sprechen, während im Innern beide Gesprächspartner tief liegende Probleme wälzen, die sie, vielleicht ihrer ähnlich gelagerten Natur wegen, zusammen so viel leichter lösen könnten als jeder für sich alleine. Wie seicht und formlos sind all die beschönigenden Begründungen zu einer Absage, die aber aus handfesten Interessen erfolgte. Wie nichts sagend ist das ebenmässig flach gestrichene Gesicht eines Menschen, hinter welchem ein eigenwillig schroffer oder selbstsüchtig habgieriger Charakter verborgen ist. Wie uninteressant die von allen so interessant herausgestrichenen Kleidungseigenheiten, die doch nur die Flachheit ihres innern Wesens verbergen sollen. Aber auch wirklich sinnliche Genüsse wie die pointierte Koch- und Servierkunst ist nur schaler, kalter Dunst gegenüber einer dankerfüllt eingenommenen Mahlzeit eines arbeitenden Menschen, dem der Hunger die rechte Würze ist und die Gewissheit, den andern mit seiner Arbeit auch wirklich nützlich gewesen zu sein, die wahre Süssigkeit seiner eingenommen Kost. Und die Verdauung fördernde Wärme in seinem Magen wird durch sein Dankgefühl bewirkt. Alle diese bloss der Sinnlichkeit dienenden Aussenformen sind also von einem tief innerlichen Grunde getrennt; sind eine fein servierte Speise, die weder Würze hat, noch nährt; die kalt lässt und die wahre innere Lebensentwicklung nur hindert. Das bleibt sich überall gleich! Wie seicht ist doch auch der Beischlafkitzel gegenüber der feurigen Liebefreude, einen gleich gesinnten Partner haben zu dürfen — und dem Vorsatz, ihn das auch auf alle nur erdenkliche Weise spüren zu lassen, weil auch dessen Sinn, zu helfen und zu nutzen, auf dieser Welt so kostbar selten ist, sodass wir uns sogar alle Mühe geben müssen, ihn in unserer Wertschätzung nicht über Gott zu erheben, der alleine in einem nie darstellbaren Mass alle unsere Liebe, Nutzbeflissenheit und Treue verdient. Das alles empfand ich, nachdem ich das lebendige und Leben spendende Licht der Morgensonne an den höchsten Baumkronen erblickt hatte, oder vielmehr: nachdem mein Blick – durch den Aufblick – dorthin geführt wurde. – Wie zäh, dauerhaft und unbeirrbar muss doch der Wachstumswille dieser Bäume sein, dass sie hier in so langer Zeit dennoch mit so geraden Stämmen so hoch und weit das Feld dieser Sinnlichkeit haben verlassen und überragen können, dachte ich, während ich in meiner Erinnerung andächtig einen Blick zurück zu ihnen tat. So stark war meine Liebe zu ihnen und zu ihrer Treue zu ihrem vorgegebenen Ziel, dass ich es mir wieder in Erinnerung rufen musste, dass sie nur Formen des Wirkens meines Vaters waren, damit meine Liebe zum Vater selbst nicht zu sehr durch die Liebe für sie zerteilt wurde. Da endlich sah ich auf der andern Seite des Weges, an einer steilen Bergseite, weit oben über dem Kamm des Hanges die ersten direkten Sonnenstrahlen in die Kronen und sogar schon an die Stämme der Bäume scheinen; einzelne Strahlen verloren sich sogar den Abhang hinunter bis zu mir hin in die Tiefe, sparsam kleine helle Flecken auf unserm gemeinsamen Wegstück bildend. Wie gerne wäre ich diesen golden leuchtenden Lichtstrahlen direkt gefolgt, um endlich zur vollen Höhe hin zu gelangen, so wie ich es in meiner Jugend stets zu tun gewillt war, wo ich damit aber oft nur Enttäuschungen erlebt hatte. Nein, diese Strahlen, an welchen ich inzwischen schon vorübergegangen war, waren nur ein direkter, an mich gerichteter Gruss, und nicht mehr ein von so ferne her kommender wie der Vorherige, der noch an die Natur eines Baumes geheftet war; damit ich mich, durch diese direkte Berührung erregt, wieder unmittelbarer mit meinem Vater verbinden sollte, anstatt mich zu sehr mit dem Bild der Natur zu beschäftigen, das mich denn doch immer wieder durch seine Eindrücklichkeit und Anmut ein wenig vom Vater selber abzuziehen fähig gewesen wäre. Nein, ich muss den mir vorgegebenen Weg gehen, und nicht eigenwillige Abkürzungen benützen, die meine Kraft bisher immer überstiegen hatten. Der gleichmässige Takt meiner Schritte und der ruhige Rhythmus meiner Atmung erinnerten mich daran, dass der Vater ja durch seine Ordnung in mir selber schon für mich tätig war und dass mir mit diesem Segen auch die Garantie gegeben ist, dass ich ihn einmal – in meinem ganzen Wesen voll entfaltet – in seinem Reiche finden werde. Da sich der Weg vom Norden gegen die Ostseite des Berges zog, so verlor sich die feuchtkalte Atmosphäre allmählich; und der steile Hang wurde auch etwas flacher, während die Sonne ja in stetem Steigen begriffen war, sodass hin und wieder einmal einer ihrer Strahlen die Wipfel der talseitig, stehenden Bäume zu berühren vermochte. Der Weg wurde an dieser Stelle auch etwas steiler, sodass die Erwärmung, die ich in mir zu verspüren begann, wohl zuvorderst von der körperlichen Anstrengung resultierte und erst in zweiter Linie vom erhöhten Druck der Erwartung der vollen Lichtseite des Berges. Aber mit der Zeit und der dabei erreichten weitern Höhe kam dann einmal der Punkt, wo das Licht derart zunahm und durch alle Zweige sich zu drängen begann, dass es leicht zu erraten war, dass hinter der nächsten kleinen Biegung des Weges endlich auch die Sonne selber sichtbar werden wird. Golden glänzte das Laub und das Blau des vorher im leichten weissen Dunst verhüllt gewesenen Himmels strahlte durch die an dieser Stelle lichter gewordenen Zweige; und nach wenigen Minuten waren wir auf der voll beschienenen Seite des Berges angelangt, auf grösserer Höhe als vorher bei der Felswand. Weiter entrückt erschien da die übrige Welt, aber dafür weniger weit unten, denn die Sicht abwärts war durch einen mit nur kleinen Bäumen spärlich bewachsenen, kleinen Vorkamm etwas verdeckt. – Wie in einem von der Morgensonne beschienenen Kinderzimmer kam ich mir da vor. Die spärliche Vegetation des kleinen Vorkammes empfand ich wie die schützenden Vorhänge meines einstmaligen Kinderzimmers, welche die freie Sicht in die Welt etwas dämpften und sie damit gleichsam etwas verklärten, ohne dass sie der Lichtfülle des anbrechenden Tages auch nur den geringsten Eintrag gebracht hätten. Da erst übermannte mich die Freude über diesen gemüthaften Formen- und Farbenreichtum derart, dass ich ein zweites Mal Halt machte. Andächtig nahm ich alles in mich auf; so wie ein Kind, das soeben beschenkt worden ist. Wie gut, dass mich nur die Notwendigkeit des steten eigenen Gehens auf diesen Punkt gebracht hatte. Wie leicht wäre ein Fauler, der sich zu dieser schönen Stelle per Auto hätte hinfahren lassen, durch die Wärme der vom Sonnenschein erfüllten Luft in Ausgelassenheit geraten oder hätte die Wärme bloss faul zu geniessen begonnen und wäre so dem wahren, innern Ziele entfremdet worden. So aber, wie wir diesen Punkt erreicht hatten, fühlte ich nach Abnahme des Druckes meines Dankgefühls eine Liebeverpflichtung, den Weg durch weitere Tätigkeit fortzusetzen. Und wir kamen dann ja auch bald auf einem weit schmaleren Weg, einem sehr steilen Fusspfad bald wieder in den Wald und gingen jener Krete entlang, über welche ich vorhin, in der noch nördlich gelegenen Tiefe, den ersten direkten Lichtgruss erhalten hatte. Die Steilheit des Weges verlangsamte zwar unser Tempo, liess uns aber rasch an Höhe gewinnen, sodass wir bald die oberste Fläche des Berges erreichten, die mit lichtem Wald überzogen war, in welchem ein feines Gras den Boden begrünte, das unsere Tritte weich aufnahm. Alles war hier so licht und weich in Form und Konsistenz, dass ich froh war, die starken und verzweigten Wurzeln der Bäume, die hier sehr oberflächlich verliefen, hin und wieder unter meinen Füssen zu verspüren. Denn so licht das himmlische Reich auch sein mag, solange wir Menschen auf Erden weilen, müssen wir es auf dem harten Boden durch die Tätigkeit stetigen Vorwärtsschreitens vorzu neu erwerben, bis wir einmal alle harte Materialität in unserer Natur völlig überwunden haben. Darum auch können wir auf so herrlicher, aber doch nur irdisch natürlicher Höhe nicht für bleibend verweilen, sondern müssen heimkehren in unser Gemüt und uns zurückziehen in die stille Kammer unseres Herzens, wo alleine diese Bilder unverwüstlich fortleben können und wo alleine uns der Herr wahrhaft, weil vollends im Geiste, begegnet und unser Tun durch seinen Segen zu einer immer gediegener werdenden Welt werden lässt, in die wir einmal ausgeboren werden, wenn wir das Zeitliche verlassen dürfen." – – – Diese Schilderung war für mich, der ich diesen Mann begleitet hatte, die volle Enthüllung desjenigen, was ich an seiner Seite wohl sehr deutlich, aber nur von ungefähr verspürt und empfunden hatte. Und ich begann vollends zu begreifen, welch ungemein grosse Chance eine Depression sein kann für jene, die sich die Hilfe am rechten Orte holen. Wohl verspüren solche Menschen in der Welt oft nur die Hölle, aber in den Bildern der Natur und den Schöpfungen Gottes dafür auch den Himmel. Wohl haben sie auf der Erde nicht einmal soviel, wie völlig normale Menschen, nämlich die volle Verfügungsgewalt über ihr irdisches Wesen; aber sie haben in sich auch das Bild der Erfüllung und des Himmels, sofern sie ausharren im Vertrauen auf den, der beides – Irdisches und darin als Keim schon enthalten auch das Geistige, Himmlische – schuf. Und jene, die um sie sind, haben das grosse Glück, die Wahrhaftigkeit ihrer eigenen Empfindung und ihrer eigenen Wahrnehmung zu erfahren und das Wirken Gottes als das eines auf den Einzelnen eingehenden, gütigen und umsichtigen Vaters zu erkennen. 6. 1. 1998
Aus der Reihe: "Wenn wir christlich leben würden" |
