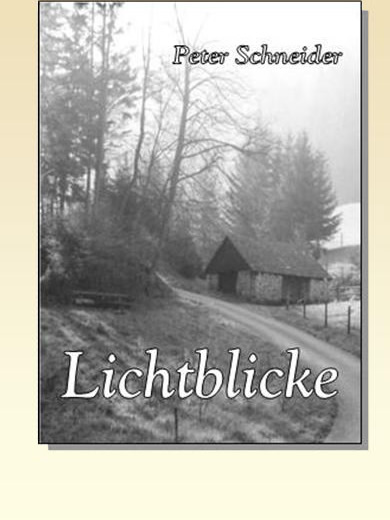WO LIEGT DER ANFANG?  "Was kann ich für Sie tun", fragte höflich der Beamte und der Angeredete erwiderte ihm: "Nichts, denn alles, was sie tun, das tun sie ja um des Lohnes willen, also mit anderen Worten für sich oder für ihren Arbeitgeber, der Sie dafür belohnt. Sie können aber nicht gleichzeitig für sich und für mich etwas tun. Wohl können Sie etwas tun, das gleichzeitig ihnen und mir dem äussern nach nützt, aber sie können es nicht zugleich sich selbst und mir zuliebe tun, denn sie haben nur eine Liebe und nicht zwei. Und tun sie es für sich, so ist es nicht für mich getan."
"Das war ja nicht so gemeint, sondern nur so gesagt", entgegnete der Beamte, und er erhielt darauf die Antwort:
"Das ist der eigentliche Anfang, wenn sich die Rede des Mundes von den Gedanken des Herzens, der Liebe und der Wahrheit trennt, weil damit der Mensch zwiespältig wird und dadurch – wenn vielleicht auch unbewusst und ungewollt – zur Lüge. Wenn er sich an diesen Zustand gewöhnt, so hat er die Orientierung verloren, glaubt an Worte statt an die Wirklichkeit und kann sich selber nicht mehr helfen und auch keine wahre, bleibende Hilfe finden, weil er auch die Wahrheit über sich selber nicht mehr kennt."
"Dann darf ich ja auch keinem einen guten Tag wünschen", meinte der Beamte, und der Kunde sagte ihm:
"Besser wäre es, dies nicht zu tun, weil sie bei der Unterlassung auch keinen kleinsten Anfang zur Lüge machen würden. Indessen gibt es heute leider zur Lüge gewordene Mindestumgangsformen. Wenn sie diese benützen in steter Erkenntnis, dass sie dazu – der Vermeidung von Ärgernissen wegen – gezwungen werden, so ist das Werk oder die Lüge nicht ihr Anteil, sondern der Anteil desjenigen oder derjenigen, die sie dazu gezwungen haben; denn dass sie selber ihr Brot erwerben wollen, ist nichts Ungereimtes, und wenn sie zum Auskommen mit den Menschen gewisse Formen übernehmen müssen, so sind sie aufgezwungen und werden so lange nicht ihr eigener Anteil, als sie sich dessen stets bewusst werden und es darum auch gegen ihren Willen tun. Wenn sie es aber aus einer gewissen Trägheit heraus vergessen, dass ihre Rede und ihr Herz nicht im Einklang stehen, so sind sie der Lüge schon verfallen, indem sie diese in ihren Anfängen nicht mehr erkennen. Sie werden dann umso mehr auch bei ihren Nächsten die Lüge nicht mehr erkennen, wenn sie diese schon bei sich selbst nicht mehr klar ersehen."
"Aber ist das nicht eine fürchterliche Anschauung, laut welcher es am Ende wohl besser wäre, wenn alle Menschen schweigen würden, anstatt, sich zu verständigen."
"Wohl nicht so ganz, wie sie glauben", meint nun der Kunde. "Denn es wäre ja wohl einfacher, seinem Nächsten der Wahrheit gemäss nur zu sagen, was man sich selber wünsche, als ihm vorzulügen, was man ihm wünsche. Wohl gäbe es dadurch vielleicht weniger Übereinstimmung, wenn jeder genauer erkennen würde, dass jedermann nur von ihm wünschte oder forderte und nie und nimmer ihm etwas gäbe. Aber dafür wäre mehr Klarheit und Wahrheit, und man hätte eine Orientierung, gemäss welcher man seine Richtung auch bewusst ändern könnte. So aber haben wir wohl eine Verständigung oder Übereinstimmung, aber nur in der Lüge, die am Ende niemandem dient, sondern jedermanns Untergang bedeutet.
Damit rede ich aber keineswegs einer sorg- und gedankenlosen selbstbezogenen Handlungsweise das Wort, sondern nur der Wahrheit im Umgange mit den Mitmenschen!
Was nützt es, jemandem bloss mit dem Munde einen guten Tag zu wünschen? Wenn das jemandes tiefer Ernst wäre, so genügte es, dass er alles in seiner Macht stehende tut, die berechtigten Wünsche eines Kunden zu erfüllen. Dazu gehörte etwa eine klare und umfassende Beratung – die allerdings eine fundierte Fachkenntnis voraussetzt, die man sich aus eben diesem Wunsche heraus zuerst mit allem Fleiss aneignen muss, sodass man notfalls auch das Eingeständnis, etwas nicht zu wissen, nicht scheuen muss, weil es immer noch viel besser ist, als mit Allgemeinplätzen um eine Antwort herumzukommen zu versuchen. So weiss der Fragende sofort, was er für sicher annehmen kann und wo allenfalls eine Unsicherheit besteht, die fast allem menschlichen Tun bis zu einem gewissen Grade eigen ist.
So viel Ernst ist jedoch schon eher selten. Darum auch wären Wünsche – selbst wenn sie ehrlich ausgesprochen werden könnten – immer etwas Dummes. Denn oft wissen wir gar nicht, was ein Mensch wirklich braucht. Sind nicht gerade die "schönen" Tage dazu angetan, den Menschen entweder zu tollen Unternehmungen zu provozieren oder dann ihrer Trägheit zu frönen? Da wäre der Wunsch nach einem gut ausgenützten Tage zum Wohle aller viel besser. Allerdings gäbe zu einem derartigen Wunsche – wenn er ausgesprochen würde – wohl auch bald und leicht folgende Antwort: 'Was geht Sie das an, ob und wie ich die Tage ausnütze!' Also bleibt es dabei: Es ist besser, wenig zu sagen, aber dafür das jedermann Mögliche für wirklich gute – weil zum Wohle aller ausgenützte – Tage zu tun. Dazu gehört eine gewissenhafte Arbeit und das Eingehen auf die Wünsche des Kunden – wobei auch der Folgen einer Erfüllung ausgesprochener Kundenwünsche eine Beachtung zu schenken wäre. Derart gestaltete Menschen können gar nicht wünschen, weil sie das Gewünschte oder zu Wünschende selber tun! Sie könnten höchstens sich selber wünschen, dass möglichst Viele so tun. Bis dahin tun sie mit ihrem Beispiel das ihnen allein Mögliche."
"Sie sind ein seltsamer Mensch, sie engen mich in meinem Denken ein", stöhnte der Beamte und der Kunde erwiderte:
"Keineswegs! Das scheint nur so. Im Gegenteil, ich bringe Ihnen nur die Klarheit über die Sachlage, und Sie können tun und lassen wie Sie wollen, nur erkennen Sie nun die Folgen. "Was Sie wirklich einengt ist nur ihre Trägheit, derzufolge sie am liebsten nichts Zusätzliches täten oder nur das, was das Weiterbestehen ihrer Sorglosigkeit garantieren würde, also die Lüge. In Wirklichkeit aber sind sie frei und können aus freier Liebe ihrem Nächsten Gutes tun und sich daran erfreuen, wenn sie ihre nächste Umgebung stets aufatmen sehen, anstatt hoffnungslos ausatmen zu hören den letzten Seufzer der schweren Last der Lüge und der Selbstsucht.
Es gibt im Leben nicht nur eine äussere Genugtuung, sondern auch eine innere. Wenn es uns aussen gut geht, so zieht unsere Lust auch stets nach aussen hin. Das Äussere ist jedoch gar schnell wandlungsfähig und damit vergänglich. Ist es dann nicht mehr nach unserer Vorstellung, so wollen wir uns zurückziehen ins innere Feld unseres Gemütes. Was aber finden wir da, wo wir nie gearbeitet haben? Nichts als die Bestätigung dass alles in die Welt hinausposaunte in uns selber wirkungslos geblieben ist, sodass uns darum bloss das eigene Unverständnis als eine drückende Finsternis übrig bleibt. Da ist es schon besser, mit seiner Handlungsweise das Gute wirklich zu tun, um damit allem Äussern gegeben zu haben, was man mit gutem Gewissen nur geben kann. Es ist zwar traurig, ansehen zu müssen, wie wenig das von den andern oft geschätzt wird. Aber der Schatz einer vollen Erkenntnis mitsamt allen aus ihr entspringenden Möglichkeiten bleibt dabei doch bei uns selbst. Und das macht uns reich.
Habe ich sie ja auch nicht gefragt, was ich für sie tun kann, sondern ich habe es ihnen gerne getan, weil ich merkte, dass sie die Fähigkeit in sich haben, meinen Worten zu folgen und frei zu werden."
Da sah der Beamte zum ersten Mal die sonnige und lichtdurchflutete Freiheit der Liebe, die in der Wahrheit ruht, atmete tief ein und auf und erfasste gerne die dargebotene Gelegenheit und dankte – das erste Mal aus ganzem Herzen und mit voller Brust.
5.11.1983
nach oben
DIE EINBÜRGERUNG ODER DIE WÄHRUNGEN  Einmal sah ich im Traume vor dem Erwachen einer Einbürgerungszeremonie zu. Da waren drei Kandidaten, ein Anwalt, der die Gesuche begutachtete und eine Empfehlung dazu gab, oder aber seine Bedenken äusserte, und ein zuständiger Beamter, der dann seine Amtshandlung in genau dem Sinne, in welchem der Anwalt sich hatte verlauten lassen, vollzog.
Ich kam zufälligerweise dazu und sah gerade, wie unglaublich einfach eine solche Einbürgerung ist. Der Anwalt meinte, das Gesuch sei zu bewilligen, worauf vom Beamten der Heimatschein ausgestellt wurde. So war es jedenfalls bei den ersten beiden Gesuchstellern.
Beim dritten zog der Anwalt die Augenbrauen hoch und sagte, dass er hier schwere Bedenken hätte, worauf ich annahm, dass der Gesuchsteller mit irgendetwas vorbelastet sei. Aber nichts dergleichen brachte der Anwalt hervor, sondern liess lediglich verlauten, dass man nicht einfach Bürger dieses Staates werden könne, um sich dadurch ein leichteres Leben zu sichern, sondern man müsse ein aktives Interesse am Staate bekunden – und zwar unentwegt – und müsse sich darum in der Gemeinschaft auch nützlich machen.
Diese seine Worte leuchteten mir ein und ich musste ihm recht geben. Alleine, mir kamen alle drei Bewerber sehr interesselos vor, die ersten zwei zwar geschäftiger als der dritte, aber auf jeden Fall interesselos, was höhere Interessen anbelangte. Der dritte und letzte Bewerber war eher ruhiger Natur und stille. Die betroffene Stille nach dem ausgesprochenen Antrage des Anwaltes war deshalb umso grösser, sodass ich nicht anders konnte, als für ihn Partei zu ergreifen, weil ich wusste, dass gerade die Stillen, mehr In-sich-Gekehrten in diesem Staate, wo nur Anliegen von Interessenvereinigungen entgegengenommen und zum Gesetz erhoben werden, und nicht etwa die Anliegen der Gerechtigkeit, so wie sie das Gewissen erfordern würde, nicht nur nichts erreichen, sondern dass oft sogar ihre elementarsten Rechte nicht einmal respektiert werden.
Bei dieser Parteiergreifung wurde ich wach. Darum musste ich in wachem Zustand in mir selbst mit dem Anwalt zu reden beginnen, was für mich kein Problem darstellte, da ich die Anwälte aus der Praxis bereits kannte und darum auch wusste, dass sie es ungleich besser verstehen, die Gesetze nach ihrer Interessenlage zu verdrehen, als den Grundgedanken des Gesetzgebers im Gesetze zu erkennen und auch zu respektieren. Ich gab ihm dabei zu bedenken, dass ein vordergründiges aktives Mitmachen in Vereinen oder gar Geschäften noch lange nicht ein Interesse am Staat beweise, ja nicht einmal die Vermutung dazu nahe lege. Da der Mensch gesellig sei und in der Gesellschaft auch gerne etwas gelte, so sei es nur natürlich, dass er sich einen Wirkungskreis suche, in welchem er seine Natur entfalten könne, um so zur geliebten Geltung zu kommen; das täte ein solcher Mensch in einem jeden Lande, wenn er entweder länger bleiben wolle, oder auch länger bleiben müsse. Dabei hörte ich aus meinen vielen, ja überreichen Erfahrungen mit so genannten Rechtsgelehrten heraus die Antwort des Anwaltes ganz deutlich in mir, indem er einwarf, dass es für ihn – ja für alle – schwierig sei, die innere Gesinnung eines Menschen zu erfassen, und dass er bei der Beurteilung deshalb eben auf solche äussern Merkmale abstellen müsse. Und ich konnte ihm meine Antwort nicht vorenthalten, weil ich diese Art Menschen gut kenne, und sagte:
"Ja, das weiss ich wohl, dass ihr alle stets nur aufs Äussere abstellet, weil ihr nur das Äussere kennet und nur darin zuhause seid, und euch auch nur dabei wohl ist. Denn das Äussere lässt sich stets deuten wie man will und wie man es am besten für seine Zwecke gebrauchen kann. Aber das wäre euch noch nie in den Sinn gekommen, wenigstens einmal einen innerlich tätigen Menschen danach zu fragen, was ihn in seinem Gemüte beschäftige und was seine Absichten seien. Natürlich kann eine Rede darüber ebenso gut gefälscht werden wie ein äusseres Benehmen. Aber auf eine solche Rede kann man dafür auch eher fragend und prüfend eingehen als auf ein äusseres untadelig aussehendes Benehmen. Es wäre ja doch ein Leichtes gewesen, den dritten Kandidaten wenigstens zu fragen, weshalb er eingebürgert werden wolle. Hätte er dann beteuert und gesagt, dass er unser Land liebe, so hättet ihr dann immer noch fragen können, wie er das zu beweisen gedenke, wenn es auf einen solchen Beweis ankäme. Vielleicht hätte er in seinem innern Reichtum eher ein Mittel gefunden, seine Liebe zu verdeutlichen, als ihr ein Mittel finden würdet, diese Liebe zu erkennen. Er hätte beispielsweise sagen können, dass man die Liebe zwar nicht einfach sehen könne und sie deshalb auch nicht so ohne weiteres zu zeigen sei; aber da ja in der Welt alles mit Geld gemessen werde, so wolle er den Vorschlag machen, dass er zehn Jahre lang den dritten Teil seines gesamten Einkommens dem Staate geben wolle und von den übrigen zwei Dritteln erst noch die normalen Steuern zahlen wolle. Hätte er dann nicht wesentlich mehr getan als die ersten beiden, die ausser guten Reden in ihren Vereinen – sofern es gute waren – und viel Bierkonsum im Verein mit Gleichgesinnten nichts für die neue Heimat taten und wohl auch nicht mehr dafür zu tun bereit gewesen wären!"
Die Antwort des Anwaltes war mir aus den vielen Leiden eigener Erfahrung klar. Er musste bei der Förmlichkeit seines Amtes bleiben, das er mangels inneren Reichtums an Möglichkeiten mit dem Beizug äusserer Scheinfakten absichern musste; schliesslich musste er ja seinen Vorgesetzten oder Wählern gefallen und nicht der Liebe zur Wahrheit und Gerechtigkeit einzelner und stets weniger werdender Gerechter, deren Gewicht in einem Staate gleich Null ist.
Und somit konnte ich mich – wenn auch nur innerlich – nur noch mit dem Einbürgerungswilligen unterhalten. Diesen aber kannte ich aus dem Traume nicht näher, da er ja darin keine Handlung begangen, sondern nur auf den Entscheid der andern gewartet hatte. Auch sind alle die Wartenden und Harrenden in der Welt so verschieden geartet, dass ich einen betreffenden Fremden nicht einfach aus Erfahrung in meinem Gemüte zum Reden brachte. In dieser Situation dachte ich daran, dass viele, ja fast alle Menschen nur irdische Vorteile suchen und zeitliche Ziele verfolgen und auf deren Erfüllung warten, und dass sie darin alle dem Anwalt gleichen, indem sie alle nur dem Äussern dienen und dafür bereit sind, das innerlich etwa noch sich Regende – sei es in ihnen selbst oder in andern – zu zertreten in den Staub äusserlicher Nichtigkeit. Und mir wurde bewusst, dass ich für alle diese ohnehin keine Worte in mir habe und auch keine haben müsse. Denn ihnen allen wird die Antwort endlich aus ihrer eigenen Handlungsweise werden, aus welcher sie, wenn auch andere sie einmal anwenden, erkennen, dass deren Vorteile stets dem Nächsten zum Nachteil werden. Für den Fall, dass er, der Fremde, aber seltenstermassen und möglicherweise doch nicht zu diesen äusserlichen Menschen gehören sollte, sondern auf wahrhaft bessere Zeiten wartete und dazu auch ein Möglichstes zu tun bereit gewesen wäre, hätte es mich traurig gestimmt, ihn ohne einen Trost und ohne Aufmunterung einfach in seinem Kummer und seiner Enttäuschung stehen zu lassen. Und für diesen Fall fand ich dann in mir selbst folgende Worte für ihn: "Sieh, lieber Bruder, in einem gleicht dein Schicksal stark dem meinigen: Du findest kein Gehör beim abgestumpften Ohr der Welt, und deine innern Anliegen werden weder gesucht noch verstanden. Darin tust du mir wahrlich leid. Ist es dir jedoch ernst mit deiner Liebe zu diesem Lande, dessen Bürger du werden willst, so sage ich dir, dass auch in diesem äusserlich noch so schönen, ordentlichen und reichen Lande die Liebe nicht gefragt ist. Sie ist keine gangbare Münze und der Wert ihrer Währung ist gleich Null.
Wie lange aber wirst du noch unter diesen Menschen verbleiben, die keiner Liebe zugänglich sind. Wenn es hoch kommt, so werden es noch dreissig oder vierzig Jahre sein. Dann – wenn du das Zeitliche mit dem Ewigen vertauschest – wirst du ohnehin wieder heimatvertrieben sein. Möchtest du da nicht eher Bürger eines Reiches werden, das unvergänglich ist und dessen Währung – die Liebe – schon hier das einzige wirklich beseligende Tausch- oder Zahlungsmittel ist? Falls du in jenem Reiche Bürger werden willst, da musst du allerdings einen sehr hohen Betrag bezahlen, der dich am Ende alle deine weltlichen Interessen kostet; aber bedenke, dass dieses Reich dafür auch frei ist von allen weltlichen oder zeitlichen Interessen, und dass du deshalb nie mehr in Konflikt mit solchen Interessen anderer kommen kannst. Das eigenartige jener Landeswährung, die eben die Liebe ist, besteht nur darin, dass sie stets höher im Kurse steht, je weniger du von andern, zeitlichen Währungen besitzest. Hast du Weltruhm beispielsweise noch mit dir und hängst an ihm, so steht er dir vor der Liebe zum Nächsten. Hast du aber grosse zeitliche Güter, die du liebst, so stehen auch diese der Liebe zum bedürftigen Nächsten entgegen. Hast du grosse Weiberliebe, so steht diese bloss sinnlicher Liebe zum Äussern dem Ernst der Liebe zum Innern, Ewigen entgegen, denn im Inwendigen gibt es nicht Mann noch Weib, sondern es sind nur Kinder eines und desselben Vaters.
Und so geht die Reihe der Hindernisse fort und fort, sodass feste oder solide Bürger dieser Welt beinahe unendliche Schwierigkeiten haben, Bürger jenes Reiches zu werden. Wohl werden auch sie Einwohner ihrer eigenen, innern und darum jenseitigen Welt, aber sie haben mangelnder Liebe zu ihren Nächsten wegen oft keine Möglichkeit oder Fähigkeit, Kontakt zu andern zu finden. Es sei denn, sie wittern mit ihrer ausgeprägten Liebe, zu nehmen anstatt zu geben, und zu fordern anstatt ein rechtes und gerechtes Mass zu erfüllen helfen, ähnlich Gesinnte. Solche können sich da wohl noch zusammenfinden, jedoch – ihrer Natur entsprechend – nur für Streitereien, und nicht zum gegenseitigen Dienst aneinander. Ohne Währung jenes Reiches, der reinen uneigennützigen Liebe, aber kannst du dich dort nicht einkaufen und könntest dort auch als Fremder nicht wohnen. Wie wäre das wohl zu denken! Du müsstest ja jenen Bewohnern zum Schuldner werden, und das in einem Reiche, wo es keine Schulden gibt.
Darum sei nicht traurig, wenn du hier nicht vieles und schon gar keine Staatsbürgerschaft hast. Der Erwerb der Währung jenes Reiches der Liebe fällt dir dafür umso leichter, denn er besteht wie bereits gesagt in nichts anderem, als im völlig arm werden an Währungen der diesseitigen Reiche. Siehe, ich selbst bin zwar Bürger eines diesseitigen Reiches, habe aber dennoch auch eine kleine Währungsreserve jenes vollendeten Reiches; aber ich kann hier damit ebenso wenig bezahlen wie du. Was nützt mir da die Bürgerschaft? Ich sage dir, sie hindert mich höchstens – insoweit ich sie liebe oder auch nur achte – am Erwerb grösserer Währungsschätze jenes Reiches. Wer ist nun ärmer und wer reicher von uns beiden? Dich kostet es beinahe nichts, dir jene Währung anzueignen, mich aber kostet es immer noch den Verlust des Bisherigen. Heute und in diesem Reiche sieht es zwar aus, als wäre es anders. Aber wer weiss es, wie lange wir beide noch Bewohner eines diesseitigen Reiches sind? Mit Sicherheit steht nur fest, wie ewig lange wir Bewohner jenseitiger Reiche sein werden.
3.5.1982
nach oben
GRATWEGE  Einst – in meiner Jugendzeit – sah ich einmal von einer Bergwiese aus eine Gruppe Wanderer einen steilen und felsigen Gratweg entlang wandern. Bunt hoben sich die Farben ihrer Kleider gegenüber dem blauen Himmel ab, der mit weissen Wolken betürmt war. Und kräftig, beherrscht und selbstsicher empfand ich die einzelnen Glieder dieser Gruppe in meinem noch jugendlich empfindsamen Gemüt. Dabei spürte ich allerdings auch, dass ich nicht geboren war, ein Held zu sein oder zu werden. Mir gefiel zwar der Anblick – und auch der Eindruck, den dieser Anblick auf mich machte –, denn die Weite der Freiheit war auch bei mir ein starkes Bedürfnis. Nur hatte ich nicht die Veranlagung, sie zu erstürmen – wohl aber zu erringen, was ich damals allerdings noch nicht auseinander zu halten vermochte, sodass ich mir, als Folge davon, stets als ein Schwächling vorkam. Einmal dann – in spätern Jahren – beging ich in Gemeinschaft mit meiner Familie in einer Zeit depressiver und äusserst schwacher Konstitution einen relativ waagrecht verlaufenden Gratweg. Besonders linkerhand war das Gelände äusserst steil abfallend, streckenweise allerdings dann auch beidseits. Nur war der Grat natürlich nicht so hoch gelegen, wie jener, dessen Begehung durch eine Wandergruppe ich in meiner Jugend einmal gesehen hatte, und der schon über der Baumgrenze gelegen sein mochte. Der von uns begangene Gratweg verlief zwischen einzelnen Baumgruppen, oder dann – an den steil abfallenden Stellen – über einzelne Baumgruppen der Tiefe hinweg, manchmal auch – an weniger exponierten oder abfallenden Stellen – war er fast umwaldet, streckenweise aber auch ziemlich frei und offen.
Meine ganze Verfassung war nicht danach, allzu nahe an den Abgründen vorbeikommen zu müssen; darum war mein Gang eher gespannt als locker. Aber das Bild der Landschaft floss trotzdem wie ein Balsam in mein Gemüt. Nicht nur die Stille, auch nicht nur der sonnenbeschienene felsige Weg allein, sondern ebenso das hin und wieder trauliche Zusammenstehen einer Baumgruppe oder auch die streckenweise begleitende Säumung des Weges durch einzelne Sträucher und Bäume liessen mich ein Behütetsein empfinden auf dem für mich in dieser Verfassung als "gefahrennahe Strecke" eingestuften Weg. Nie konnte ich mich zwar so ganz ungezwungen dem Genuss des Landschaftsbildes hingeben, dafür empfand ich Vieles mit einer beseligenden Dankbarkeit.
Erst, als ich wieder zu Hause angelangt war und mich im Kreise der Familie ausruhen konnte, ohne dass dabei viel gesprochen wurde, begann sich in mir das zuvor Erlebte zu weiten, begann ich die Frische der Luft und die Weite des Sichtfeldes zu empfinden, und mit doppelter Dankbarkeit empfand ich ein gewisses Behütetsein, welches von Ängstlichen oder Zagenden empfunden werden kann, wenn eine angespannte Situation sich entspannt hat. Dazu empfand ich all die Bäume und Sträucher entlang des Weges wie Grussbotschaften und Zusicherungen eines ewig waltenden und sorgenden Vaters im Himmel, der in seiner grenzenlosen Freiheit dennoch nur das eine Ziel hat: Alle seine Kinder wohlbehalten und bereichert von der harten äussern, materiellen Welt wieder zu sich in ihr Gemüt heimkehren zu lassen, wo alleine er uns zu einem himmlischen Reich verhelfen kann.
Wie ganz anders, ja wie segensreich stärkend war doch diese Wanderung gegenüber jener von mir gesehenen in meiner Kindheit, die zwar das Selbstbewusstsein so gestärkt haben mochte, wie sich das ein unerfahrenes Kind wohl wünschen kann – nicht jedoch ein erfahrener Mann. Denn: wie wenig ist doch dieses Selbst, angesichts der Grösse und Weite und der Unzahl von guten und schlechten Möglichkeiten, die uns diese äussere Welt zu bieten hat! Wie mancher ist doch schon – auf sich selbst vertrauend – abgestürzt, an Stellen notabene, wo es keinen ersichtlichen Grund dazu gab; und wie klein wird dieses Selbst, wenn es gilt, das Zeitliche mit dem Ewigen zu vertauschen! Wie schön ist die Empfindung dagegen, behütet zu sein schon in der freien luftigen Höhe eines irdischen Gratweges, sodass man aus einer gewissen Erfahrung des alltäglichen Lebens heraus – das in vielen (auch innern) Situationen ebenfalls eine Gratwanderung ist – eine Gewissheit erlangt, dass jenseits alles Greifbaren eine unbegreifbar grosse, liebende Zuwendung eines gar mächtigen und starken Vaters besteht.
Nichts bleibt dem so Empfindenden übrig, als aufzuschauen und dankbar anzunehmen, was ihm in sein Gemüt einfliesst, derweil der Selbstbewusste vergeblich ringend sich an Vergängliches hält, das ihm ja – wie aller Ruhm und aller äussere Erfolg – in einer vergänglichen Welt auch nur zeitweilig gegönnt ist. Wer sich hingegen dem liebevoll sorgenden Vater völlig übergeben hat, wenn auch durch Not und Krankheit, und damit durch eigene Schwäche gedrungen, der ist bereits vergangen in seinem Selbstwahn und braucht sich darum nicht mehr selber zu halten und erhalten; er ist gehalten und wird geführt, in stets freiere Höhen der Erkenntnis, ohne dass ihn das grenzenlose Ausmass dieser Freiheit – auch jenseits – je mehr beirren muss.
7.5.1997
nach oben
ZWEIFACHE BEGEGNUNG  Es begab, sich einmal, dass ein wohlhabender Herr nach mehreren Jahren ein zweites Mal in eine ferne Stadt reiste, um sich dort für sein weiteres Fortkommen notwendige Erkenntnisse in einem Kurse zu erwerben. Dabei stieg er wieder in demselben Hotel am Rande der Stadt ab, in welchem er schon das erste Mal logiert hatte. Und siehe da: es war in diesem Hotel noch vieles so geblieben, wie es früher war. Selbst das Zimmermädchen, das er damals kennen gelernt hatte und mit dem er oftmals sehr schöne und tief greifende Gespräche geführt hatte, war noch dasselbe, wie er bald einmal gewahr wurde. Gerne hätte er es damals zu sich nach Hause geführt; aber das Mädchen, das sich im Übrigen sehr zu benehmen wusste, mochte dazu nicht einwilligen, weil es in seiner Armut – im Vergleich mit der Wohlhabenheit des Gastes – eine zu grosse und unüberwindliche Grenze überschreiten zu müssen geglaubt hatte. Es verdiente sich ehrlich seinen Lohn und wollte nicht auf Gnaden und durch Zuneigung eines andern sich durchs Leben bringen. Obwohl dem Gaste damals diese aufrichtige Ehrlichkeit gefiel, vermochte er damals die Kühle und Reserviertheit des Mädchens nicht derart zu erwärmen, dass es seinen Sinn geändert hätte.
Nun trat er einmal in sein Zimmer, als das Zimmermädchen gerade die Scheiben seines Zimmerfensters zu putzen hatte. Und da es ein warmer, schöner Frühlingstag war, trat er ans Fenster und schaute ihr wortlos eine Zeitlang zu, denn noch liebte er das Mädchen – auch war er noch ledig geblieben; nur sprach er es nicht an, weil er seinen Willen von damals noch immer respektierte und zudem nicht wissen konnte, wie sich das Mädchen inzwischen verändert habe. Dieses aber erkannte den Gast zwar wohl sofort wieder und empfand in sich auch wie eine Reue über seinen eigenen damaligen Entscheid, konnte aber in seiner Befangenheit den Gast nicht anreden. Nach einer Weile erst sagte es während der Arbeit zu ihm, mit seinem Kopfe auf den noch blühenden Apfelbaum vor dem Fenster hinweisend: "Schon sind die Blüten am Verwelken". Der Gast gab ihm Recht, nahm aber das Gespräch nicht auf. Nach einer weitern Weile sagte sie: "Der Wald ist schon bald ganz grün". Und wieder war es eine kurze Zeit stille zwischen den beiden. Da sagte bedächtig der Gast: "Ja, was Sie sagen, das ist wahr. Aber es bringt uns beide nicht weiter, wenn Sie dasjenige beschreiben, was ich selber auch sehen kann. Viel eher würde es vielleicht beiden nutzen, wenn Sie von demjenigen reden würden, das nicht jedermann sichtbar am offenen Tageslicht liegt. Denn der Sinn der Rede sollte stets in einem Aufeinanderzugehen liegen, und nicht in einer Ablenkung vom Eigentlichen hinweg auf für beide Unbedeutendes – weil Äusseres – hin, weil damit keinem Menschen gedient sein kann. Und darum sage ich Ihnen nun mit Ihren eigenen Worten, was Sie wohl in der Tiefe Ihres Gemütes bewegt hatte und was Sie mir demzufolge gerne gesagt hätten, wenn Sie es nur vermocht hätten, dasjenige auszusprechen, was Sie auch gefühlt haben. Sie wollten doch sagen; Die prachtvolle Zeit der Blüten ist am Vergehen und es folgt die Zeit, in der ich mich zu fragen beginne, zu was sie nutz gewesen ist; ob wohl nährende Früchte daraus werden wollen, sodass im einsamen Winter der Gefühle genügend Wärmendes und Nährendes vorhanden ist? Und zaghaft setzten Sie ein äusseres Wort Ihrer innern Hoffnung dazu, das vollständiger ausgesprochen lauten müsste: Dann würde der ganze Wald meines noch wenig durchforsteten Gemütes wohl doch endlich zu grünen beginnen in der Hoffnung, dass mir dasjenige zukommen möchte, was trotz aller noch so ehrlichen Anstrengung sich kein Mensch selber zu verdienen vermag: die Erfüllung! – – Wenn Sie das gesagt hätten, so hätte ich Ihnen darauf auch antworten und Ihnen bestätigen können, dass Ihr innerster Wunsch in der langen Zeit seit unserer ersten Begegnung noch immer nicht unerfüllbar geworden sei. So aber kann ich Ihnen ja nicht bestätigen, was Sie nicht ausgesagt, wohl aber sich gewünscht haben. Damit hatte er die tief liegende Wesenswelt des Mädchens richtig getroffen; denn schnell wischte es noch das letzte Wasser von der Scheibe und verschwand wortlos aus dem Zimmer.
Als der Gast am späten Nachmittag wieder in sein Zimmer trat, sah er das Zimmermädchen seine am Morgen begonnene Arbeit der Fensterreinigung fortsetzen. Er trat auf es zu und sah es an. Längere Zeit ruhte sein fragender Blick auf ihm, bis es endlich seinen Putzlappen weglegte und verlegen zu ihm auf sah. Als sich ihre Blicke kreuzten, erkannte es die Zeit; es begann zu weinen und fiel an seine Brust. Und so wurde dem Manne erst beim Verwelken der äussern Blüte, was er sich bei ihrem ersten Anblick schon erhofft hatte: eine süsse, nährende Frucht – ein Gefäss für all seinen Reichtum. Und in ihr war der Platz für ihn gereift, welcher vorher noch von der eigenen Tugendfülle versperrt gewesen war.
2.5.1994
nach oben
QUINTESSENZ EINER JUGENDERINNERUNG  "Wer hätte damals gedacht, dass wir uns hier, unter solchen Umständen, noch einmal wiedersehen werden!" sagte ein noch rüstig und jugendlich aussehender älterer Mann zu seinem Gegenüber, das er nach beinahe einem ganzen Erdenleben in einem verfallenen Vorort einer grösseren Weltstadt ganz unerwartet getroffen und sofort erkannt hatte. Da er selber nicht mehr in dieser Stadt wohnte und die Wirtschaften daselbst alle überfüllt waren, so beschloss er, als der Vermögendere, ein gutes Nachtmahl einzukaufen, um es dann in der Wohnung seines frühern Freundes mit ihm zusammen zu verzehren.
Nun sassen sie im Dämmerschein des spätsommerlichen Abendlichtes in der Wohnung des frühern Freundes und redeten über so manches gemeinsame Erlebnis ihrer frühen Jugendzeit und auch über so unendlich viele Begebenheiten, die sie während ihrer Trennung erlebten, erlitten und durchgestanden hatten. Eine fast wehmütige Stimmung verbreitete sich dabei in der karg eingerichteten Stube der ärmlichen Wohnung des frühern Freundes, der diese schon seit einigen Jahren allein bewohnte, da seine Kinder sich von ihm entfernt hatten und seine Frau bereits gestorben war. Im weitern Gesprächsverlauf sagte der Wohnungsinhaber immer wieder einmal zwischendurch, dass er nicht begreifen könne, wie dieses alles so habe kommen können, oder gar vielleicht habe kommen müssen, und wie er nicht verstehe, wo und was er in seinem Leben falsch gemacht habe, oder ob es einfach ein so ungerechtes Schicksal gäbe, welches die einen ständig herausfordere und beutle, während andere es ganz gemütlich haben könnten, und er setzte hinzu, dass er natürlich nicht ihn, seinen Freund, meine, wenngleich er es ja sicherlich auch etwas besser haben werde. Dieser aber tröstete ihn damit, dass er ja zumindest in seiner frühesten Kindheit ebenfalls eine sehr schöne und an Erlebnissen reiche Zeit mit ihm zusammen verbracht habe und dass er darum des öftern dieser schönen Erinnerungen recht lebhaft gedenken solle, wenn ihn das jetzige Elend zu sehr anzupacken scheine, und er erzählte ihm als Illustration dazu so manches Beispiel aus ihrer gemeinsamen Jugend, und stellte das so plastisch dar, dass sein ärmerer Freund oft für längere Augenblicke ganz in seine Jugend zurückversetzt war und oft ein Lächeln über sein altes, müdes Gesicht huschte, das seine tief gefurchten Züge für kurze Zeit erhellte. Er erzählte ihm vom Hügel vor der Stadt, der zwar öde wirkte, weil er nur eine spärliche Vegetation hatte, und wie sie darum nur in und aus ihrer Vorstellung heraus ein Imperium haben gestalten können, dem nichts abging, was Knabenherzen sich wünschen konnten. Dabei begann er, eine der dort so oft gemeinsam erlebten Morgenszenen zu schildern, so wie sie nur gemütsstarke Kinder noch empfinden und erleben können: "Über allem Grau und Braun des fast kahlen Bodens erhob sich fern im Osten die herrliche Sonne über den Horizont und zog ihre glanzvolle Bahn in das ruhige und reine Blau des Himmels, der sich über uns beiden wölbte. Ihr Licht gab unsern Gesichtern das Profil, um das wir als Jugendliche rangen, erwärmte unsere kalten Glieder, die sich nur von einem eher mässigen Morgenmahl ernähren konnten, und ihr Glanz verlieh allen unseren Spielen, Bauten und Vorstellungen eine Pracht, wie sie nur eben der Glanz des Lichtes hervorbringen kann. Weisst du noch, wie wir von diesem kärglichen Hügel aus oft die Sicht über die Stadt genossen hatten und uns in einem erfrischenden Morgenlüftchen wie Sieger fühlten, wenn wir unter uns – mehr in der Ferne und tiefer gelegen – den Rauch und den Qualm erblickten, der aus den Kaminen der Industrie zu quellen begann und sich als zähe, gleichsam staubige Masse über das Bild der Stadt wälzte und damit den herrlichen Morgen einem Grossteil der Stadtbewohner verdüsterte, während er uns selber vom sichtbaren Bild der Stadt trennte. Da waren wir, und wir fühlten uns wie Könige und die Kargheit der Landschaft verschwand im alles überstrahlenden Glanz der Sonne und im Reichtum unserer beflügelten Fantasie. Weisst du noch", fuhr der Besucher fort, "wie wir uns damals vornahmen, uns nie der Industrie zu verpflichten und nie eine Arbeit in der Stadt anzunehmen, sondern lieber unter den kargsten Verhältnissen auf dem Lande, in der freien Natur zu bleiben, und wie wir darauf vertrauten, dass uns dazu der liebe Gott schon eine Möglichkeit zeigen würde. Weisst du auch noch, wie wir unsere Eltern bemitleideten, dass sie sich all dem Schmutz und Dreck des Alltages nicht entziehen konnten und wie ich stets wieder mit meinen Eltern darüber stritt und bezweifelte, ob dieser Schmutz zum Leben wirklich notwendig sei, und wie ich sie stets überreden wollte, doch alles hinter sich zu lassen, indem sie einen neuen Anfang suchen sollten. Einen Anfang ohne Komfort, ohne alle Annehmlichkeiten, aber auch ohne allen Staub, Russ und Dreck, ohne alle politische Rücksichtnahme; allein mit der freien Liebe zueinander und füreinander. Es sollte nur Liebe und Einsicht uns leiten, dann bedürften wir keiner weiteren Hilfe, als jener Gottes, die Er doch dem fest Wollenden sicher nicht vorenthielte. – – Ich weiss schon, damals hattest du manchmal gelächelt über meine Schwärmerei, aber schön und herrlich war es trotzdem, auch für dich. Oder weisst du noch, wie gross unsere Freude war, als wir etwas später den Waid entdeckten, der hinter jenem kargen Hügel sich ausbreitete? Wie uns sein geheimnisvolles Dunkel ebenso in Beschlag nahm, wie seine feuchte und an heissen Tagen angenehme Kühle? Wie wir die vielen Verstecke darin gleichsam als Wohnungen benützten und wie wir von Wohnung zu Wohnung im Überschwange unserer jugendlichen Freude trabten, wie Pferde, die eine glückliche Post oder Botschaft von einem Ort zum andern spedieren mussten. Weisst du noch, wie kostbar uns das Licht dünkte, als wir uns im Jungtannenforste förmlich verirrten und im dichten Gewirr dürrer Äste und Zweige sein Ende nicht mehr zu finden glaubten. Ja, bei der Lichtung darin vermeinten wir, das Ende zu entdecken, weil ein direkter Sonnenstrahl sich ins Dickicht die Bahn brechen konnte. – Spürst du noch, wie uns dieser Lichtstrahl damals wie ein Versprechen vorkam, ein Versprechen der Sonne, dass überall ausserhalb dieses Dickichts ihr wärmendes, belebendes Licht sei und uns auch erwarte, wenn wir uns nur endlich aus diesem Dickicht begeben würden? Magst du dich erinnern, wie wir da aufgeatmet hatten, und wie sichtlich beruhigter wir den weitern Ausweg daraufhin gesucht hatten? – Wie ich damals geschworen hatte, nicht mehr ohne Not in ein solches Gestrüpp zu gehen? Ja, bedenke nur, was alles wir in diesem Walde gefunden hatten, wie er angefüllt war mit tausend teils noch unbekannten Kostbarkeiten und Geheimnissen und wie er uns doch nie zu enge werden konnte, ja, wie wir seine Äste wie Arme empfanden, die er uns entgegengestreckt hat und zugleich auch schützend über uns gehalten hat zum Schutze gegenüber den Unbilden des Wetters – und auch der Welt! Ja, wie der Wald uns damals deckte vor den Blicken der uns einmal verfolgenden Bande von Radaubrüdern, bis wir uns in der Dunkelheit der Nacht wieder zurück über den Hügel wagten, um uns die Strafpredigt unserer Eltern anzuhören." –
"Ja, höre doch endlich auf mit all diesen Erinnerungen!" unterbrach der Ärmere die mit Begeisterung vorgetragene Erinnerungsrede seines Jugendfreundes und fuhr fort: "Jetzt, wo der Mond seinen Silberschein wie damals, bei jener Heimkehr, über die Welt zu verbreiten beginnt, erfüllt es mich mit unaussprechlicher Wehmut, dass all sein Glanz – ja, dass das ganze Himmelsgewölbe von den engen und kahlen Grenzen meines armseligen und schmutzigen Fensters eingeengt, ja durch das Fensterkreuz noch zerteilt und zerschnitten wird. Oh, wie arm bin ich doch geworden, wie unaussprechlich arm! – Damals war es noch die Fürsorge unserer Eltern, die mit ihrer mahnenden Strafpredigt dem Erleben und Erlebnis jener Nacht ein Ende bereitet hatten, aber heute sind es nackte, bleibende Tatsachen. Es sind die Steine meiner kahlen Wohnung, die meinen Blickwinkel beengen und begrenzen. Sie alleine sind nun mein Schutz – ohne es zu wollen –, nicht mit irgendeiner Anteil nehmenden Absicht. Sie gönnen mir zwar einen kleinsten Teil des nächtlichen Himmels, aber sie bestimmen, welchen; und ich kann nicht mehr am Ganzen teilnehmen. Sie versagen mir den Anblick des Mondes und überlassen mir nur den kleinsten Teil des von ihm so geheimnisvoll erhellten Nachthimmels. Wie hart ist diese Begrenzung doch im Vergleich zu den wohlgemeinten Ratschlägen und Vorwürfen meiner Eltern! Wie unendlich arm und fern vom Leben muss ich doch sein!? – Hätte ich die Kraft und Fantasie wie du, ich würde aufstehen und den Fensterladen schliessen und dann in mir unendliche Male lieber meine Erinnerungen beschauen, als die nackten Tatsachen vor mir mit meinen Augen bloss noch zu quittieren und sie dabei als ein Sinnbild meines endlichen irdischen Ablebens empfinden zu müssen. Aber diese Kraft habe ich schon lange nicht mehr. Zwar geschah mir im Anfange deiner Erinnerungserzählung wohl, ja unendlich wohl sogar, aber mit der Zeit begann ich zu merken, dass das nur deine Erinnerungen sind und dass sie alle mit dir wieder von mir weichen, wenn du mich wieder verlässt. Diese Kraft habe ich nicht mehr, mich selber in solch lebhafte Erinnerungen zu begeben, und auch die Gesundheit habe ich nicht mehr, nun in der kühler werdenden Jahreszeit, mich eine längere Weile im Freien aufzuhalten, noch habe ich voriges Geld, mir für solche rein überflüssige Freuden genügend warme Kleidung zu verschaffen. Oh, wie unendlich arm und verloren komme ich mir nun vor!"
Den Freund dauerte zwar die Betrübnis seines Jugendfreundes, aber im Moment traf ihn dieser Ausbruch der Verzweiflung zu sehr, als dass er so schnell etwas hätte sagen können. Nach einer Weile aber nahm er das Wort wieder auf und fragte ihn, weshalb er glaube, dass er die Kraft verloren habe, sich in sein Gemüt und in seine Erinnerungen vertiefen zu können und ob er sicher sei, dass er das nicht mehr könne. Nun, da er es ihm doch wieder erzählt habe, habe er es doch auch vermocht. Er sei zu alt geworden, meinte der betrübte Freund und zuckte mit den Achseln. "Aber am Alter der Jahre kann es doch nicht gelegen sein!?" gab ihm der andere zu bedenken. "Denn wir sind doch bis auf einige Jahre genau gleich alt. Da müsstest du schon eher den Umständen die Schuld geben."
"Aber, ich war damals in ebenso misslichen Umständen!" warf der Betrübte ein. "Nicht ganz so, wie du nun meinst", erwiderte sein Freund und meinte weiter: "Du selbst sagtest doch vorhin, dass damals nur die Liebe oder Fürsorge deiner Eltern das Erlebnis deines Nachthimmels begrenzte, während es nun die nackten Mauern deines Fensters seien. Also erlebst du nun doch keine Fürsorge mehr und bist alleine, bist selber ein vom Ganzen getrennter Teil, wie der Nachthimmel, den du durch dein Fenster schaust. Da fragt es sich bloss, ob dein Alter daran schuldet, dass deine Fürsorger nicht mehr sind, und darin hättest du wohl beinahe recht, indem du deine Eltern und deine Frau überlebt hast. Aber siehe, ich kann nicht so recht darin einen Grund für dein Empfinden sehen. Denn seinerzeit kam dir die elterliche Fürsorge ja nicht so sehr fürsorglich, sondern vielmehr ebenso einengend vor, wie heute der Rahmen deines Fensters. Es muss also ein anderer Teil deines Lebens oder deines Wesens schuld sein an deinem jetzigen Unvermögen, dich als zum Ganzen gehörig zu betrachten und zu erkennen. Etwas ganz anderes muss deine auf dem Hügel vor der Stadt empfundene Freiheit eingegrenzt haben. Überlege doch einmal, was damals die Stadt von unserem freien Sein unter dem freien blauen Himmel abgegrenzt und getrennt haben mag. War es nicht ihr eigener Rauch, der sie abschnitt, nicht nur von unserem Standplatz, sondern auch vom Licht und der Wärme – also von der Leben spendenden Kraft der Sonne? Und so, wie wir es damals in einem Naturbilde erleben konnten, ist es noch immer und wird wohl auch stets so bleiben: Der eigene Lärm in unserem Gemüt vergällt uns das Wort der andern und der eigene Rauch verhindert uns die Sicht fürs Ganze. Oder – noch deutlicher gesagt: Unsere starke Beschäftigung mit uns selbst und mit unsern äussern Verhältnissen lässt uns zu wenig auf andere eingehen, am vielfältigen innern Geschehen anderer teilnehmen, sodass wir mit dem Schwinden unserer äussern, leiblichen Kraft in unserm Innern arm und einsam werden. Und der Rauch unserer Selbstgefälligkeit verhindert unsern Blick hinauf, zu einer höhern Ordnung, zu Gott. – – Du wolltest zwar – wie ich selber auch – der Armut deiner Eltern und deiner Geburt entrinnen, aber du hast unter dem freien Himmel damals nicht mit mir zusammen geschworen, diesem Himmel, seinem Blau der Treue und dem Licht der Sonne mitsamt ihrer belebenden Wärme – das heisst mit andern Worten: dem Licht der Wahrheit aus dem Grunde der Liebe – und damit der Ordnung Gottes – treu zu bleiben.
Damals bedeutete für uns beide die Stadt der Grund für unsere ärmlichen Verhältnisse und der kahle Hügel bedeutete uns die äussere Erkenntnis der Wahrheit über unsere eigentlichen Verhältnisse. Wärest du auf dieser Anhöhe der freien Wahrheitserkenntnis werktätig geblieben, so würdest du auch heute noch die gleichen innern Zustände wie damals geniessen. Das heisst mit andern Worten: Hättest du unserer damaligen gemeinsamen Erkenntnis nach gehandelt und hättest nicht einer möglichen Heirat wegen um jeden Preis der Welt eine gute Stelle in der Stadt gesucht, so hättest du bestimmt ein anderes Mädchen oder eine andere Liebe gefunden, welches oder welche auf deinen aufkeimenden innern Gemütsreichtum eingegangen wäre und nicht von dir dasjenige schale äussere Lebendigsein gefordert hätte, das du nicht nur nicht besessen hattest, sondern im Grunde deines Wesens und auf Grund deiner Wahrheitserkenntnis auch gar nie besitzen wolltest. Mit andern Worten, du wärest frei geblieben für alles Bessere, das dir und deinem wahren Fortschritt in der Erkenntnis gedient hätte. Und du hättest bei einer solchen Handlungsweise das damalige Blau des Himmels als ein Zeichen und Versprechen der Treue der Wahrheit demjenigen gegenüber empfunden, der diese erkannte Wahrheit auch mit Liebe und Wärme annimmt und in seinem Gemüte lebendig aufzubewahren sucht. Dann wärest du auch über den Hügel deiner damals noch jugendlichen Erkenntnishöhe hinaus in den schützenden Wald gelangt, der mit offenen Armen dich empfangen hätte und seine Arme über dich ausgebreitet hätte wie ein Adler sein Gefieder über seine Jungen streckt. Und du hättest dich nicht gestossen an den sich wie zufällig gestaltet habenden Ästen, welche dir manchmal einen direkten Weg versperren mussten, um dich vor Unbesonnenem zu bewahren, sondern hättest in ihnen allen nur den schützenden Arm deines himmlischen Vaters erkannt, von welchem du auch heute noch – wie ich selber auch – abhängst, und auf dessen Liebsorge du noch stets angewiesen bist, wie damals. Nun hast du in der Zwischenzeit durch dein eigens gegen die höhere Wahrheitserkenntnis gerichtetes Handeln deine Lebensumstände derart erhärtet, dass dir heute das als feste und beengend begrenzte Mauer erscheinen muss, was du in deiner Jugend nur als einen schützenden Arm erkannt hättest. Begebe dich darum mit mir zusammen in deinem Gemüte mit liebevoller Fantasie hinaus auf den Hügel vor dieser Stadt und erkenne, woher der Rauch und durch ihn deine Begrenzung kommt und meide allen äussern Schall und Rauch von heute an für künftige Zeiten, so wirst du in deinem Herzen und Gemüte wieder so jung, wie du damals warst und wie ich es jetzt noch bin.
Ja, ich sage dir noch mehr: Du hast ja keinen Anhang mehr; wenn du nun mit mir zusammen die Stadt verlassen würdest und ich böte dir auf dem Lande, in meinem Hause, eine kleine Wohnung und eine deiner geschwächten Kraft angemessene Beschäftigung, so wärest du nicht nur im Gemüte, sondern auch den äussern Verhältnissen nach wieder freier. Was meinst du zu diesem Vorschlage?"
Der Bedürftige stöhnte hier tief auf und dachte eine Zeit lang hin und her. Aber er war seine Mauern gewohnt und scheute auch ein wenig die Mühe, einen Hügel zu erklimmen – wenn auch an der Seite seines Freundes. Und so sehr ihm das Licht und die Glut der Sonne gefallen hätte sowie das über die Unendlichkeit gewölbte blaue Himmelszelt, so sehr scheute er doch eine mögliche und sogar notwendige innere Anstrengung zur Überwindung seiner kurzsichtigen Denkweise. Und weil ihm seine Mauern schon so lange näher und auch schon gewohnter waren, als der kahle Hügel klarer Erkenntnis vor der Stadt und der schützende Wald der Erfüllung hinter ihm, wollte er bleiben.
Und so kam es, dass der Arme bei dieser Begegnung nur noch ärmer wurde, der Reiche im Gemüte aber nur noch reicher, indem er mit noch grösserer Dankbarkeit als bisher seiner Führung und der Wahrheit seiner ihm gewordenen Erkenntnis gedachte, sodass ihm sein Glaube und seine Erkenntnisse daraus zum ewigen Lichtblick und zum unvergänglichen Tag werden konnten.
15.5.1988
nach oben
EINE VERMESSUNGSAUFGABE  Als ich einmal als Geometer Vermessungsarbeiten im Dorfe eines schön gelegenen Tales auszuführen hatte, erlebte ich ein grosses Erwachen in meiner tiefern Erkenntnis über das Wesen der Menschen. Und das kam so: Ich begann mit meinen Arbeiten auf der nordöstlich gelegenen Talseite. Das ist jene Seite des Bergzuges, die in Richtung Südwesten gelegen ist. Also jene Seite des Tales, die mehr Sonne und mehr Licht hatte als die Gegenseite. Meine Arbeit erforderte es, dass ich in sämtlichen Parzellen Messpunkte zu überprüfen hatte, sodass ich die Häuser und Gärten aller dortigen Bewohner kennen lernte. Es waren unterschiedliche Bauten und Anlagen, die ich dort zu Gesicht bekam: Moderne, neuere und auch erhaben feudale, älteren Stils. Alle aber waren so ausgerichtet, dass der schönste und feudalste Gartenteil sowie die Hauptwohnseite talseitig gelegen waren. Eigentlich war mir diese Tatsache erst richtig aufgefallen, als ich später die andere, gegenüberliegende Talseite zu vermessen hatte. Denn eigentlich ist es ja klar, dass man seinen Garten auf der Sonnenseite und Aussichtsseite anlegt, und die nur schwach benutzten Räume auf der der Sonne abgekehrten Rückseite des Hauses.
Einige Häuser waren gegenüber dem natürlichen Terrain eher erhöht gebaut und machten auf den Betrachter darum einen mächtig erhabenen Eindruck. Die Wege, von der Strasse her zum Hause führend, waren zumeist prächtig gesäumt mit blühenden Teppichpflanzen, unterbrochen von blühenden Büschen. Grössere Bäume hatte es selten und wenn, dann eher auf der rückwärtigen Seite. Es war ein wirklich schmuckes Dorf! Alles war sauber und ordentlich und die Bewohner zumeist freundlich, wenn auch meiner Arbeit gegenüber interesselos. Das war nicht zu verwundern. Denn in einem überbauten und schon länger bewohnten Grundstück etwas vermessen zu müssen, das nicht die Grenzziehung berührte, konnte für die Bewohner ja nicht von elementarem Interesse sein.
Anders war es auf der südwestlichen gelegenen Talseite, die ja gegen Nordosten gerichtet ist und darum auch die nordöstliche Bergseite genannt werden kann. Und dennoch bemerkte ich in der Anordnung der Gärten und Häuser anfänglich keinen Unterschied. Auch da waren die Häuser eher von der Strasse hinweg gebaut, Terrassen und Balkone, sowie die Hauptwohnseiten nach der Talseite ausgerichtet. Auch diese Seite hatte ihre Reize, wenngleich die Lichtverhältnisse nicht so optimal waren und das Klima – speziell am frühen Morgen und gegen Abend hin – etwas feuchter. Diese Feuchte hatte etwas leicht klebriges, zähes an sich. Aber umso mehr waren besonders morgens das zunehmende Licht und die ersten direkten Sonnenstrahlen ein Erlebnis, das mich jeweils eine gewisse Art von Dankbarkeit fühlen liess. Denn die Feuchte bewirkte im Gefühl eine etwas kleinbürgerlich anmutende Enge, sodass dann die ersten direkten Sonnenstrahlen wie ein erlösender Zuspruch zu empfinden waren, gleichsam einer Versicherung, dass sich die Verhältnisse bald einmal bessern würden. Das war für mich ein auffallender Unterschied, den man als gelegentlicher Besucher einer Parzelle oder als blosser Spaziergänger wohl nie so eklatant empfinden konnte. So hehr und manchmal fast heroisch die Freiheit in den höher gelegenen Strassen der südlich exponierten Seite durch die Frische der Luft zu empfinden war, so war ihr Eindruck doch eher – für tief empfindende Betrachter – einem leichten Siegesrausch ähnlich, während hier, auf der Schattenseite des Tales, die Wärme der Sonnenstrahlen, welche die Feuchtigkeit verflüchtigten, eher mit dem Gefühl inniger Dankbarkeit empfunden wurden. Es kam mir auf dieser Seite bildlich beinahe so vor, wie wenn Kinder in der Not der Fremde mächtig fest zueinander stehen, was zwar eine gewisse Enge für den Einzelnen erzeugt aber ihm auch ein gewisses Geborgensein vermittelt, bis dann der Vater oder die Mutter kommt, welche mit der Wärme ihrer Liebe und ihres Verständnisses die etwas starr-klebrige Ängstlichkeit und Steifheit der jugendlichen Kinderseelen wieder zu lösen vermögen.
Gewiss, das sind tiefgehende Gefühle, die mir nicht so sehr während meiner Arbeit gekommen sind, als vielmehr nach Feierabend, in der Ruhe. Denn diese Bilder waren sehr lebendig in mir, sodass ich ihren Eindruck jederzeit in mir hervorrufen konnte und auf Grund dessen ich nach und nach zu einem immer klareren Bild kommen konnte.
Auch der Abend war hier – im Unterschied zur andern Talseite – verschieden: Auf der nach Südwesten ausgerichteten Talseite empfand man ihn eher als eine Erlösung von der mittäglichen Hitze, aber immer noch verbunden mit der Gier, die Schönheit der Natur zu geniessen. Hier, auf der nach Nordosten ausgerichteten Talseite war er eher kühl, eher abweisend, weil an die feuchte Kühle der Nacht erinnernd.
Der Mittag war auf beiden Seiten etwa gleich zu empfinden: Bei schönem, warmem Wetter etwas mühsam, und bei schlechtem Wetter war er beidseitig trüb und daher trostlos zu empfinden. Einzig die bei schlechtem Wetter hin und wieder sich zeigenden Lichtblicke fielen für das Gefühl auf den beiden Seiten unterschiedlich aus. Während sie auf der wärmeren Talseite als erlösend wirkten, sodass man aufatmen und es wieder etwas gelassener betrachten konnte, glichen sie in ihrer Wirkung auf das Gefühl auf der kühleren Seite eher einem Aufflammen der Hoffnung, welche den Menschen in seinem Ernst und Durchhaltewillen bestärken kann. Denn das Licht oder die vereinzelten Sonnenstrahlen trafen ja hier immer vor allem die gegenüberliegende Talseite, sodass dieses Licht eher als ein Versprechen besserer Zeiten empfunden wurde, als eine direkte Genugtuung für die bis dahin entgangene Wohltat des wärmenden Sonnenlichtes.
In meinen diesbezüglichen Betrachtungen meiner Empfindungen nach Feierabend oder auch an Sonntagen zeigte sich mir immer mehr, dass die natürlichen Bilder und die Gefühle, die sie in einem aufmerksamen Betrachter hervorrufen, jenen Gefühlen in der menschlichen Seele entsprechen, die sie in entsprechend seelischen Situationen ebenfalls empfindet. So sind Menschen auf der Schattenseite ihrer gesundheitlichen oder gesellschaftlichen Stellung oft ebenfalls gehemmter, sich weniger öffnend, weniger mitteilsam als Erfolgsgewohnte. Sie sind auch vorsichtiger, zaghafter und ängstlicher, oft auch misstrauischer gegenüber scheinbar grosszügigen Gelegenheiten, die sich ihnen bieten. Manche sind allerdings auch kälter. Nur im Extremfall innerer oder äusserer Vorkommnisse und Verhältnisse können sie verzweifelter und darum dann auch angriffiger und aufsässiger werden, während umgekehrt die Erfolgreichen auf der Sonnenseite ihres gesundheitlichen und gesellschaftlichen Lebens in einer ähnlich extremen Situation anstatt mitteilsamer und offener nur bornierter und abweisender gleichsam kalt gegenüber andern werden können, so gerne sie sich sonst gegenüber andern im Allgemeinen gelassen und zugänglich geben können. Wie interessant ist doch diese Übereinstimmung äusserer und innerer Begebenheiten! Die Armut schweisst die Menschen in ihrem gemeinsamen Leiden oft – wenn auch wortlos – zusammen wie die klebrige Feuchte des Abends auf der Schattenseite eines Tales die Halme der Gräser, während anderseits der Reichtum die Menschen eher voneinander abhebt, sie trennt und vereinzelt zu eigenständigen und selbstbewussten Individuen, welche die Gesellschaft eher dazu brauchen, um nicht allzu sehr isoliert zu sein.
Das alles ist mir noch in vermehrtem Masse augenfällig geworden, als ich bei meiner Vermessungsarbeit mit der Zeit in die Nähe einer Parzelle kam, welche allen bisher erlebten Tendenzen zu widersprechen schien.
Sie lag nahe an der Talsohle eines hügeligen Gebietes, welches sich an jener Stelle nur allmählich aus der Ebene zu erheben begann und an deren Anstiegsbeginn eben die Strasse entlang führte. Da fiel mir jedes Mal bei der Vorbeifahrt zu den äussern Parzellen dieses Gebietes ihr Parkplatz auf. Während alle andern Häuser oder Parzellen einen ebenen Platz vor dem Hause hatten oder gar nur eine Garageeinfahrt in die Tiefe des Untergeschosses, so wies der ungewöhnlich grosse und geräumige Parkplatz dieser Parzelle oder dieses Hauses schon eine ungewöhnliche Form auf, indem er als ein Dreieck, mit seiner längsten Seite der Strasse entlang gelegen, ausgebildet war. Kam man von der Dorfseite zu dieser am Dorfrand liegenden Parzelle, so erblickte man in der Fläche des hier leicht ansteigenden Geländes einen schönen Gebüschstreifen mit teils höheren Nadelbäumen durchsetzt, der sich, quer zur Strasse verlaufend, die Geländehöhe hinaufzog. Fast übersah man seiner Fülle wegen das kalksteinfarbene Haus am Ende dieses Streifens trotz seiner leuchtend weissen Fensterkreuze und seinen goldgelben Klappläden. Noch mit dem Betrachten der abwechslungsreichen Pflanzung beschäftigt, wird man von einem geräumigen Parkplatz hinter dieser schönen und freundlich jugendlich erscheinenden Pflanzung überrascht. Er ist mit einer hellen Granitsteinpflästerung belegt und verschmälert sich mit seiner Länge zu einem spitzwinkligen Dreieck, an dessen Ende ein mit rötlichem Naturstein gepflästerter Weg, vom höher gelegenen Hause herkommend, einmündet. Woher er kommt, sieht man allerdings beim Vorbeifahren kaum, weil die hintere Begrenzung dieses dreieckigen geräumigen Parkplatzes stark angeböscht ist und mit hohen, stattlichen Nadelbäumen verschiedenster Art bepflanzt ist, deren verschiedenfarbiges Grün eine fast einladende Abwechslung bietet, ja fast einer überraschenden Einladung gleichkommt, in dieser herrlichen "Bucht" etwas auszuruhen. Es quillt einem von dieser Seite sowie von der Rückseite des zuerst beschriebenen Gebüschstreifens eine solche Fülle entgegen, die aber zugleich auch eine gewisse fast majestätische Zurückhaltung erkennen lässt, sodass man sich bei seiner Betrachtung vorkommen kann, wie einer, der entlang eines eher armseligen Uferverlaufes jenes Stromes, auf welchem sein Schiffchen treibt, endlich eine ruhige Landebucht findet, an deren Ufer eine Menge ihn erwartender Menschen stehen. Menschen voller Herzlichkeit und voller Drang, dem Bedürftigen zu helfen, aber dennoch mit grösster ordentlicher Zurückhaltung stehen bleibend, bis dass der so ans Ufer Gelangte sie um Hilfe angeht. Eine solche Fülle umgibt diesen ruhigen Platz, dass man sich kaum bewusst werden kann, weshalb er so traut, so still und so ruhig auf das Gemüt einwirken kann. Jedenfalls war mir sein Eindruck, den er auf mich machte, bei jeder Begegnung meiner Fahrten zum jeweiligen Arbeitsplatz eine Erholung, eine Erfrischung und immer wieder eine mir unverständliche Überraschung. Vom freien Feld ausserhalb des Dorfes herkommend erschien er einem eher als eine Einladung, ja fast Verführung, sein Auto dorthin zu lenken als der Strasse entlang – eben weil er ja mit seinem Spitz mit der Strasse so zusammenlief, dass sich von dieser Seite her Strasse und Parkplatz in ihrem Raum zu teilen beginnen.
Vom Lande, das hinter dieser Parkbucht liegt, sowie vom Hause selbst sieht man überhaupt nichts. Denn zu dicht – trotz seiner lichten Erscheinungsweise – standen die Büsche und Bäume; und auch von der Dorfrandseite her zog sich ein zwar völlig anders gestalteter, aber ebenso dichter Streifen Nadelbäume und kleinerer Sträucher quer zur Strasse den Hang hinauf. Nur die Giebelseite des Hauses mit seinem gelblich-kalksteinfarbenen Verputz und seinen sonnengelben Fensterläden sah man von dieser Seite her etwas besser.
Vor der Parzelle stehend sah ich es erst, als ich dann eines Tages mit meiner Vermessungsarbeit zu dieser Parzelle kam. Denn der mit kleinen, rötlichen Natursteinen gepflästerte Weg, der mit nur ganz unbedeutenden seitlichen Schwüngen direkt zum Hauseingang führte, war nicht breit, aber in seinem Anfang leicht in das Terrain eingeschnitten, sodass man schon vor ihm stehen bleiben musste, um von der Strasse her wenigstens einen Teil der Länge des Hauses sehen zu können. Von diesem Standpunkt aus hatte man auch das Gefühl, in ein fremdes Eigentum zu dringen, wenn man diesen Weg unter seine Füsse nehmen wollte. Denn gleich neben der Strasse, dort wo die rückseitige Begrenzung des Parkplatzes mit seinen hohen Nadelbäumen die Strasse fast erreicht und wo der Weg zum Hause beginnt, oder einmündet, steht als erster Baum der Bepflanzung eine mächtige amerikanische Tanne, die mit ihren weich benadelten aber weit ausladenden Ästen den Aufgang weitläufig überdeckt. Fühlt man sich auf dem Parkplatz schon wie in einem sicheren Hafen, so empfindet man diese über den ganzen untern Teil des Aufganges ausgebreiteten Äste der Tanne wie ein stillschweigendes Behütetsein vor den Unbilden der Zeit. Wie eine Segenszusicherung für jene, die sich auf dieses Grundstück begeben. Steht man dann vor der Haustüre und wartet nach dem Klingeln, bis geöffnet wird, schaut etwas um sich und vielleicht auch einmal zurück, so kommt es einem vor, als stände man in einer völlig andern Gegend. Der über den Parkplatz um etwa zwei Meter erhöhte Garten ist hier in flache Beete eingeteilt in welchen Beerensträucher und Kräuter gepflegt werden, die aber ringsum eingerahmt von Bäumen und Sträuchern sind, sodass man das Gefühl bekommt, in einer Waldlichtung zu sein. Denn die Pflanzung ist so natürlich, dass man sie nicht als einen Garten empfindet, sondern als naturgegeben. Der Weg, zurück zur Strasse hin betrachtet, gräbt sich durch diese schön kultivierte Ebene des Gartens hindurch zur Strasse hinunter, überschattet von den weit ausladenden Ästen der Tanne. Die Strasse selbst ist nur so breit der Weg ist, zu sehen.
Der Hausherr, der mir öffnete, hatte einen stark prüfenden Blick und einen gewissen zwar nicht unfreundlichen aber dennoch beharrenden Ernst in seiner ganzen Erscheinung. Als er erfuhr, um was es sich handelt, lockerte sich sein Ernst etwas, indem er ja wusste, dass eine Vermessung in diesen Tagen stattfände. Er fragte mich, ob er mir behilflich sein könne, worauf ich ihm antwortete, dass ich schon zurecht käme. Als ich an der Arbeit war, kam er vom Hause her durch den rückwärtig angelegten Garten auf mich zu und fragte mich, ob ich nichts dagegen hätte, wenn er mir bei meiner Arbeit zusehe. Natürlich hatte ich nichts dawider, obwohl es für mich ungewohnt war, dass sich jemand für meine Arbeit interessiere. Im Verlaufe der Arbeit fragte er mich über dies und jenes meiner Arbeit, und ich selber fragte ihn um die Namen und die Herkunft einer oder der anderen Pflanze dieses parkartig angelegten Gartens. Und so ergab ein Wort das andere, bis wir etwas tiefer in die Wesenheit der Landschaft und der Menschen gerieten, sodass er zu mir sagte: "Es ist interessant, was da noch alles zu überlegen wäre. Aber ich fürchte, ich halte Sie damit bei Ihrer Arbeit auf. Wenn Sie aber Lust haben, so können wir nach Beendigung Ihrer Arbeitszeit noch etwas miteinander plaudern.
Was ich dann, nach Feierabend, mit ihm zusammen alles besprach und was er mir zeigte, war ebenso überraschend für mich wie sein Parkplatz an der Strasse, als ich ihn die ersten Male sah. Nicht, dass er mir grundlegend Neues erzählte. Denn Ahnungen hatte ich ja schon lange über so manche Erscheinungen, welche normale Alltagsmenschen unbeachtet lassen. Aber die Prägnanz seiner Vergleiche und Schlussfolgerungen waren umwerfend; waren so einmalig, dass ich mir oft wünschte, es gäbe eine Lehranstalt, in welcher dieser als Lehrer tätig wäre, sodass ich noch möglichst lange aus seinem Reichtume schöpfen könnte.
So sagte er unter anderem auf mein Bemerken über die mir aufgefallenen Unterschiede der beiden Talseiten Folgendes: Bei einiger Übung sei es sehr leicht, den Charakter der Leute an jener Linie zu erkennen, nach welcher sie sich vorzüglich ausrichten. Die Schwierigkeit begänne erst da, wo eine äussere Linie eine innere überschneidet. So sei es bei der anfänglichen Besiedlung eines neuen Ortes normal, dass die Helleren, Aufgeweckteren und darum auch oftmals Reicheren bald merkten, wo sich am ehesten ein wohnliches Zuhause einrichten liesse: am Südhang. Es sei nur klar, dass man dann, wenn man an einem Südhang baue, seine besten Zimmer gegen Süden richte, während man die übrigen an der Nordseite des Landstückes platziere. Für ein solches Vorgehen spräche nicht etwa nur die Sonne, sondern ebenso sehr die so beliebte Fernsicht. Aber an einem Südhange seien darum auch alle Strassenbenützer immer möglichst weit unter dem Aussichts- und Standpunkt der bergseitigen Anwohner, befänden sich jedoch talseits dann nur auf der Rückseite ihrer Wohnstätten. Da aber jedermann erstens gerne über die andern hinwegsehen möchte und zweitens lieber hat, dass sich die andern mit ihren Gesichtern zu ihnen kehren als von ihnen – ihnen dabei den rückwärtigen Teil überlassend oder vielmehr zukehrend, so sei es klar, dass sie, falls sie ebenfalls einmal zu einem eigenen Heim gelangen sollten, ebenso bauen würden: nämlich so weit als möglich über den andern stehend oder dann – unterhalb der Strasse – den Passanten eben den Rücken zukehrend. Das sei die eine, und zwar die zumeist wichtigere Linie der menschlichen Ausrichtung; jene auf das Gesellschaftliche bezogene, der zufolge sie dann auch auf der Nordseite dasjenige ausführen, was sie auf der zuerst bebauten Südseite erlebt und erfahren haben. Die erste, die wohl vernünftigere und natürliche Erkenntnis- und Ausrichtungslinie menschlicher Überlegungen und Handlungsweisen, sein Heimwesen nach der Sonne auszurichten würde von diesen gesellschaftlichen Aspekten also zumeist voll überdeckt. Diese Feststellung gelte nicht nur für die nordseitigen Bewohner, sondern zumeist ebenso für jene der Südseite. Nur würden sie dort nicht offenbar, weil sich da beide Linien eben überdecken, sodass man nicht mit Sicherheit sagen könne, welche Gründe für die Handlungsweise ausschlaggebend waren. Denn die Menschen mässen sich und ihren Standpunkt leichter und eher an ihresgleichen anstatt an ihren wirklichen Bedürfnissen und Notwendigkeiten. Viel wichtiger sei ihnen, wie sie in Beziehung zu andern stehen, als in Beziehung zu ihren Möglichkeiten, zu möglichen Idealen. Und weiter erklärte er mir: "Darum gleichen sich die Menschen auch derart wie ein Ei dem andern. Zwar weniger in ihren verschiedenen Talenten, als vielmehr in ihrer Neigung, zu was sie ihre Talente brauchen – oder vielmehr missbrauchen. Wenn jeder der Vorderste sein will, so brauchen alle Läufer ihre Beine nicht etwa, um jemandem zu Hilfe zu eilen, sondern bloss dazu, möglichst vorne zu sein; etwa so, als hätte man seine Beine vorzüglich nur dazu. Dabei ist es dann gleichgültig, ob sich dort vorne Besseres oder Schlechteres oder gar ein Abgrund befindet, der alle solchen kopf- und gemütlosen Vorschnellen verschlingt. Es genügt solchen zur Motivation ihres Tuns, dass alle jene Richtung bevorzugen.
Jene, die ihr Talent eher in der Überlegung haben, als in ihren Beinen, erkennen leicht, dass sie da nicht vorne sein können. Und dennoch wollen auch sie ihre Talente nur dazu benützen, möglichst vorne zu sein. Darum scheren sie mit einem gewissen Selbstbewusstsein aus einem solch allgemeinen Zug der Menschen oder der Gesellschaft aus und gehen quer dazu – wieder nicht, um jemandem behilflich zu sein, sondern nur um ihr Ziel, Erste zu sein, zu verfolgen. Das verunsichert jene, die schwächer sind in der Kraft ihrer Beine oder in ihrem Urteil; und sie beginnen dann, diesen nachzulaufen. Auf diese Weise laufen oder stürmen alle kreuz und quer, aber alle nur mit dem gleichen Ziel: vorne zu sein. Wäre es da nicht wahrhaft vernünftiger, zu versuchen, sich abzuheben; eine solche Primitivität zu überwinden; zuzugeben, dass man nicht fähig ist, urteilsfrei zu werden, und nach Mitteln und Möglichkeiten zu suchen, die uns wahrhaftig weiterbringen – zur Wärme der Liebe und Anteilnahme und zum Lichte der Weisheit zu gelangen, als in einer dummen und urteilslosen Masse zuvorderst zu sein? Drängt doch schon physikalisch gesehen jede Masse, sofern sie mehr oder weniger mobil oder flüssig ist, dem Mittelpunkt der Erde, oder mit andern Worten dem Abgrund zu. Warum also in einer solchen Masse mitmachen – und warum gar noch als Beschleuniger?! Der Reiz, das zu tun, liegt wohl darin, dass die meisten Menschen nur vom Materiellen, von der Masse, angesprochen werden, weil sie keine innere Wahrnehmung haben, sodass ihnen Werte wie 'Ordnung', 'Helfen' und 'dem Höheren Dienen' völlig mangeln. Da bleibt ihnen eben nur die äussere Erscheinung, die materielle Masse als Massstab und als Anreiz zu irgendeiner Tätigkeit übrig. Und das umso mehr, als Menschen, die eher ihren innern Wahrnehmungen ihre Aufmerksamkeit schenken, sich darüber kaum verlauten lassen und man darum die schönen und edlen Gedanken nur bei den Wenigen mit den materiellen Augen sehen kann, die die Fähigkeit haben, ihre erhabenen Vorstellungen in ein äusseres Werk zu setzen. Während all jene vielen, die ihre innersten Gedanken zwar ebenfalls wahrnehmen, aber nicht im Äussern zu verkörpern verstehen, im Blickwinkel normaler Menschen natürlich ebenfalls nur die äusserlich erscheinende Masse vergrössern. Dadurch bleibt das Edle, das Ideal vor den Blicken der Dummen verdeckt und verborgen, weil Dumme – wie Blinde – alles erst erkennen, wenn sie es betasten können, weshalb sie auch mit Überzeugung ausrufen: 'Wir glauben nur, was wir sehen können!' Dabei sehen sie ja eben nichts! Sie spüren nur den Zug der Masse; die Masse hören sie zwar, aber nicht ihren Zug und seine Richtung. Die Idealisten hingegen sehen das schon, aber zum Betasten kommen sie in ihrem oftmaligen Übereifer nicht, weil man Licht und Wärme nicht betasten kann. Anderseits geschieht natürlich auch einem Blinden wohl, wenn ihn die Sonne bescheint. Aber weil er sie nicht sehen kann, weiss er nicht, weshalb ihm so wohl geschieht und er kennt darum auch die Umstände nicht, die erforderlich sind, dass er von ihr beschienen wird. Darum kümmert er sich nicht um die Sonne; sie steht ihm zu weit ab! Die Andern hingegen, also seinesgleichen, kann er betasten. Sie sind für ihn Realität! Denn er hört ihre Schritte und ihr Geschrei und geht ihnen nach. Dabei ist die Körperwärme der andern, wenn er sie im Gedränge empfinden will, einengend, während die Sonnenwärme befreiend wirkt – besonders auf ein erstarrtes Gemüt. Aber eben – weil man das Wesen der Sonne als Blinder ebenso wenig erkennt wie ein blosser Verstandesmensch das Wesen Gottes, so bleibt die Sonne oder das Wesen Gottes ebenso wie die Wahrheit für die meisten ein nicht berechenbares 'Etwas', wo hingegen die menschliche Nähe sehr einfach gefunden werden kann, gleichgültig, ob sie einem dann auch nutzt oder eher schadet. Sie engt den Horizont zwar ein, dafür vermittelt sie ein Gefühl der Dynamik. Darum heben sich so wenig Menschen ab vom Sumpf der Masse, vom Materiellen, Zeitlichen, Vergänglichen. Und darum bauen sie auch auf der Nordseite ihre Wohnstuben talseits; richten sie mit andern Worten nach dem tiefsten Punkt aus, anstatt nach dem wohltätigsten Punkt – der Sonne, als Spenderin von Licht und Wärme und damit von vegetativem Leben."
In dieser Art erzählte mir der Mann von seinen Erlebnissen mit Menschen und beschrieb mir ihr Wesen und die Folgen davon, die sich mit meinen Wahrnehmungen zwar deckten, sie aber plastischer erklärten, als ich es hätte tun können.
Erst nach tieferem Nachdenken darüber – in den folgenden Tagen – begann ich die Art der Gestaltung seines Gartens besser zu verstehen: Er hatte in seinem Wesen einen ebenso stillen, etwas abgeschiedeneren Ort wie in seinem Garten der Parkplatz war, welcher Aufmerksame einladen konnte, eine Zeit bei ihm zu verweilen. Obwohl man weder bei ihm selber noch bei seinem Parkplatz direkte Einsicht in seinen Garten oder in sein ganzes Gemüt nehmen konnte, spürte man sofort das geordnete und darum überzeugende Lebendige, einen Liebeernst.
Sein Wohnzimmer hatte er nach der Sonne und damit bergwärts gerichtet, abgewandt vom Tale und der Welt. Und sein eigentlicher, eher parkartig, aber natürlich gestalteter Garten entfaltete sich so richtig hinter seinem Hause, also südwärts, bergseitig und dem Lichte zu. Und doch war der prächtig und abwechslungsreich gestaltete Nadelbaumstreifen oberhalb des Parkplatzes mit seinem immergrünen Kleide nicht ein nebensächlich erscheinender Teil seines ganzen Gartens, auch nicht eine blosse Trennung vom Weltverkehr zu seinem eigentlichen Wesen oder Garten, sondern ebenso ein vorzüglicher Auffang und Widerstrahler der mittäglichen und abendlichen Sonnenstrahlen, die er in vielfältig nuancierten Grüntönen auf die Beete seines kleinen Hausgartens zurückwarf, der zu dieser Zeit zu einem grossen Teil im Schatten seines Hauses gelegen war, sodass er nun freundlich und hell anzusehen war, ohne die volle Glut der Mittagshitze erdulden zu müssen.
An jenem Abend sassen wir eine Weile lang auf der Sitzbank vor jener Seite des Hauses, die dem Hausgarten und der Strasse zugekehrt war, und befanden uns also dabei im Schatten des Hauses. Da hatte ich Gelegenheit, die Pracht dieses Nadelbaumstreifens zu erleben, wie er in seinen hellgrünen Jungtrieben goldengrün in den rötlichen Strahlen der Abendsonne aufleuchtete. Durch die relative Nähe des Gehölzstreifens zum Haus bedingt mussten wir unsere Blicke ordentlich gegen den Himmel zu erheben, wollten wir dieses Panorama voll überblicken. Dabei empfanden wir die ineinander verwachsenen Kronen der Bäume fast wie aufgetürmte, von der Sonne beschienene Wolkenberge, deren leuchtende Kraft je nach der Gestaltung der Baumkronen zu- und abnehmen konnte, sodass man bei einem längeren Betrachten wirklich nur noch einzig mit dem goldenen Licht der Abendsonne (aus den Kronen zurückstrahlend) und dem tiefen Blau des abendlichen Himmels verbunden war, der erst in der seitlichen Ferne von einigen hin gehauchten, rotgolden leuchtenden Dunstwölkchen geziert war. Ohne dass man wollte, war man nur noch mit diesem Anblick beschäftigt, der das ganze Blickfeld einnahm, einmal von den Beeten des bereits im Dämmerschatten ruhenden kleinen Hausgartens abgesehen.
Der Hausherr beschrieb mir dabei, wie er seit der Zeit der Pflanzung dieses Streifens sehnlichst auf das Jahr gewartet habe, in welchem seine Bäume mit ihren Spitzen über den fernen Horizont der südlichen Talseite hinaus endlich einmal den Himmel berühren würden. Denn dann sei sein Wunsch – wenigstens bildlich – erfüllt, dass sein ganzes Hauswesen mit dem Himmel verbunden sei. Und nun standen die mächtigen Kronen von unserem Sichtwinkel her gesehen mit ihrem grösseren Teil fest mit dem Himmel verbunden da. Ein wahrhaft empfindungstiefes Erlebnis für einen im abendlichen Schatten des Hauses sitzenden Betrachter. Wie ferne, weil von den Baumkronen verdeckt, war von diesem Platze aus gesehen die ganze Welt der jenseitigen Talseite. Wie schön der Gedanke, dass sich dieselbe lebendige Wand zum Auffange und zur Widergabe des Lichtes für ihn und sein Hauswesen eignete und trotz der Begrenzungsaufgabe zur öffentlichen Strasse hin die Benutzer seines Parkplatzes anderseits vor der glühenden Mittagshitze zu schützen vermochte, sodass sogar immer wieder auch einmal Fremde den Parkplatz benutzten – wie er mir erzählte –, die nicht ihn, sondern einen seiner Nachbarn besuchen wollten. Sie hatten zwar den kleinen materiellen Nutzen des Schattens, aber den grossen innerlichen Nutzen der Erkenntnis einer solchen Ordnung oder Anordnung ahnten oder erkannten sie nicht und hatten ihn darum auch nicht. Seine Ordnung aber versuchte er nach der Ordnung Gottes einzurichten, die er sowohl in der Natur wie in seinem Worte erkannte, und die er jedem gerne zukommen liess, der sich dafür interessierte. Das sagte er mir nicht nur, sondern er tat es auf eine für mich beeindruckende und belebende Weise.
15.6.2007
nach oben
|