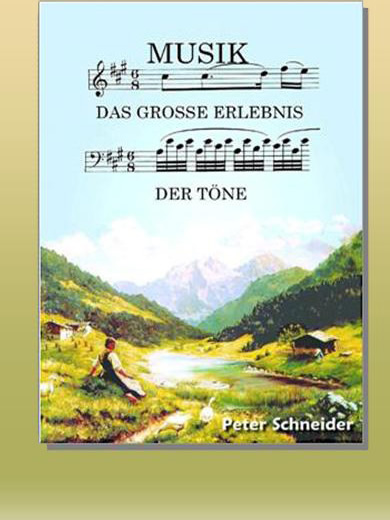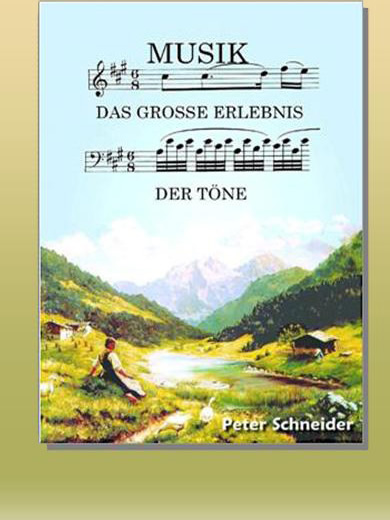Der Vielklang und seine Harmonie
VOM WESEN DER MUSIK UND SEINER WIRKUNGSWEISE AUF UNS  Musik, Musik und wieder Musik! Aus dem Radio, aus dem Grammophon, im Warenhaus, bei der Arbeit, beim Mittagstisch, am Abend, auf Plätzen, bei Partys – zum Einschlafen und zum Wecken ebenso zu gebrauchen, wie zur Vertreibung von Langeweile oder Einsamkeit. Ist das alles wirklich Musik?
"Ratternde Motoren sind Musik in meinen Ohren!" rief einmal ein Technikbegeisterter. Was ist in diesem Falle Musik? – Ein Befriedigungsmittel, ein Betäubungsmittel, ein Suchtmittel, eine Pille für die kranke Seele?
Heute ist Musik bestimmt eine Ware, weil heute alles zur Ware geworden ist, womit sich ein Geschäft machen lässt. Und "Ware" ist gleichbedeutend mit Umsatz. Man setzt die Ware um – und das geschieht, indem man sie vernichtet. Ohne Vernichtung kein Umsatz! Das wussten schon die Menschen der frühesten Zeit, allerdings nur die Reichen, weil nur sie die Möglichkeit besassen, trotz immenser Vernichtung stets Neues zu erwerben. Da waren die Grossbürger, welche das Geld für ihre äusserst vergänglichen Vergnügen brauchten. Sie verheizten damit nicht nur die durch Mühsal, Schweiss und harte Arbeit zustande gekommene Ware, sondern dazu auch noch gerade die Menschen selbst, die sie erzeugen mussten, als leicht zu beschaffende Sklaven, als Soldaten, als Diener (wenn es etwas besser zu und her ging), oder auch als Dirnen. Das alles wurde umgesetzt und dadurch (in seiner Existenz) vernichtet. Es hatte ja genug davon – am Einzelnen konnte deshalb ja nichts gelegen sein. Ebenso war und ist es auch heute wieder mit dem Essen: Möglichst viel und verschiedenes davon – und möglichst schnell wieder aus dem Leibe, damit es Platz für Neues gibt, für Anderes, noch nicht Gehabtes, sodass es einem nicht langweilig wird. Das also ist die Ware! In der heutigen Überflussgesellschaft gehört beinahe alles dazu, was überhaupt zu haben ist. Beispielsweise die Kleider, welche nicht mehr warm geben und den Körper schützen müssen. In den wohlgeheizten bis überheizten Räumen brauchen wir das alles nicht. Vielmehr brauchen wir Abwechslung, auch etwas, das uns schmeichelt; uns besser scheinen lässt, als wir sind und uns begehrenswert macht – etwas, das die Blicke auf uns konzentriert, darum also stets Neues, bevor das Alte unbrauchbar geworden ist. Das ist mit den Ferien so, mit den Möbeln, mit den Fotokameras, mit den Spielzeugen der Kinder und der Erwachsenen. Ja, das ist auch mit der Sprache so, ob sie uns in Zeitungen, Zeitschriften, Büchern, am Radio, im Fernsehen oder gar am Telefon begegnet, oder mal einfach bei einem "Schwatz". Wir brauchen sie nicht deshalb, um einander tief greifende Probleme und Zusammenhänge aufzudecken – selbst wenn wir solches berühren; nicht, um tiefe Not zu schildern oder um tiefe Not zu lindern, sondern ganz einfach um die Zeit angenehmer zu vertreiben, um nicht alleine zu sein, um nicht uns selbst ausgeliefert zu sein, denn unser Selbst ist – so vieler Konsumation von Ware wegen – ebenfalls zu Schrott geworden! Da ist kaum ein Gedanke in uns, der es wert wäre, weitergegeben oder in die Tat umgesetzt zu werden – der fähig wäre, auch nur einem einzigen Menschen etwas Wirkliches zu geben – geschweige uns selbst; deshalb unser Suchen in den Gedanken anderer und das Aufatmen bei der Erkenntnis, dass auch der Andere nichts Besseres hat. Ist diese Erkenntnis doch die beste Entschuldigung für unsere innere Armut, den Notstand unserer Seele.
Der Musik, als Sprache der Töne, kann es dabei doch nicht anders ergehen – und es ist ihr auch nicht anders ergangen! Über was also sollen wir uns Gedanken machen in Bezug auf sie? Über die Ware, oder über den Schrott, der einmal "Ware" war? Das wäre sehr schwer zu entscheiden, denn im Prinzip kommt es auf dasselbe hinaus, nur müssten wir einmal in der Gegenwart reden oder denken, und das andere Mal in der Vergangenheit – ich glaube, das wäre der einzige Unterschied, und die Frage bliebe offen, zu was das Ganze eigentlich nütze ist.
In diesem Dilemma ist es vielleicht nicht unklug, einmal zu sich selber zu finden – zu jenem Objekt also, das in seiner Subjektivität alle Objekte als Ware und künftigen Schrott zuerst zu sehen, und danach zu behandeln begann.
Dazu brauchen wir die Stille, die Ruhe, weil wir erst in ihr zu merken beginnen, wo sich unser Gemüt zu einer Forderung erhebt und wo und was es dabei etwa loswerden will. Können wir just diese Stille nicht mehr aushalten, dann erkennen wir daraus die uns beherrschende Leidenschaft, welche begehrt und fordert und uns unfähig macht, in Geduld das Abgängige zu suchen, zu erwarten und in Dankbarkeit jede erfolgte Bereicherung anzunehmen und in voller Hoffnung sie bereitzustellen für die Zeiten der Not – entweder unseres eigenen Zustandes, oder als Aufbaustein für unsere Nächsten. Um aber wieder wirklich und wahrhaft uns selbst werden zu können, müssen wir diese Forderung der Leidenschaft in uns längere Zeit unbeachtet lassen – der Leidenschaft Bedürfnisse unbefriedigt lassen, und sie dadurch aushungern, damit sie uns verlässt. Wie jung und kräftig werden wir dann unsere Seele finden, wenn wir das bewusst und ohne Not getan haben. Wer aber durch Krankheit, Entbehrung, innere und äussere Not erst dazu gekommen ist, fühlt sich dabei allerdings zwar wohl schwächer, aber dennoch vor allem frei, und zu einem hoffnungsvollen Aufbau fähig, der den Geist stärkt und unserer Seele dadurch Ruhe verschaffen kann.
Erst damit haben wir wieder einen eigentlichen Bezug zur Musik! Erst dadurch wird sie uns wieder wirklich zuteil – und wir selber sind sogar ein Teil von ihr, weil zwischen uns und der Musik doch ein Verhältnis bestehen muss, wenn das Hören nicht nur blosse Konsumation von Ware sein soll. Die Musik soll uns dasjenige geben, das uns fehlt und wonach wir Verlangen in uns verspüren, wenn wir sie hören wollen – oder dann soll sie die Überfülle unserer in uns reif gewordenen Gedanken und Gefühle ans Tageslicht bringen und dadurch andern zugänglich machen, wenn wir sie spielen, damit ein Ausgleich stattfinden kann. Etwa gleich, wie es auch unsere Sprache zu tun vermag, nur mit dem Unterschiede, dass allzu tief Gefühltes – weil bloss Geahntes – sich nicht ebenso gut in Worte kleiden lässt wie in die Töne der Musik. Denn diese fassen mehr als Worte und zergliedern das grosse Bild der Gefühle nicht so, wie es die Wort-Sprache tut. Also wollen wir vorerst zu erkennen versuchen, wie die Töne der Musik auf uns einzuwirken vermögen und welche Gefühle sie in uns wachzurufen imstande sind – welchen Gemütsregungen sie entsprechen. Die Musik wird aber durch die Erklärung solcher Entsprechungen nicht schöner, auch nicht voller oder erlebnisreicher; aber das Leben selbst wird dadurch musikalischer, harmonischer, ausgeglichener, ja himmlischer, wenn wir diese Sprache (der Entsprechungen) zu verstehen beginnen und sie dabei so lieb gewinnen, dass wir sie in unserm täglichen Leben bewusster nachzufühlen beginnen, und unsere Liebe, welche daran einen Gefallen findet, sie so stark in sich aufzunehmen beginnt, dass sie sich selbst nach ihren Gesetzen der Harmonie zu gestalten anfängt – aus freier Lust und Liebe zum Guten, das darin liegt, und nicht aus einem gesetzlichen Muss. Dann sind wir dem Himmel näher, oder er beginnt in uns sich zu gestalten.
Wenn wir, durch diese Vorbetrachtungen etwas vertiefter fühlend, die Orte betrachten, an welchen wir die Musik schon gehört haben, so erkennen wir alleine schon in den äussern Bedingungen starke Hemmnisse – oder umgekehrt auch Hilfen – bei ihrer Aufnahme durch unser Ohr; ganz abgesehen natürlich davon, dass diese äussern Bedingungen auch auf die Aufnahmefähigkeit unseres Gemütes direkt einwirken. Wie ganz anders kommt uns doch die Musik auf Strassen und Plätzen entgegen, als in Räumen oder Sälen. Der Klang der Töne einer Musik braucht Raum, braucht Sammlung – einen Widerhall. Das erkennen wir leicht, wenn wir die Wirkung der Töne, auf denselben Instrumenten gespielt, unter den verschiedenen äussern Bedingungen betrachten. Dieselbe Feststellung der Notwendigkeit des Raumes und des durch seine Wände erfolgten Widerhalls aber können wir auch in Bezug auf uns selbst machen: Je ruhiger, stiller und wunschloser wir sind, desto bedeutungsvoller klingen die Töne in uns hinein; und je dankbarer wir über das Empfangene werden, desto mehr hallen und "beben" die Töne im grossen Raume unserer Dankbarkeit, gleichsam, als würden sie selbst ergriffen, anstatt wir. Die Dankbarkeit ist jene Erregung in uns, welche auf Grund der Erregung der Töne unser Leben und Fühlen wach und tätig werden lässt, und diese Miterregung oder dieses Mitschwingen ist das Echo – unser Echo auf die Töne, welche dadurch nochmals verstärkt in uns anklingen, wie wir das entsprechend aus den gut gebauten Konzertsälen kennen. In diesem Gefühl des Mitschwingens erkennen wir ein Zustimmen, ein Einswerden aus unserer Hingabe an das Empfangene. (Es versteht sich von selbst, dass dabei nur von einer dem jeweiligen Hörer entsprechenden und dadurch zusagenden Musik die Rede sein kann.) Wir gewähren damit der Musik Raum in uns selbst, und erst durch dieses "Raum-Geben" (auch: Zeit-Geben) ist eine Aufnahme, und damit eine Bereicherung, möglich. Nicht nur, dass wir die in der Musik verborgenen Gedanken, Gefühle und Bilder in uns aufnehmen, ist eine Bereicherung, denn zumeist sind es ja Gedanken, Gefühle und Bilder, die wir kennen, weil uns sonst die Musik fremd vorkommen müsste. Nein, wir erfahren bei solch hingebungsvoller Aufnahme zugleich eine unendliche Bereicherung unserer eigenen Gedanken, Gefühle und Bilder, indem wir aus grösstmöglicher dankbarer Hingabe die bis jetzt schon gehabten und nun durch die Musik neu erweckten oder beleuchteten Gedanken, Gefühle und Bilder durch unsere Zurückgezogenheit vergrössern und dadurch auch bis in die kleinsten Einzelheiten verdeutlichen, sodass dieselben nach der Aufnahme der Musik noch viel gewichtiger, reichhaltiger, belebender und auch beseligender werden in ihrer Wirkung auf unser Gemüt.
Oftmals kann man Vorgänge in der Musik, aber auch in unserm Gemüte, am einfachsten an visuellen Erlebnissen verdeutlichen. Und so nehmen auch wir ein Beispiel aus dem visuellen Bereich – aus der Optik –, um uns das bisher Gesagte so recht anschaulich verdeutlichen zu können: Der heutige Mensch, welcher alles als Ware betrachtet, alles konsumiert – wobei jede Konsumation natürlich auf ihn selbst bezogen ist – gleicht nicht nur in der Form seines Bauches, sondern in seinem ganzen Wesen einer Kugel, wo ebenfalls um ein Zentrum – entsprechend dem Ego des Menschen – Vieles gelagert ist. Weil aber der Wert der einzelnen Ware überhaupt nicht mehr unterschieden wird, oder mit andern Worten alles gleich stark an sich gezogen wird, so ergibt sich um dieses Zentrum ein mehr oder weniger kugelförmiges Konglomerat von allerlei Ware. Der prallen Fülle dieser Kugel entspricht in der Optik eine glatte Oberfläche. Die oftmals zu der Fülle sich gesellende Eitelkeit und Imponierfreude, wie man sie bei allerlei Reichen – entweder an materiellen Gütern oder an verschiedenen Kenntnissen (Gelehrte) – findet, und die im gegenseitigen Überbietenwollen ihren Ausdruck findet, poliert dann diese Oberfläche möglichst spiegelblank, sodass alle auf sie auftreffenden Lichtstrahlen unmöglich mehr ins Zentrum der Kugel dringen können, sondern sich auf der Oberfläche spiegelartig reflektieren. Somit können dann auf Grund dieser Oberfläche und der Gestalt der Kugel alle Gegenstände wie in einem Spiegel sich abbilden, allerdings mit dem wesentlichen Unterschied, dass ihr Abbild um ein Vielfaches kleiner erscheint, als ihre tatsächliche Grösse ist. Es können sich zwar auf Grund dieser Eigenschaft auf einer Kugeloberfläche (z.B. einer Weihnachtskugel) alle im gleichen Raum befindlichen Gegenstände wiederfinden, aber in einem solch verkleinerten Massstab, dass sie bis zur Unkenntlichkeit bagatellisiert erscheinen und dergestalt keinem Betrachter mehr etwas nützen, etwa gleich, wie das einzelne Gut eines Reichen in seinem Werte bis auf ein Minutissimum schrumpft und so nur noch ausschliesslich dem Glanze seines Imperiums zu dienen hat, für sich selbst aber keine Geltung mehr haben soll. Es ist das Bild der Blasiertheit des Übersättigten, des ermüdeten Konsumenten, der nicht mehr recht mag, der alles Neue nur in einem Verhältnis zu seiner Fülle beurteilt und seine Fülle stets mit jener anderer vergleicht. Dieses Entsprechungsbild verdeutlicht also das Wesen des Konsumenten, dessen Zentrum ursprünglich wohl eine Art Liebe zu den Dingen gewesen sein mag, die aber mittlerweile schon lange erstorben ist unter dem Druck der Vielheit und erblindet ist vom Glanze seiner nach aussen gerichteten Geltungssucht.
Wieder ein anderer Typ Mensch, der Wissenschafter, der ohne jede Rührung, also gemütlos – oder objektiv, wie man heute sagt – seine Fragen zu stellen sucht und seine Betrachtungen machen will – an wehrlosen Versuchstieren, wenn es sein muss –, gleicht einem Gegenstande ohne Inhalt. In seinem Bemühen um Objektivität entspricht er am ehesten einem Wandspiegel, der alles neutral und objektiv abbildet, was ihm vorgestellt wird. Er selber hat keinen Inhalt, nur eine zur Aufnahme von Lichtstrahlen geeignete, möglichst verzerrungsfreie Aussenfläche und eine zur Rückstrahlung des aufgenommenen Lichtes geeignete Rückseite. In ihm zeigen sich zwar alle Dinge, wie sie dem Aussen nach sind, Inhalte erkennt er aber nicht.
Anders ein Mensch, der sein Gemüt weitet in der Hochachtung vor dem Aufgenommenen und Erschauten; der macht das Erschaute und dadurch Aufgenommene zum Mittelpunkte seiner Betrachtungen. Er gibt also Raum dem ihn Interessierenden und entspricht durch die Art seines Wesens einem Hohlspiegel. In einem solchen finden sich alle Gegenstände vergrössert. Ein solcher Mensch ist es, der in den Bildern der Musik durch die immense Vergrösserung in seinem Gemüte immerzu Neues entdeckt und sich dadurch selber stets besser zu erkennen vermag, weil ja nur das ihm Verwandte des Musikbildes ihn veranlasst hatte, ihm überhaupt Raum zu geben. Was er also in dem vergrössert aufgenommenen Bilde erkennt, ist nichts anderes, als sein eigenes Wesen; besser, deutlicher und erkenntlicher dargestellt durch die erregte Liebe seines Gemütes, welche dem Geliebten einen Raum zu seiner Entfaltung gewährt.
Allerdings ist damit auch der aus der Hohlspiegelsicht Aufnehmende noch nicht zum Inhalte vorgedrungen, obwohl sich der Inhalt oftmals unschwer aus der so vergrössert betrachteten äussern Form ableiten lässt. Eine weitere Wesenseigenschaft eines solchen Hohlspiegels aber ist es, dass er nicht nur die Lichtstrahlen, sondern auch alle Wärmestrahlen auf das aus seiner ehrfurchtsvollen Rücksicht geschaffene, in sich aufzunehmende Zentrum wirft, was daselbst zu einer grossen Wärmeentwicklung führt und das zu Betrachtende derart schnell gedeihen lässt, dass aus der Art des Wachstums und der sich zeigenden Frucht ohne weiteres auf den Kern oder die Seele der Sache oder des Gedankens geschlossen werden kann – eingedenk des Wortes, dass man an ihren Früchten die Dinge, Gedanken und Menschen erkennen kann und soll. Dieser für das Wachstum der Seele und des Geistes so überaus wichtige Vorgang der Wärme- oder Liebeskonzentration, wie er im Hohlspiegel ein so treffendes Entsprechungsbild findet, soll durch eine Episode aus dem Leben noch einmal verdeutlicht werden, um besser verständlich zu machen, wie die hohlspiegelähnliche Wärmekonzentration im Gemüte eines Menschen die Bilder und Gedanken wachsen und reifen machen kann, sodass daraus ihr Wesensinhalt erkenntlich wird. Zugleich wird sich nebenbei daran auch verdeutlichen lassen, wie die Konsumation nicht nur die konsumierte Ware zu Abfall verdirbt, sondern auch gerade noch den Konsumenten.
Stellen wir uns vor, es begegne einem jungen, noch unverheirateten Manne ein Fräulein, von dessen anziehendem Wesen und reizvoller Gestalt er so eingenommen wird, dass in ihm der Wunsch bald einmal aufkommt, dass sie seine Gattin werden möge. Er nimmt das Bild ihres Wesens, wie auch ihrer Gestalt, tief in sein Gemüt auf, sodass sie ihm auch noch gegenwärtig ist, wenn er sich schon lange von ihrer äussern Erscheinung hatte trennen müssen. Nun betrachtet er in seinem Gemüte seine Zukünftige immer wieder von neuem, und er gewährt damit ihrem Wesen in seinem Gemüte immer mehr Raum. Er erkennt, dass bisher noch keine ihm derart gefallen hatte wie diese nun, und sucht sich darüber klar zu werden, weshalb. Ist es wohl bloss ihre Gestalt – oder eher das Wesen, wie ihre natürliche Bescheidenheit, welche ihm aufgefallen ist, oder ihre lebensbejahende und dennoch eher ernste Einstellung, oder ihr warme, entgegenkommende Art, die es ihm angetan hat? Würde sie glücklich sein können an seiner Seite? Könnte er den Ernst ihrer Fragen erfassen und begreifen, und sie in ihrem Eifer für das Schöne und Gute – für das bleibende Innere – auch genügend unterstützen? Oder müsste sich ihr Ernst an der Gelassenheit seines Gemütes zerschellen? Könnte ihr Wesen sich bei ihrer Jugendfrische – aber auch noch jugendlichen Schwäche in einer baldigen festen Bindung noch genügend frei entwickeln, sodass sie sich zu einer jeden Handlung ausschliesslich aus ihrer freien Liebe entschliessen kann und nicht etwa – durch seine eigene bereits starke Wesensbildung bedingt – sich zu irgend etwas genötigt vorkommt, oder in einem andern Fall gehemmt wird, einem Drange ihres Herzens Folge zu leisten? Würde er stets erkennen, was seine Liebste brauche, um sich weiter entwickeln zu können, damit ihre innere Kraft einmal der äussern Gestalt voll entsprechen kann und ebenso reif und vollkommen werden mag? Vermöchte er ihr wohl stets beizustehen und ihren Anteil an seinem eigenen Leben zu bejahen, auch dann, wenn ihr Ernst, verbunden mit ihrer eigenen Anschauung der Dinge, einmal gegen ihn gerichtet sein wird? Darf er das Schöne im Wesen seiner Geliebten überhaupt gefährden durch die Unvollkommenheit seines eigenen Wesens? Dabei ersieht er stets klarer in sich, dass auch er als Mann einen eigenen Ernst habe, ansonst er sich ja gar nicht derart sorgen könnte um die Zukunft seiner Geliebten – schon jetzt sogar, da doch alles in bester Ordnung sich präsentiert und überdies noch gar nichts entschieden ist. Aber er spürt auch, dass sein Verlangen nach Lust und Leiblichkeit seinen Ernst für das Innere zu schwächen imstande wäre, und er fragt sich, was sich daraus ergeben würde, wenn auch sie unvermutet mehr dem Vergnügen sich zu ergeben bereit wäre, als er nun noch von ihr annimmt. Kurz, der junge Mann sieht sich selbst, aber auch seine Liebste und die von ihm gewünschte Gemeinsamkeit in der Wärme seines fürsorgenden Liebewillens sich entwickeln, und er lernt dabei vor allem sich selber noch besser kennen. Dieser Vorgang entspricht der Wärmekonzentration der zurückgeworfenen Strahlen eines Hohlspiegels mit der Folge, dass sich das Zentrum seiner Betrachtungen zu entwickeln und zu entfalten beginnt.
Stattdessen würde der Konsumententyp, welcher wahrscheinlich nicht zum ersten Mal eine für den Augenblick schönste Frau entdeckt hätte, bloss ihre Vorzüge gegenüber den bereits von ihm Verbrauchten, und deshalb wenig Überraschung mehr Bietenden (und darum für ihn auch völlig Wertlosen) erkennen. Er wüsste auch aus der Erfahrung, dass ihr Wert kein allzu grosser sein kann, weil nach der Überraschung aller Wert für ihn verloren ist. Der Wert dieser Frau erscheint also sehr verkleinert auf dem oberflächlichen Erkennungsspiegel seiner vollgefüllten Verbraucherkugel.
Würde hingegen der zuerst beschriebene Liebhaber einer Zweiten oder Dritten begegnen, so würde sein Wohlgefallen und die aus ihm erwachte Liebe auch diese – wie zuvor schon die Erste – ins Zentrum seiner Betrachtungen stellen und damit das Wesen der zu Betrachtenden in sich zum Leben erwecken. Er würde dabei den Unterschied zu seiner inzwischen lieben Gattin erkennen. Würde beispielsweise sehen, dass die Eine aus Zuneigung zu andern handeln würde, und die Andere aus Zuneigung zum Guten, welches in der Wirkung einer Handlung liegt. Die Eine würde vielleicht aus ihrem Denken und Betrachten heraus fühlen, während eine andere aus ihrem tiefen Fühlen zu denken begänne. Dann wieder eine, die aus dem gefühlten Schmerz erst zu denken beginnt, während eine andere bereits aus der dankbar empfundenen Freude. Auf diese Weise würde er unendlich viele Wesenheiten kennen lernen, welche alle auf die eine oder andere Weise mit ihm verwandt wären, wie die Töne der Musik einander verwandt sind – welche aber anderseits auch alle wieder andere, nur ihnen allein entsprechende Verhältnisse bräuchten, um sich zu einem vollen Klang entwickeln zu können.
Dabei käme er jedoch in keine Bedrängnis, denn er fühlte ja, wie ganz anders sein Charakter sein müsste, um die Zweite – und wieder anders, um die Dritte voll erblühen zu machen. Und dabei weiss er ja, dass schon für die volle Entfaltung der Ersten, ihm tatsächlich angehörenden, sein Gemütswesen noch zu viele Lücken und Schwächen hat. Aber er ist glücklich mit ihr, weil auch sie durch viele tiefe Gespräche mit ihm ihre eigenen Schwächen erkannt hat und deshalb auch den seinigen gegenüber Geduld übt. Und dennoch muss er auf den Reichtum einer jeden andern nicht verzichten, wenn er sie und ihren möglichen Entwicklungsweg sich in seinem Gemüte vergegenwärtigt. Im Gegenteil, er erkennt dabei auch in allen Männern, die ihm begegnen, ihre Wesensunterschiede und daraus die Tauglichkeit für die eine oder andere Partnerin genauer. Bei dieser auf den Andern voll eingehenden und dessen Wesen dadurch vergrössernden Betrachtungsweise (einem Hohlspiegel entsprechend) vertieft sich seine Seelenkenntnis (Psychologie) in einem ungeahnten Mass, möglicherweise sogar über das blosse Schulungsspektrum eines studierten Psychologen hinaus, und es eröffnen sich ihm dadurch viele Möglichkeiten und Wege, zu helfen und zu raten, während inzwischen dem Konsumententyp schon lange nur der eine Weg – zum Abfall hin – zu seiner höchsten Verdriesslichkeit bekannt geworden ist, indem er selbst ihn schon ein gutes Stück weit gegangen ist.
Das alles bewirkt im einen Falle die der Konsumation zugrunde liegende Selbstüberhebung und Raffgier, und im andern Falle die bescheidene, ehrfurchtsvolle Zurückgezogenheit demütiger Erkenntnisbeflissenheit. Diese erkennt das Wunder, welches schon im Reichtume des Wahrgenommenen und Erkannten an und für sich liegt, und ahnt die himmlische Seligkeit, die im tätigen Dienst für das Erkannte besteht. Darin alleine liegt doch offenbar die Bereicherung, was doch auch der Konsument durch seine Verdriesslichkeit bei seiner verkehrten Handlungsweise indirekt bestätigt. Während der eine am Ende erdrückt wird, erstarkt das Gemüt und der Geist des andern, und er wird wahrhaft frei.
Wenn wir angesichts der eben gewonnenen Erkenntnis die Musik einmal betrachten wollen, so wird sie uns mehr zu sagen und zu bieten haben als das blosse Studium der Musiktheorie mit all ihren musikalischen Regeln, Gepflogenheiten und Notenkenntnis, die aber alle auf unser Gemüt keinerlei Bezug nehmen – weil wir nämlich schon aus unserem Bedürfnis heraus empfinden werden, wo das uns Sättigende zu finden ist, auch ohne die Kenntnisse über die äusseren Formen der Musik. Denn es schrieben ja andererseits auch alle Musiker einer Epoche mehr oder weniger nach denselben Regeln, was ein etwas erfahrener Musikhörer zu merken beginnt, ohne dass er die Regeln oder gar nur die Epoche selbst zu kennen braucht, und dennoch finden wir unerwartet grosse Unterschiede von einem Komponisten zum andern, ja oft schon von Werk zu Werk eines und desselben Meisters! Der Unterschied kann also nicht in den äussern Regeln gesucht werden, sondern nur in der Aussage! So, wie ein glänzender Redner mit hinreissenden, schön gefügten Sätzen etwas an sich Belangloses darzustellen vermag, ohne dass es uns – der perfekten Form zum Trotz – zufolge seiner Inhaltslosigkeit erwärmen kann, während ein anderer, ähnlich geschickt und dennoch nicht so bravourös Redende uns mit seinen Worten tief berührt – weil aus dem Schatze seiner eigenen Lebenserfahrung herrührend – und uns Dinge empfinden lässt, die wir bis jetzt nur ahnungsweise wahrgenommen hatten, genauso oder noch besser nehmen wir die Unterschiede in der Musik wahr. Der Unterschied, ob uns etwas anzusprechen vermag oder nicht – unsere Ansprechbarkeit vorausgesetzt –, liegt nur in der Frage begründet, ob das Gesagte oder in der Musik Gespielte uns eine Mitteilung bringt, oder ob es nur schöne Formen sind, die alleine um ihrer Schönheit willen gefügt wurden. Um eine mögliche Aussage in einem Musikstück aber sicherer erkennen zu können, ist es wichtig, dass wir unsere Einstellung nicht durch Einstreuungen aus unserm Verstande vorbelasten, denn nur das Gefühl kann uns den Inhalt und die Aussage eines Musikstückes vermitteln. Nur das Gefühl, als etwas Lebendiges, nimmt eine Kraft, als ebenfalls Lebendiges, wahr; der Verstand jedoch erkennt die Kräfte nur an deren Grenzen. So kann ein stark Liebender die Liebe seiner Geliebten fühlen und weiss genau um die Grösse dieser Kraft. Der Verstand jedoch kann die Liebe, als eine Kraft, nur an deren Grenzen bemessen – an jener Grenze, über welche die Liebe nicht mehr bereit ist, zu schreiten, wird er die Grösse ihrer Kraft messen können. Eine Liebe beispielsweise, welche durch ein lautes Wort bereits gedämpft werden kann, ist bestimmt als eine noch sehr schwache Kraft zu werten; sie hat ihre Grenze schon bei einem lauten Worte erreicht. Kann eine Liebe hingegen schon so manche Undankbarkeit verkraften, so ist ihre Kraft auch schon grösser. Sie wird vielleicht erst bei einer Untreue an die Grenze ihrer Kraft stossen, dann nämlich, wenn sie nicht mehr vergeben kann. Darum; lässt sich die Kraft der Liebe zweier sich innig Liebender in der Sprache, als dem Werkzeug unseres Verstandes, nicht anders darstellen, als durch die Schilderung eintretender Widerstände (Grenzen), welche diese Liebe überwinden muss, weil sie nur dadurch in ihrer Grösse beschreibbar wird. Die Töne hingegen haben in ihrer Kraft eine direkte Entsprechung zu unserem Gefühl, welches sie ihrem Wesen entsprechend anregen können ebenso, wie eine Liebe dieselbe andere Liebe ohne äussere Tat anregt. Voraussetzung dafür ist bloss das Vorhandensein oder genügende Wachsein des Gefühles, welches stets die Wahrnehmungsart des (innern) Lebens ist. Das ist auch der Grund, weshalb die Wirkungen der Musik so schlecht in Worte zu fassen sind. Zwei verschiedene, miteinander erklingende Töne können für unser Gefühl zu einem Ganzen verschmelzen, oder das "Verlangen nach einander" uns so stark spüren lassen, dass wir unwillkürlich unser eigenes Verlangen nach dem von uns Geliebten mächtig spüren werden. Zwei andere Töne streiten in der Wahrnehmung unseres Gefühles miteinander so stark, dass in uns die Gefühle des Streites wach werden.
Wer bloss am Wechsel dieser Empfindungen Lust hat und aus dieser Lust Musik hört, oder macht, der ist es, welcher ohne Aussage hört oder spielt. Wer durch sie aber eine notwendige Entwicklung oder eine unverstandene Fügung in seinem eigenen Leben erkennt oder erahnt, und diesen Teil seines Selbst dadurch belebt, lockert und nach Möglichkeit ergänzt, der hat beim Hören etwas vernommen, oder beim Spielen etwas auszusagen – ob er sich dessen bewusst ist oder nicht! Eine Verstandeseinstreuung wäre es in diesem Falle bereits, sich nach musikalischen Gesetzen und Regeln umzusehen – und wären es die Harmoniegesetze der Musik! Denn diese basieren ja auf unserer Empfindung, auf unserem Gefühl, und bestätigen dasselbe – dürfen aber nichts vorschreiben, sondern nur Auffindungshilfen sein für von uns nicht aufgefundene Entsprechungen unserer Gefühle. Werden sie als bindend angesehen und damit zu mehr gemacht als sie natürlichermassen sind, so verkommen sie zu Irreführern, wie das die Moderne zeigt.
Weitere solche Verstandeseinstreuungen, welche die Aussage der Musik in unserm Gefühl unterbinden, wollen wir nun in der Folge noch kennen lernen. Dabei sind an erster Stelle all jene musikalischen Vorzugsstücke eines Menschen zu erwähnen, die ihren Vorzug einer Begebenheit zu verdanken haben. Wird einem Menschen beispielsweise etwas geschenkt oder sonst etwas zuliebe getan, so ist er für den Moment für alles aufnahmefähiger und empfänglicher, und alles wird sich ihm rosiger zeigen und sich tiefer in sein Gemüt einprägen. Da erhält einer von seiner Geliebten als eines der ersten Geschenke eine CD; oder er geht mit einem zurückgekehrten alten Freund ins Konzert, oder erhält von einem ihm teuren Menschen ein Abschiedsgeschenk in Form eines Konzertbillets oder einer CD usw. Aus solchen Begebenheiten ergeben sich zumeist bevorzugte Musikstücke oder auch bevorzugte Komponisten – wenn der geliebte Mensch einen solchen hatte –, ohne dass der Inhalt des Stückes dafür direkt ein Grund ist. Da verbindet das Gedächtnis über den Intellekt stets ein dem Wesen der Musik fremdes Ereignis mit der Musik und gibt dieser damit einen Inhalt – gleichgültig, ob die Musik an sich schon eine Aussage hat, oder nicht. Es kann deshalb auch die Überschneidung der Gefühle beim ersten Hören nachher nicht mehr geschieden werden, weil ja der Hörer das alles im Musikstück haben will, (aus Sympathie zum geliebten Menschen).
Eine andere Form der Verstandeseinstreuung ist das Bekannt-Werden mit dem Schicksal des einen oder andern Komponisten (z.B. durch eine Biographie), an welchem man sehr starken Anteil genommen hat und wobei das Hören seiner Musik dann vor allem nur die Verbundenheit mit ihm in unseren Gefühlen aufkommen lässt. Aber nicht vor allem das Schicksal eines Komponisten gibt der Musik die Aussage, sondern sein Wesen. Im vorgenannten Falle jedoch gibt die Verbundenheit mit der Geschichte des Komponisten der Musik den Inhalt. Wir können zwar aus der Kenntnis des Schicksals oder der Geschichte eines Komponisten seine Musik besser verstehen; – schön und harmonisch jedoch können wir sie nur dann empfinden, wenn der Komponist in seinem Wesen (auch dem Schicksal gegenüber) gleich veranlagt war, wie wir als Hörer sind. Nicht alle machen aus denselben Schicksalsschlägen dasselbe!!
In einem dritten Fall ist ein Strenggläubiger der Ansicht, dass man eigentlich nur zur Ehre Gottes musizieren sollte, und er gibt deshalb der Kirchenmusik im Allgemeinen, und jenen Komponisten, die mehrheitlich solche schrieben, im Besonderen den Vorrang. Er übersieht dabei aber leicht, dass Gott schon sehr viel äussere Ehre gegeben wurde, aber dabei das Herz der Ehrenden oft ferne vom Verehrten war. Ein einfaches Liedchen hingegen, das ein Kind der aufgehenden Sonne mit grosser Freude und Herzlichkeit entgegen singt, verehrt Gott mit der darin enthaltenen Dankbarkeit viel inniger, als das Musikstück eines Komponisten, der mit seiner Arbeit eigentlich vor allem die eigene Ehre suchte, mit welcher er oft zugleich alle seine Mitkonkurrenten in der Gunst der Obrigkeit und des Volkes ausstechen wollte. Liegt doch die Aussage der Musik ausschliesslich in den Tönen, und nicht in den Überschriften oder in den Texten dazu. Also orientiert sich auch ein solcher Hörer im Verstande – an Äusserem.
Ein anderer findet beim aufmerksamen Hören eines Stückes heraus, dass eigentlich alle Instrumente eine eigene Stimme haben und ergötzt sich daran, dass so viele Stimmen zusammen noch stets eine Harmonie bewirken. Mag das im gehörten Stück auch wirklich so der Fall gewesen sein, so macht er in der Folge dennoch leicht ein Kriterium daraus und setzt so wieder die Form über den Inhalt. Er kennt nicht die äusserst folgenschwere Aussage der Tonruhe – des Schweigens einer Stimme –; kennt nicht die innere Erregung des in zu grosser Freude und Dankbarkeit Verstummenden.
Wieder einer hat Freude an künstlich komplizierten Formen und Verzierungen und sucht diese Äusserlichkeiten in einem Stück. Er kennt nicht die belebende, aber von Herzen kommende Sprache der einfachen Melodie.
Wir ersehen aus all den angeführten Beispielen, dass überall dort, wo etwas in der Musik gesucht oder erwartet wird (die Erinnerung, das Verbundensein, die Ehre Gottes oder eine Technik usw..), die wirkliche Aussage der Musik nicht, oder nicht voll wirksam werden kann.
Dasselbe gilt dann aber auch für den Fall, bei welchem nur der Genuss in der Musik gesucht wird, wie wir bei der einleitenden Darstellung des "Konsumenten" gesehen haben. Was hatte diesem der Wesensreichtum einer Frau zu sagen? Nichts, als Genuss!
Die Musik erfüllt den Menschen mit Gefühlen! Wer diese Tatsache zu geniessen beginnt und nur das in der Musik sucht, gleicht einem, der isst und trinkt, weil es ihm wohl tut, wenn das Kühle den Hals hinunterläuft und das Pikante seinen Gaumen kitzelt, solange, bis es ihm schlecht davon wird. Er kennt zwar alle nur erdenklich möglichen Genüsse, aber die Würze eines tiefen Verlangens aus einer gewissen Not der Schwäche – des Hungers – kennt er ebenso wenig wie dann die süsse Erfüllung und die grosse Wärme der Dankbarkeit über eine erfolgte Sättigung.
Beides, die Not oder der Hunger, und die darauf erfolgte Sättigung sind Erlebnisse, die den Menschen wecken, wachsen machen und reifen lassen. Erfahrungen, die der einfache und zumeist arme Mann der Strasse kennt, und die seine Lebenskraft stärken und erhalten bis ins hohe Alter, während der Schlemmer in den Gefühlen erlahmt und elend wird – ob er nun dem Gaumenkitzel, dem Kitzel und der Lust des Fleisches oder auch nur dem Kunstkitzel ergeben war.
Manches Mal auch ist tiefe Enttäuschung oder Armut in der einen oder andern Sphäre des menschlichen Seins der Grund dafür, dass man im Genusse das Unangenehme zu ersticken sucht – also nicht genussüchtig ist im eigentlichen Sinne. Das Resultat aber ist dennoch dasselbe, nämlich die Erstickung des Geistes und damit auch der Aussagen, welche in der Musik enthalten sind. Solche Menschen ertränken mit der Zeit den Geist der Aussage und verlieren sich in der Musik, anstatt dass sie sich darin finden und durch die Erbauung erstarken würden. Wenn es also auch nicht Genusssucht ist, so ist es dennoch eine Sucht mit stets den gleichen Folgen.
Welches ist nun aber die Aussage, und wo steckt sie, wie erkennt oder wie vernimmt man sie? Das ist allerdings eine absolut verständliche Frage, nach all dem bisher Erläuterten. Und soweit das nicht bereits dadurch gesagt wurde, dass die Töne als Kraft zu unserer Kraft der Liebe durch unser Gefühl sprechen – und zwar direkt, – durch die Erregung unserer eigenen Kraft der Liebe, und nicht über den Umweg von begrenzten Wortbegriffen –, wollen wir dafür auch eine weitere Erklärung suchen. Könnte eine Antwort auf diese Frage aber auch bis ins letzte detailliert gegeben werden, so würde sie dadurch nur wieder zu einer vorher angeführten Verstandeseinstreuung werden, durch welche die viel wirkungsvollere und umfassendere, zwar ahnungsweise aber dafür direkte Aufnahme der Musik gehemmt oder gehindert würde, zumal ein und dasselbe Erlebnis, zum Beispiel einer harmonischen Verbindung, wie sie zwei zusammenklingende Töne darstellen können, durchaus verschieden empfunden werden kann. Weil damit aber ein und dieselbe Erlebnisaussage oder -wiedergabe in einem jeden wieder anders empfunden werden kann, so ist eine musikalische Aussage eben nicht formelähnlich immer dieselbe, sondern bloss eine aus dem Erlebnis sich gründende Einsprache in unser Gefühl.
Das wollen wir uns am Erlebnis eines Natureindruckes verdeutlichen. Und zwar an einer Blüte, weil jeder Mensch auch irgendwann einmal – wenn auch noch so kurz – eine oder mehrere Blütezeiten erlebt hat. Wenn er dann eine Blüte ansieht, so hat diese darum eine direkte Einwirkung auf sein Gemüt und sein Gefühl.
Der eine sagt und sinniert beim Betrachten einer Blüte oder einer Blütenvielfalt etwa so: "Wie herrlich schön sind sie, die Blüten, die im Frühlinge – dem Beginn des natürlichen Lebens nach dem kahlen Winter – so herrlich in allen Farben in der Sonne leuchten! Wie zart und vergänglich aber auch! Was wollen sie uns wohl sagen? Sie zeigen uns, dass das Schöne und Zarte kein Bleiben in dieser Welt hat, dass all die Hoffnung, die im aufblühenden Leben eines Menschen sich zu entfalten beginnt, zunichte werden muss; dass der Duft der Jugend doch einmal in Modergeruch des Grabes gewandelt wird." – Ihm hat die Blüte das gesagt, und das ist wahr und auch gewiss, wie es alle Zeiten schon den Menschen gelehrt haben.
Ein Anderer denkt: "Das ist die Lust des Lebens, dass sich immer wieder Blumen zeigen! Wenn auch danach das Welken und Vergehen geschehen muss, so kommt doch nach jedem Herbst und Winter wieder ein neuer Frühling mit neuen, teils gleichen, aber auch wieder vielen andersartigen Blumen." Sind seine Erfahrungen, seine Empfindung und sein Urteil etwa weniger wahr? Sie sind ebenso wahr!
Weiter liesse sich denken und aus der Betrachtung der Blumen die Aussage entnehmen: "Die Blumen sind, wie die Menschen sein sollten! Schöne, reiche Wesen, deren duftender Inhalt, der Nektar, weithin seinen Wohlgeruch verbreitet und damit alles beglückt und froh und herzlich stimmt. Sie öffnen sich aber auch nur dem Lichte der Sonne und verschliessen ihr empfindsames Wesen sorgsam vor dem Sudel des schlechten Wetters, richten ihre Köpfchen stets nach der Wärme und dem Lichte der Sonne und bekennen dadurch, sowie mit ihren herrlich leuchtenden Farben, ihre volle Dankbarkeit." Welch tiefes Gefühl verraten doch diese Gedanken! Liegt diese Aussage etwa nicht auch in der Natur der Blüten?
Wieder ein anderer Eindruck besagt: "Wie herrlich sind zwar diese Blüten, und wie empfindlich zart! Man darf sie gar nicht anrühren, sonst verdirbt man sie, und dennoch reizen sie einem durch ihren betörenden Duft und lassen einem keine Ruhe, sodass man immerzu nur sie, und nur wieder sie im Sinne hat, und dennoch lassen sie eine heftige Berührung nicht zu. Gleichen sie nicht den schönen, herrlich geschmückten Frauen, welche alles tun, dass sie einem im Gedächtnis bleiben, und dennoch liesse sich keine so recht anfassen, ohne dass ihr zarter Reiz schnell verginge, wenn ihre handfeste Entrüstung sogar ihr Angesicht verfinsterte?" Hat diese Aussage nicht auch etwas für sich? Ist sie nicht ebenso aus dem Wesen der betrachteten Blumen entnommen – wenn auch in Vergleich gesetzt zu menschlichen Eigenheiten?
Und letztendlich noch eine Aussage, welche einem weitsichtigen Gemüte bei der Betrachtung einer Blüte sich eröffnete: "Wie herrlich offen stehst du doch! – Grosser Erwartung voll, und zur Hingabe bereit, wie eine geschmückte Braut in der Erwartung ihres Bräutigams. Wie reichlich beschenkst du deine Besucher alle, sodass sie nicht vergeblich bei dir anklopfen. Wie weit weht doch deiner Fülle Duft, sodass die Bienen reichlich kommen und deiner freundlichen Einladung folgen. Und wie sorgsam behütest du, schöne Blüte, das grosse Geschenk deiner muntern Besucher, welches sie unwissentlich mitbrachten bei ihrem Besuche, und es eintauschten gegen den so reichlich dargebrachten Nektar deines guten Willens! Wie achtlos und demutsvoll zugleich lässt du alle Pracht der äussern Blütenblätter von dir fallen und umschliessest mit grosser Innigkeit das dir dargebrachte Geschenk; gehst in dich und findest in dir – in dem dir zugebrachten Pollenkorn – ein dir Entsprechendes und dennoch ein dir Abgehendes. Vereinigst dich mit ihm und lässt das Pollenkorn in deinem Wesen wirken und dich von ihm ermuntern, deine Gefässe stetig zu erweitern und zu füllen mit dem Saft des Stammes oder des Stängels, von den Wurzeln her kommend, also mit deines Wesens Grund, sowie mit dem Lichte und der Wärme der Sonne, sodass in dir ein neues Bild – derselben Pflanze – in einem werdenden Samen zu entstehen beginnt. Ein gediegenes und haltbares Bild, das auch ohne Verbindung mit der Erde, der du entwachsen bist, sich selber bleibt; freilich dem menschlichen Auge auf solange nicht sichtbar, bis der Same – in den Boden gelegt – zu keimen beginnt und nach und nach zu derselben Pflanze heranwächst, auf welcher du, meine Blüte, mir zur Erbauung gesessen bist und deinen Samen in dir ausgereift hast."
Wenn die Frucht dann noch ein Apfel war, wie herrlich nährend und aufbauend war da sogar das äussere Fleisch dieser Frucht für den dies Wunder betrachtenden Menschen! Wie gar nichts ist doch die äussere, eitle Sinnenfreude angesichts dieser reichen Frucht. Wie wenig auch taugte doch die äussere Pracht der schönen Blütenblätter für den werdenden Reichtum der Frucht. Die munteren Insekten hätten den Nektar auch ohne sie gefunden, weil er so angenehm und weithin geduftet hatte. War es denn ein Fehler, diese Blütenblätter getrieben zu haben? Oh nein! Wie mancher hat sich doch darüber gefreut und ist erst durch sie erregt worden und dadurch zu so tiefen Gedanken gekommen. Nur jenen, welche sich durch die Gefangennahme ihrer Sinne an ihre äussere Pracht gekettet hatten, waren sie zum Verhängnis des Verlustes und der Trauer geworden, sodass sie darüber sogar ihrer Frucht vergessen konnten.
So reichlich also lässt sich aus dem Bilde einer Blüte schöpfen, denn diese Aussage ist ja nichts anderes, als die Beschreibung ihres Lebens und des Sinnes ihres Seins!
Soviel lässt sich aber aus allen Erscheinungen der Natur nehmen, wenn wir ihnen nur Zeit und Raum widmen in uns selbst. Wir werden im Kapitel über die Tonintensität noch sehen, welcher Reichtum an verschiedenartigem Geschmack in einem Fruchtsaft liegt, und bei den Betrachtungen über die Tonlängen noch erkennen, wie Vieles an bloss äusserem Erleben in einem Bissen Brot enthalten ist. Und ebensoviel kann in der Musik enthalten sein, je nachdem, wie viel dem Komponisten – bewusst oder unbewusst – eigen war. In Einzelheiten einer Komposition aber finden wir bei jeder reinen Musik denselben Aussagereichtum, weil sie ja aus der Kraft der Töne besteht, welche unsere eigene Kraft der Liebe direkt berührt, sodass das in uns persönlich liegende Eigene zu uns zu sprechen beginnt in der nur uns eigenen Weise, und uns so als Leben näher kommt als alle Sprache und alles Wissen.
Obwohl wir uns über das Bild einer schönen Blüte beinahe immer freuen können, so berührt uns dieses Bild nicht immer. Dasselbe gilt von Tönen, Tonfolgen und Tonkombinationen, die schön und rein sind. Sie werden uns immer erfreuen, wenn wir ihnen begegnen, aber nicht immer werden sie uns berühren. Falls sie uns aber berühren, empfinden wir das; und diese Empfindung ist es, die uns etwas zu sagen hat – etwas ganz spezielles, auf unsere gegenwärtige Situation passendes aus dem grossen Schatze der Wahrheit, die in allem enthalten ist!
Ganz anders auch berührt uns die Blume auf dem Felde, im Verein mit vielen andern ihresgleichen, aber zugleich gemischt mit andersartigen und andersfarbigen. Die Blüten eines Baumes sprechen wieder anders zu uns; und noch viel anders und dramatischer spricht die einzelne, abgebrochene und eingestellte Blüte zu uns; wieder verschieden eine Aufgehende von einer Welkenden.
Genauso, wie die verschiedenen Situationen der Blüte uns ganz verschieden berühren, so berührt uns dieselbe Situation einer Blüte ganz verschiedenartig, je nach der Situation, in der wir uns befinden. Begegnen wir bei voller Gesundheit einer aufgehenden Blume, so erleben wir die Dankbarkeit und Freude in den Farben und der Pracht, und dieses Gefühl bereichert uns und stimmt uns heiter. Begegnen wir hingegen einer welkenden Blüte, so stimmt uns das herab und berührt uns unangenehm mahnend, dass nicht in äusserer Pracht und Gesundheit der Sinn des Seins gelegen sei – es engt uns ein. Umgekehrt kann es bei Krankheit – oder noch auffälliger bei der Genesung – geschehen, dass uns die in der Freude sich verbreiternde Unbekümmertheit einer aufgehenden Blütenpracht unangenehm berührt – wir empfinden darin eher das Ich-bezogene Denken und Fühlen, während wir bei der leicht welkenden Pracht die werdende Frucht erkennen, die sich aus der Hingabe an das Höhere ergibt und die uns selber mit der Genesung geworden ist, just in dem Momente, da wir die Unbill der Krankheit anzunehmen – uns ihr hinzugeben – gelernt hatten. Sie berührt uns in diesem Zustande deshalb stärker und tiefer.
Einmal auch erleben wir dieselbe Pracht der Blüten in unseren betrachtenden Gefühlen als einen Hauptteil, zum Beispiel des Frühlings, und ein anderes Mal als kurze Episode nur, als bloss äussere Erscheinlichkeit im Lebenszyklus einer Pflanze. Einmal wird auch in der Musik ein und derselbe harmonische Klang zum Mittelpunkt, einmal zum konservierten und erstarrten Muss der Schönheit, wieder ein anderes Mal zum in der Not uns beistehenden Freunde, beispielsweise nach mehreren Dissonanzen (disharmonischen Klängen). Einmal empfinden wir ihn als zu aufdringlich, ein anderes Mal eher als zu wenig überzeugend – und das im selben Stück.
Aus dieser Schilderung lässt sich leicht erkennen, dass die Aussage der Musik sich nicht mit Worten, auch nicht mit Bildern ausdrücken lässt, sondern nur vergleichen lässt mit andern Aussagen, welche ebenfalls eher unser Gemüt berühren und die Ahnung in uns wecken, als den Verstand beschäftigen, welcher bloss das Wissen bereichert, uns jedoch nicht belebt.
So, wie es bis jetzt dargestellt wurde, sind wir frei und können dem uns Berührenden zu jeder nur möglichen Bildentfaltung in uns selbst verhelfen, wenn wir ihm nur Zeit und Aufmerksamkeit widmen oder schenken. Anders dargestellt aber würden die Worte und Erklärungen dieses Buches als etwas gediegen Festes, aber dennoch Fremdes im Gemütsbilde des Lesers auftreten, was sein gemüthaftes Erkennen wesentlich mehr stören und hindern würde, als eine kleine, noch etwas dunstige Unklarheit, die sich aber viel eher lösen kann, als ein fest geformter Begriff sich wieder zu lösen vermag, wenn er einmal unser Gemüt zu beherrschen beginnt.
Die einzelnen Elemente eines Tones oder Klanges hingegen können wir unbeschadet miteinander zusammen betrachten, ebenso, wie wir bei einer Blüte deren Aufbau zergliedern können, um daraus zu ersehen, welches die Grundbedingungen einer Blüte sind, ohne dass wir darum die vorherigen, so gefühlsbetonten und -erregenden Bilder einer solchen Blüte in uns zerstören müssen oder auch nur wesentlich beeinflussen würden. Im Gegenteil, wir werden diese in ihrer Vielfalt und Gesamtheit nur bestätigt finden, wenn wir erst einmal die Pole einer Blüte kennen gelernt haben und wissen, was daran das Äussere, und welches das Innere ist; wie das Männliche und das Weibliche beschaffen ist, was blosse Erscheinung ist, und was der tiefe Grund, welcher sich jüngst einmal in einer nahrhaften Frucht zeigen wird. So auch wollen wir darum der Reihe nach die einzelnen Elemente des Tones in unserm Gemüte betrachten, damit sein Wesen in uns selber immer klarer erkenntlich und spürbarer wird:
(Weil wir dabei der Einfachheit der Erklärungen halber dennoch nicht ganz ohne Fachausdrücke auskommen – diese aber, wenn sie unverstanden bleiben, das Verständnis des Textes erschweren –, so sind sie auf der hintersten Seite des Buches alle aufgeführt und erklärt, weil man zu dieser Seite am schnellsten gelangt.)
nach oben
DIE TONHÖHEN  Wohl die grösste Wirkung in der Musik haben die verschiedenen Tonhöhen. Zwar können die Töne bei gleicher Höhe erstens in ihrer Eigenart – durch die verschiedenen Instrumente bedingt – verschieden sein, und zweitens auch in ihrer Lautstärke oder Intensität und dann ein drittes Mal verschieden sein in ihrer Länge oder Zeitdauer. Aber am klarsten und für die Musik am wichtigsten ist die Verschiedenheit ihrer Höhe. Diese Verschiedenheit ist zur Bildung einer Melodie die absolute Notwendigkeit, ohne sie lässt sich keine Melodie denken. Zwar bestimmt die Tonlänge eine Melodie wesentlich mit, aber dennoch ist ihre Verschiedenheit nicht Voraussetzung einer ganz einfachen Melodie.
Was also haben uns die Tonhöhen zu sagen? Einmal haben sie dem aufmerksamen Hörer durch das Gefühl bei der Aufnahme des einzelnen Tones schon vieles zu sagen und danach noch ebensoviel bei den aus ihren Kombinationen entstehenden Wirkungen – immer aber nur im Gefühl, im Gemüt –; denn Musik ist für das Gemüt bestimmt, und nicht für den Verstand. Mit dem Verstande wollen wir hier nur zu begreifen suchen, wie – und vor allem wie wahrheitsvoll – unsere Gefühle den Inhalt oder die Aussage der Musik zu fassen im Stande sind. Denn: dass die Musik eine Aussage hat, und zwar eine sehr deutliche, obwohl sie "nur" das Gemüt anspricht – und nicht den Verstand –, das erfahren wir leicht, wenn wir sehen, wie bei tragenden Weisen und Melodien oder bei gedämpften Tönen die Menschen ernster werden und Kinder oft zu weinen beginnen, oder wenn wir sehen, wie fröhliche Klänge die Zuhörer zu beleben vermögen.
Bei der aufmerksamen und bewussten Aufnahme von Tönen können wir eine ganz erstaunliche Beobachtung machen: Wenn wir von mittleren Tonhöhen abwärts gleiten, so spüren wir mit zunehmender Tiefe der Töne stets mehr, dass wir den Ton nicht nur hören, sondern geradezu fühlen. Eine Bassgeige, in unserer Nähe gestrichen, lässt unsern ganzen Brustkorb leise erzittern (vibrieren), sodass wir uns bewusst werden, wie uns die Töne geradezu im wörtlichen Sinne sogar leiblich ergreifen können. Noch deutlicher verspüren wir diesen Effekt bei tiefen Orgeltönen in einer Kirche. In umgekehrter Richtung – die Tonleiter hinauf – erkennen wir, dass wir die Töne, je höher sie sind, desto bestimmter und klarer empfinden, und dass sie uns stets weniger bewegen. Während wir im mittleren Tonbereich noch das subjektive Gefühl haben, die Töne mit unserem ganzen Wesen, oder doch mit dem ganzen Kopfe wahrzunehmen, verlagert sich mit zunehmender Höhe dieses Gefühl der Wahrnehmung von unserem allgemeinen Wesen her doch stets vermehrt und immer deutlicher zu unseren Ohren hin; und ganz hohe Töne empfinden wir fast punktförmig – Nadelstichen ähnlich – nur noch im Zentrum unseres Ohres, auf dem Trommelfell also. Bei hohen Tönen oder Tonkombinationen können wir viel leichter eine bildhafte Vorstellung erlangen, ohne dass wir das zu suchen brauchen. In einem lebhaften Gemüte bilden sich von alleine bald allerlei Formen. Bei tiefen Tönen dagegen empfinden wir eher Zustände, als eigentliche Formen. Eine sehr tiefe Begleitmelodie können wir wie einen sonnendurchwärmten Boden empfinden, über welchem dann die hohen Töne zu Formen werden. Oder wir empfinden beim Anklingen tiefster Töne während eines Spieles ein heimatliches Gefühl, eine Geborgenheit, oder gar ein Gefühl des Trostes und der Beruhigung. Immer sind es also eher Zustände, in die wir mit tiefen Tönen versetzt werden können, während die hohen Töne Bilder erzeugen. Auch könnten wir über unsere Gefühle bei der Aufnahme von Tönen sagen, dass wir die tiefen Töne als unbestimmter, aber als warm empfinden, und hohe Töne als sehr bestimmt, aber auch als kalt.
So weit vermag beinahe jeder Mensch – auch dann, wenn er nur sehr wenig Kontakt mit Musik gehabt hat – zu folgen. Dabei erkennen wir, dass sich das Hörspektrum von tiefen, warmen Tönen bis zu hohen, kalten Tönen erstreckt. Und – – schon erkennen wir eine gewisse Parallelität zu einem andern Spektrum, welches auf ein anderes Sinnesorgan zu wirken vermag, – das Farbspektrum, wo wir ebenfalls von tiefen (Schwingungen) und warmen, roten Tönen bis hinauf zu den höchsten und kältesten Blautönen ein Feld finden, welches unseren Augen durch dieselben Entsprechungen auch dieselben Gefühle zu vermitteln vermag, wie der Bereich der Töne unserem Ohr.
Auch dort entspricht dem warmen Rot eher die Bewegung, als ein Zustand der Gelöstheit und wohltätigen Ruhe, und dem Blau die ruhige Bestimmtheit einer gediegenen und klaren Form, welche auch in einer beinahen Durchsichtigkeit noch klarste Konturen erkennen. lässt. Nur ist die Einwirkung auf unser Gefühl bei den Tönen entschiedener und direkter als bei den Farben.
Aber noch drei weitere Erscheinungen müssen wir betrachten, um schneller und sicherer die innere Entsprechung der Tonhöhen zu erkennen. Denn nur diese Entsprechung, welche wir erahnen, bewegt unser Gemüt beim Hören von Musik. Die erste Erscheinung besteht in der Tatsache, dass sich tiefe Töne in ihrer Lautstärke viel besser variieren lassen, als hohe. Während wir also tiefe Töne von leisestem Summen bis zu donnerähnlichem Gebrüll steigern können, lassen sich hohe Töne nur begrenzt verstärken (auf natürlichen Instrumenten und für unsere subjektive Empfindung). Die zweite Erscheinung wahrzunehmen, erfordert schon die Möglichkeit, auf einem geeigneten Instrumente den nötigen Versuch mitzuerleben, und überdies die Harmoniegesetze bei den Tönen etwas zu kennen: Zwei ganze oder volle Töne, die nebeneinander liegen nennt man "Sekunde"; sie wirken –- gleichzeitig miteinander gespielt – äusserst unschön, disharmonisch. Wenn wir uns das einfach verdeutlichen wollen, so drücken wir auf dem Klaviere im mittleren Tonbereich beispielsweise die Taste "c' " und "d' " miteinander; was wir hören, ist ein strittiges Paar, das unverträglich und voll Spannung nebeneinander verharren muss. Das jedoch können wir nicht überall gleich gut hören! Drücken wir die unterste Tonstufe "C1" und die ihr nächst höher liegende Stufe "D1" der Klaviatur, also in der tiefsten Oktave, so verspüren wir von dieser Spannung und Dissonanz nicht nur nichts, sondern wir vernehmen nicht einmal deutlich zwei verschiedene Töne, sondern vermeinen, einen einzigen, vielleicht etwas unklar, zu hören. Eine Oktave höher hören wir – wenn jenes "C" und "D" miteinander angeschlagen wird – vielleicht schon zwei Töne, wenn wir sie auch kaum voneinander unterscheiden können, aber eine Dissonanz oder Spannung verspüren wir nicht. Bei allen höheren Oktaven hören wir sehr gut beide Töne und empfinden ihr unangenehmes Spannungsverhältnis zueinander, und zwar bis hinauf zu der zweitobersten, also dreigestrichenen Oktave. Beim obersten "c'''' " und "d'''' " hören wir nur noch schwach oder gar nicht zwei Töne und auf alle Fälle keine Dissonanz mehr. (Der Musiker ordnet jeder Oktave entsprechend ihrer Höhe eine bestimmte Schreibweise zu. Auf dem Klavier beginnt sie zuunterst mit C1 und geht über C, c, c', c'', c''', bis zu c''''; soviel als Erklärung zu der verschiedenen Schreibweise der Tonstufen.) Bei der ersten, also der tiefsten Oktave des Klaviers können wir sogar die Tonstufen l bis 5 kaum oder nicht gut unterscheiden, wenn jeweils zwei sorgfältig und gleichzeitig miteinander angeschlagen werden. Bei allen höheren Abschnitten der Tonleiter (bei allen höheren Oktaven) können wir das wohl.
(Dazu eine Anmerkung: Ein Musiker vermag das wohl dennoch zu hören. Der weniger Geübte aber hört den Unterschied nur dann bestimmt und sicher, wenn die beiden Töne nicht zugleich miteinander angeschlagen werden. Daneben gibt es auch bei nicht geübten Ohren solche, die schärfer unterscheiden, und solche, die weniger gut differenzieren können; immer aber ist zumindest dieselbe Tendenz erkennbar, ob eine Oktave tiefer oder höher, spielt keine wesentliche Rolle.)
Auch die dritte Erscheinung wahrzunehmen, erfordert ein Instrument, am besten wieder das Klavier. Wenn wir in der untersten, tiefsten oder zweituntersten, zweittiefsten Oktave die Tasten l und 5 ("C1" und "G1") der C-Dur-Tonleiter drücken, und zum Vergleich etwa vier Oktaven höher dasselbe Paar, welches auch Quinte genannt wird, so empfinden wir sehr deutlich die grössere Fülle der unteren Quinte gegenüber der oberen, und zwar so sehr, dass uns daneben die obere als durchsichtig erscheint. Diese erscheint uns etwa gerade so, wie wir vorhin von der blauen Farbe Erwähnung machten. Sie ist nämlich durchsichtig gegenüber den Quinten der untersten beiden Oktaven, aber ihre Ränder oder Konturen empfinden wir schärfer. Der Raum zwischen den beiden Tönen ist also leichter, gewichtloser, durchsichtiger, und dafür die Töne selber bestimmter und klarer erkenntlich. Um dieser hohen Quinte etwa dasselbe Gewicht zu verleihen, und die Konturen so verwischen zu können wie bei den untersten beiden Quinten, müssen wir den mittleren Ton, die Stufe "3" ("e'' "), mit anschlagen. Nun wird allerdings der Klang bunter, als bei den untern Quinten, welchen der mittlere Ton ja fehlt. Aber das Gewicht dieses "Trios" ist nun in etwa gleich gross, wie dasjenige der untern "Duos" (bei gleicher Anschlagstärke), und die Klarheit des einzelnen Tones wird etwa nur noch derselben bei den untern Quinten entsprechen, weil sich die Töne ja näher liegen. Also erkennen wir daraus, dass die tiefern Töne fülliger und schwerer sind, aber weniger bestimmt, und das in einem derart grossen Masse, dass wir vier Oktaven höher bereits drei Töne brauchen, um Gewicht und Fülle, aber auch die Unbestimmtheit der untern zwei Töne zu erreichen. Die grössere Buntheit des Klanges von l, 3 und 5 darf uns bei der Beurteilung des "Gewichtes" und der Abgrenzung (Klarheit) nicht beirren. Denn drei klare Ideen wirken auch stets bunter, als zwei zwar grosse, aber noch unklare Ideen, trotzdem die Gewichtigkeit gleich bleiben kann.
Nun wissen wir so viel über den Unterschied zwischen tiefen und hohen Tönen, dass wir schon beinahe selbst darauf stossen müssten, wessen Entsprechung sie haben. Und zuguterletzt ist alleine mit dieser Feststellung schon angedeutet, was es sein könnte, wenn wir nur die verwendeten Adjektive "tief" und "hoch" etwas in uns wirken lassen wollen: – – Was könnte wohl aus dem Fundamente heraus tiefer sein, als die tiefste Liebe, und was wohl höher, als die höchste Weisheit?! Gewiss, eine tiefe Sorge oder ein tiefer Schmerz sind ebenfalls tief – aber wohl nur deshalb, weil wirklich tiefe Sorgen Liebesorgen sind (andere Sorgen sind schwer), und mit "tiefem Schmerz" bezeichnen wir nur Gemüts- oder Liebesschmerzen, und nicht die Schmerzen des Leibes. Umgekehrt ist hohe Kunst und hoher Reinheitsgrad nur ein Produkt hoher Weisheit. Aber das alles wollen wir nun aus den Tönen selbst erahnend zu begreifen suchen:
Wenn wir andachtsvoll einer Sopranstimme lauschen, oder auch hohen Streichertönen, wenn sie Solo gespielt werden, so kann uns zwar beides gefallen, ja es kann uns vielleicht sogar bezaubern, aber um eine Feststellung kommen wir doch nicht herum: Es fehlt die Fülle, die Wärme, der Boden. Umgekehrt können wir einer Bassstimme oder einer Bassgeige lauschen, wenn sie Solo spielt; wenn beide nicht zu laut sind, so werden wir eine Wärme und eine Fülle epfinden, die uns anheimelt, die uns ruhig werden lässt und zufrieden stimmt, obwohl wir dabei vielleicht beinahe das Gefühl von Dunkelheit oder Dämmerung empfinden könnten, die uns zwar nicht behindernd, sondern eher angenehm und vertraut vorkommt – und dennoch würden wir mit der Länge der Zeit für ein paar klare und lichtvolle Soprantöne dankbar sein.
Die Sättigung der tiefen Töne, die lockernde Wirkung, die gewisse Schwere einerseits, und die Kraft darin anderseits, verraten den Reichtum und aus diesem die Kraft der Liebe. Die Liebe – wenn sie gross ist – nimmt es mit den Grenzen nicht so genau. Sie steckt diese nicht aus und besetzt sie, sondern sie schwingt in ihrem eigenen Bereich und weicht dabei eher zurück, als dass sie an ein zweites prallt. Die Liebe umschliesst aber auch dasjenige, was in ihren Bereich fällt und gleicht so alles aus. Durch ihr Schwingen aber bewegt sie auch und weicht das Harte wieder auf, bis es endlich auch wieder in Liebe zerfliesst. Hier können wir uns an die Beobachtungen erinnern, die wir im Bereiche tiefer und tiefster Töne gemacht haben. Die Härte und Spannung der Dissonanz einer Sekunde (im Beispiel "C" und "D") wird hier aufgelöst. Das Schwingen ist so allgemein, dass die Grenze nicht so klar hervortritt. Wir können zwei miteinander angeschlagene Töne nicht gut voneinander unterscheiden, selbst dann, wenn sie bis zu 5 Stufen voneinander entfernt liegen – der Liebe ist alles eins! (Eine eingehendere und detailliertere Erklärung, an einem Beispiel gezeigt, findet sich im Kapitel "Vielklang" auf Seite 90 Mitte der Seite.
Die Liebe ergreift den ganzen Menschen, durchdringt und verändert ihn ebenso, wie die tiefen Töne auch vom ganzen Menschen wahrgenommen werden, und nicht nur vom Ohr alleine; sie durchdringen uns und wärmen (verändern) uns, sie ergreifen uns wahrhaftig, auch dem Wortsinne nach, durch ihr Schwingen und ihr Beben – wie uns die Liebe ergreifen kann, wenn sie uns heftig genug entgegenkommt.
Auch sind die tiefen Töne einer immensen Steigerung in ihrer Heftigkeit fähig, wie die Liebe es alleine ist. Ihre Macht im Schall- oder Hörbereich ist gewaltig und kaum vorstellbar, wie die Macht der Liebe, die den Liebenden bis zur Aufgabe seiner selbst bringen kann. – So fest umschliesst nur die Liebe, dass der Liebende zu Gunsten des Geliebten alles gibt, auch sein Leben. Einen solchen Reichtum an innerer Freiheit kennt sonst keine Macht, ausser die Liebe, die an nichts gebunden ist, ausser an dasjenige, daran sie sich freiwillig gebunden hat. Höhepunkte darin erkennen wir im Opfertode so manches Menschen – und den höchsten Punkt im Opfertode Jesu.
Umgekehrt sind die hohen Töne äusserst klar, rein und scharf bemessen. Sie lassen sich nur beschränkt steigern in ihrer Kraft, wie die Weisheit auch, die als solche weder stark noch schwach sein kann. Auch sind sie leicht – sie haben kein eigenes Gewicht. Sie können zwar bezaubern, aber nicht ergreifen. Da, wo man das Gefühl hat, dass sie ergreifen, liegt es nicht an der Tonhöhe selbst, sondern entweder an der Zunahme der Lautstärke – sofern sie im sehr leisen Bereich stattfindet – oder dann an der Abnahme der Lautstärke, dem Verklingen – mithin also bloss an der Veränderung der Heftigkeit solch eines hohen Tones, die allein wir als Bewegung wahrnehmen in der sonst eher als bewegungslos empfundenen Aussage seines reinen Wesens. Denn es liegt ja eben die Reinheit, Festigkeit und Absolutheit in den hohen Tönen ebenso wie in der Weisheit. Die Weisheit ist für sich abgeschlossen, bleibt sich selber ewig treu und ist eben dadurch für viele unzugänglich. Nur die Zunahme eines lichten Erkenntnisschimmers hin zu einer eigentlichen Gewissheit kann etwas Ergreifendes in sich bergen für jenen, dessen Liebesstürme ihn verwirren, sodass er in seiner besten Absicht nicht mehr erkennen kann, was er tun soll, um die Liebe durch das Ordnen ihres Wesens rein und dadurch nutzbringend erhalten zu können. Für einen solchen gleicht der nur ganz leise erklingende hohe Ton dem Lichtschimmer der Hoffnung am Rande seines Erkenntnishorizontes, dessen Zunahme ihn zu immer grösserer Dankbarkeit ergreifen kann und mit der Zeit auch eine zuversichtliche Ruhe in ihm zu erwecken vermag. Denn nur die Weisheit kann ausdrücken, aussprechen und festhalten und damit vernehmbar herausstellen, was die Liebe alles so fest in ihrem ursprünglichen Wesen umschlossen hält und was alles sie auch in ihr Sein einbezogen hat. Aber bei einer gewissen Intensität kann derselbe hohe Ton als unangenehm einengend empfunden werden, weil er – wie die Weisheit auch – das bewegte Wesen der empfindenden Liebe durch seine klaren Grenzen zu zerteilen oder dann in seine starre Ordnung einzuengen droht.
Umgekehrt empfinden wir das Verklingen – also die Abnahme der Stärke eines hohen Tones – nicht unbedingt als ergreifend im positiven Sinne des Wortes, sondern mithin auch eher bloss als erlösend vom Diktat der unbeweglich und unbestechlich festgehaltenen Ausformung – wie sie auch der Weisheit eigen ist, die aber bei dem Vorgang ihres Abnehmens fast eher einem Sich-Verlieren gleichkommt, wo dann erst durch den Verlust der einmal empfunden gehabten Klarheit die Liebe – durch ein Innewerden dessen – wehmütig ergriffen wird. Viel ergreifender wäre da beim Ausklang eines hohen Tones das gleichzeitige Abfallen der Tonhöhe, weil dann – entsprechend – die einmal ausgesprochene Klarheit zurückkehrte in ihren eigentlichen Grund, also in die wärmende Liebe, die dadurch zu neuer Lebenstätigkeit ihrer Schöpferkraft angeregt würde. Aber bei einem solchen Vorgang bliebe es ja nicht bei dem einen Tone. Erst eine ganze Reihe von Tönen könnte fähig sein, so stark zu ergreifen. Darum bleibt es bei der ursprünglichen Aussage, dass der einzelne hohe Ton für sich zwar bezaubern kann, aber nicht ergreifen in der Art, wie das sehr tiefe Töne sogar physisch zu bewirken vermögen. Und zusätzlich ist er nicht einmal einer grossen Variierung seiner Stärke fähig.
Kurz, wir haben zwei Extreme vor uns: In der Tiefe der Liebe die Wärme und in der Höhe der Weisheit das kalte Licht. Aus diesen beiden aber ist alles Lebendige hervorgegangen. Sie sind die Pole – wie die Pole der Erde – und sind wie diese auch unverrückbar, wenngleich sich alles – wie die Erde auch – um sie drehen muss. Die Wärme ist dabei zwar der Urgrund, aber aus ihr entsteht Licht. Das Licht wiederum ist zwar ein aus der Wärme Hervorgegangenes, erzeugt aber als solches nichts – es weckt höchstens wieder Wärme, jedoch nur dort, wo ein der Wärme Fähiges vorhanden ist. Während also die Wärme bei genügender Heftigkeit stets Licht erzeugen kann, kann das Licht umgekehrt die Wärme nicht erzeugen, sondern nur erwecken – dort, wo sie bereits vorhanden ist. Zwei Beispiele, je eines aus dem seelischen und eines aus dem Naturbereich, sollen das verdeutlichen:
Die Liebe eines Mannes hängt sich an das Schöne und Harmonische im Wesen der Gestalt eines Weibes. Wäre ein solches aber nicht vorhanden, so würde der Mann in der Kraft seiner Liebe sich eines vorzustellen beginnen. Seine Liebe drängete ihn dann nach einem Bilde (nach dem Licht und der Erkenntnis) über das Wesen seiner eigenen Liebe. Darum auch ist in der Schöpfungsgeschichte das Weib als aus dem Manne hervorgegangen geschildert. Das Weib aber erweckt mit seinem Wesen in sich selbst keine Liebe und achtet auch seines Wesens nicht so gross – ausser eben nur im Hinblick auf die Wirkung, die es im Manne hervorbringt. Es ist die äusserlich beschauliche Form der Liebe des Mannes und sucht den Mann nicht, oder nur als Bestätigung seiner selbst; aber der Mann sucht das Weib, und dieses erweckt in ihm Liebe.
Die Sonne, als ein sicher äusserst warmes oder glühendheisses Gestirn gebiert in der Erregung ihrer Wärme (=Liebe) das Licht. Dieses verströmt in ungeahnten und ungezählten Massen ins unendliche All und erzeugt darin keine Wärme mehr, ja ist selbst als Licht nicht unbedingt sichtbar, obwohl es sich kreuzend doch begegnet, wenn es auf die Strahlen anderer Sonnen trifft. Erst beim Auftreffen auf einen Gegenstand wird es wieder sichtbar. Aber so sehr es auch auf die hohen Berge trifft – mehr und länger als in die Tiefe der Täler, so vermag es dennoch die hohen Berge nicht genügend zu erwärmen, um ihren ewigen Schnee und ihr Eis zu schmelzen. Erst in der Tiefe der Täler, deren Luftschichten der Erwärmung fähiger sind, vermag es diese Wärme zu wecken und damit ein neues Leben zu zeugen, das sich in der Tier- und Pflanzenwelt kundgibt. Dieses natürliche Beispiel, welches zeigt, wie das Licht nicht Wärme erzeugen kann, sondern wecken nur, wo sie ruhend schon vorhanden ist, veranschaulicht zudem noch die Tatsache, dass nur die Wärme (=Liebe) neues Leben zeugt. So augenscheinlich das in der Natur zutage tritt, so verborgen mag es manchem im seelischen Bereiche vorkommen. Deshalb soll auch dafür noch ein Beispiel folgen – auch darum, weil gerade der Mangel dieser Erkenntnis, sowie der zu ihrer Anwendung nötigen Liebe die Erziehung heute so erschwert:
Wir wissen, wie wenig dass Kinder oft Notiz von unseren Wünschen und Vorstellungen nehmen, wenn sie unter sich im Spiel beschäftigt sind – aber oft auch in der Schulstunde, die nach dem Spiele in der Pause wieder beginnt. Das hatte auch einmal ein Lehrer erfahren, der sich stets alle Mühe gab, seinen Schülern ein Thema so fasslich als möglich zu erklären. Die Schüler aber waren bei ihm, ob seiner Milde, nie besonders konzentriert und kamen darum trotz der liebevollen Hingabe des noch jungen Lehrers nicht sehr weit. Da beschloss er, bei einem neuen Thema sich einmal geflissentlich keine grosse Mühe zu geben und seine Erklärungen nur ganz knapp zu halten, und seine Schüler erst noch streng zu examinieren, um zu sehen, ob und wie das Verständnis der einzelnen Schüler überhaupt beschaffen war. Dabei geschah es, dass ein Schüler nach einer auf diese Weise geführten Stunde zum Lehren ging und sich beklagte, dass er, der Lehrer, sich die Sache schön einfach und bequem mache, und sie als Schüler hätten alle Not, das zu fassen, was sie für die Prüfungen wissen sollten. Dabei erregte sich der junge Lehrer ausserordentlich stark und konnte in seiner Erregung längere Zeit nichts sagen. Nur sein Atem ging stets schneller und vertiefter, und lange standen sich die beiden im leeren Klassenzimmer schweigend gegenüber. Zuerst lachte der Schüler in sich hinein, über seinen gelungenen Wurf, der den Lehrer offenbar getroffen haben musste. Als dann aber nach einer geraumen Zeit noch immer keine Antwort kam, wiewohl der Blick des Lehrers ununterbrochen auf dem Schüler ruhte, begann sich auch in der vor-witzigen Kinderseele etwas zu bewegen. Er spürte den Schmerz, den sein Treffer dem Lehrer bereitete, und konnte doch wieder nichts oder nicht viel zurücknehmen, denn was er vorbrachte stimmte ja. Nach längerer Zeit brachte der Lehrer folgende Worte so verhalten als möglich, aber mit umso grösserer und heftigerer Atmung hervor: "Was soll ich dir darauf erwidern? Weisst du, wie oft ich mir nächtelang überlegte, was ich tun kann und soll, um eure Aufmerksamkeit für den zu erlernenden Stoff zu erhalten? Wie viele Möglichkeiten ich in meiner freien Zeit ausstudierte und später ausprobierte, nur darum, um euch in eurer Gleichgültigkeit endlich einmal anzusprechen zu vermögen. Habt ihr euch je – wenigstens in der Unterrichtsstunde – die Mühe genommen, auf den Stoff einzugehen, geschweige denn über die Stunde hinaus? Hast du dir je um meine Sorgen um euch Gedanken gemacht? Wohl nie!" Der Schüler spürte seine eigene Schuld immer stärker auf ihm lasten. Nicht nur war er einer wie seine Kameraden, der alles Entgegenkommen und alle Mühe eines andern gering achtete, sondern nun war er zu alledem noch einer, der die Frechheit hatte, den liebevollen Fleissigen zur Rede zu stellen, und damit seine eigene Ungerechtigkeit ihm anzuhängen. Er begann stets mehr zu spüren, in was für eine Situation er sich da manövriert hatte, und er spürte das verletzte und pulsende Leben seines Lehrers, dessen erregten warmen Atem er spürte, und der sich wie eine Last auf seine Seele legte. Und er begann sich zu schämen und wünschte, er hätte diesen Schritt nie getan.
Diesen Vorgang in dem Jungen musste wohl auch der Lehrer verspürt haben, denn er begann erneut zu reden und sagte folgendes zu ihm: "Bereue es nicht, dass du zu mir gekommen bist, denn du bist doch noch gekommen – als einziger! Wenn auch erst die Not deiner Gleichgültigkeit dich zu mir geführt hat, so hast du dennoch den Weg zu mir gefunden und hast mich damit berührt und kennen gelernt. Ja, du hast meine Worte angenommen und in dir wohl erwogen, und das war schön für mich, das zu sehen. Es war das erste Mal, dass einer eurer Klasse meine Worte an- und aufgenommen hat, sie erwogen hat und sie als richtig behalten hat. Ich wünsche dir auf deinem Lebensweg, dass du künftig stets so handeln wirst, so wirst du noch Vieles von mir lernen können, das ich dir ebenso gerne und von ganzem Herzen zukommen lassen würde, wie all den andern deiner Klasse, das aber vorerst nur in dir eine Annahme gefunden hat." Mit den letzten Worten legte sich auch der innere Sturm des Lehrers und sein Atem ging wieder leichter, während der Schüler Mühe hatte, Tränen zu unterdrücken – so stark war er mit der Heftigkeit und Innern Kraft der Liebe seines Lehrers konfrontiert worden.
Es war ein Erlebnis von bleibender Wirkung, und seine Art, dem Stoff, wie vorzugsweise diesem Lehrer gegenüber, war von da an anders und wurde mit der Zeit sogar innig, sodass er in einem gewissen Masse dadurch – wie auch durch seine Reden über den Stoff und den Lehrer – die ganze Klasse zu beeinflussen begann. Wie oft hatte doch vorher sein Vater ihm klar und deutlich gezeigt, dass er mit einer bis dahin so schlechten Schulbildung es einmal schwer haben dürfte, einen guten Beruf zu erlernen und damit auch gut zu verdienen. Er bewies ihm, dass er sich mit seiner Gleichgültigkeit ins eigene Fleisch schneide, was der aufgeweckte Junge nur zu klar einzusehen vermochte. Aber es vermochte ihn dennoch nicht zur Überwindung seiner Gleichgültigkeit zu bewegen. Das noch so helle Licht der Erkenntnis veränderte nichts! Das tat erst die durch die Verletzung in höchste Erregung gekommene Liebe des Lehrers. Sie vermochte etwas zu verändern – die Liebe im Schüler zu wecken – das volle Leben von blossen, ungeprüften Vorstellungsbildern zu entbinden, damit es frei und tätig wurde. Und die neu erwachte Liebe im Schüler erfasste das Wesen der Liebe dabei ebenso, wie nachher auch das Wesen des Stoffes, und er wurde einer, der die Dinge aus dem Grunde erkannte und begriff und sie nach ihrem Wesen beurteilte, und nicht nach der äussern Form.
Wenn wir doch über alle diese Vorgänge, die sich in der Liebe abspielen, mehr wüssten! Wir würden nicht nur die ganze Schöpfung besser verstehen, sondern vor allem auch uns selbst, die wir nach eben denselben Gesetzen gemacht sind. Es lohnt sich deshalb, tiefere Blicke in das Wesen der Liebe zu tun:
Die Liebe als Urkraft ist bestrebt, alles an sich zu ziehen und an sich zu binden, was sie ergreifen kann und mag, egal ob sie gut oder böse ist. Während die gute Liebe alles an sich zu ziehen versucht, um es andern weiterzugeben, sucht die schlechte Liebe alles zu ergattern, einzig und alleine für sich selbst. Eine solche Kraft hat eine unerhörte Beharrlichkeit und ihr ist nicht so leicht zu begegnen. Sie hält nicht nur die Erde zusammen (Gravitation) und zieht alle Materie so gewaltig an sich, dass der Mensch zu Tode stürzt, wenn ihm die Unterlage zwischen sich und der Erde fehlt, sodass er zu fallen beginnt; sondern sie hält auch die Ehepartner, ja die ganze Familie zusammen und verbindet ein ganzes Volk miteinander. Und nur, weil diese Liebe heute sich stets mehr dem Schlechten nähert, zerfällt Familie und Staat stets mehr in Einzelteile, die ihre Eigeninteressen verfolgen bis zur völligen Vereinsamung und Beziehungslosigkeit der Individuen zueinander. Solche Kraft der Konzentration auf sich selbst zu durchbrechen, erfordert etwa gleich viel Kraft, wie die äusserst schwierige Durchbrechung einer Atomhülle, als dem kleinsten Sinnbild für den eng begrenzten Egoismus, welcher alle Gedankenkräfte nur um seinen eigenen Kern kreisen lässt und sich deshalb selber begrenzt und unzugänglich macht, was durch die oft ergebnislose Behandlung durch Psychologen nur verdeutlicht und bestätigt wird. Nebenher verliert sich die Liebe aber auch in vielen Menschen aus dem Grunde, weil sie mit Materiellem, also Totem übersättigt wird und ihre Lebenskraft dadurch erlahmt.
Am Patriotismus, der Vaterlandsliebe also, welche heute zum Teil aus denselben Gründen stark im Schwinden begriffen ist, lässt sich die Kraft der Liebe – aber auch ihre Folgen – gut verdeutlichen! Diese Liebe-Art hatte zu allen Zeiten unzählige junge Männer auf das Schlachtfeld geführt, und der in Aussicht stehende Tod vermochte gar manchen Patrioten nicht zu erschrecken, weil seine Liebe am Ideal des Staates mehr hing als am eigenen Leben. Die erbittertsten Kämpfe und Kriege waren stets dieselbe Folge davon. Kein Feind vermochte diese Liebe zu zerstören – höchstens die Leiber ihrer Träger. Heutzutage, wo die Liebe sich verflüchtigt hat, bedingt durch den Überschuss materieller Güter, welcher den Ernst, als das Rückgrat der Liebe, erlahmen machte, ist solcher Patriotismus in der zivilisierten westlichen Welt weniger möglich, und deshalb so erbitterte Kriege wie früher weniger denkbar (wenn sie auch, der grösseren Vernichtungskraft der modernen Waffen wegen, grausamer sein könnten). So gesehen erscheint es so, als ob die grosse Kraft der Liebe dem Frieden eher hinderlich war. Diese Ansicht stimmt allerdings nur unter der Bedingung, dass wir den Tod einer Kraft mit "Friede" gleichsetzen, denn Friede ist ja auch, wenn von zwei verfeindeten Parteien kein Einziger überlebt. Die Familie, die Kinderseligkeit und die Seligkeit jedes Einzelnen sind aber mit dem Verschwinden dieser Kraft der Liebe ebenfalls dahin, genau gleich, als wären alle tot. Das zeigen die verbitterten Gesichter in den Städten, der Unmut der Jugendlichen – schon im frühesten Schulalter, das zeigt die Zunahme aller Suchtprobleme, angefangen vom Alkohol, über Medizinen bis zu den harten Drogen der Rauschgifte und am Ende auch die grosse Zunahme der Selbstmorde, welcher eine Auflösung der primitivsten Form der Liebe, der Eigenliebe, voran gegangen sein muss. Es ist wahr, dass nur die Liebeskraft (Anziehungskraft) schuld daran ist, dass es Felsen – Patrioten gleich – gibt, von denen man stürzen kann und an denen man zerschellen kann. Aber ohne diese einende Kraft muss anderseits alles zu zerfallen beginnen und Felsen müssten zu Sand und Staub werden, der lose alles bedeckt, weil ihn nichts mehr eint und zusammenhält; und alles Leben müsste ersticken, wie es die Wüste uns lehrt. Und wieder ist es wahr, dass die Wurzeln, als die "Liebes-Saug-Arme" der Pflanzen, sich am harten Gestein festhalten und es so begrünen, und mit der Zeit den Fels aufbrechen, aber nicht zu Sand, sondern zu Humus, und so eine Landschaft gestalten, welche den Menschen nicht nur nährt und durch die im Humus aufkommenden Bäume auch vor Regen und Sonne schützt, sondern durch ihre Vielfalt auch sein Gemüt erhebt und beseligt. Und der hohe starke Fels vermag durch die Kühlung der über ihm wuchernden Pflanzendecke in seinen Ritzen, Spalten und Höhlen das in seiner Kühle kondensierte Wasser zu sammeln und die Landschaft dadurch zu bewässern um damit vermehrtes Leben zu ermöglichen; und er vermag des weitern die im Sommer oft zu starke Kraft der Sonne durch seinen wandernden Schatten zu mildern, vermag den Stürmen seine Stirn zu bieten, damit sie nicht den Staub der Erde zu sehr aufrütteln, wegwehen und den Boden dadurch unfruchtbarer machen, während sie andernorts ganze Felder von Pflanzen und Tieren damit zudecken würden. Diese Felsen erhalten zwischen sich stets auch eine gewisse Luftfeuchtigkeit, die wie ein Schutz und Schirm die Blätter der Pflanzen umgibt und sie erquickt und stärkt zu erhöhter Atmung, und dadurch der Pflanze zu erhöhter Lebenstätigkeit verhilft.
Wenn also die Liebeskraft im Patrioten durch unzählig viele kleine Erkenntnisse – welche den Pflanzen an den Felsen des vorherigen Entsprechungsbildes gleichen – gewandelt würde in mildere und hoffnungsvollere Formen, und damit auch in andere Tätigkeitsgebiete verwurzelt würde – als die Ehre auf dem Schlachtfelde zu suchen –, so wäre damit ein Staatswesen zu schaffen, das ganz der vorher beschriebenen Landschaft gliche, wo eines für das andere da ist und eines aus dem andern hervorgeht. Wo der Einzelne – wie die Pflanze am Fels – nicht den ganzen Staat zerstören oder verändern will, sondern nur im kleinsten Gebiete seiner persönlichen Sphäre ein klein wenig von der Vaterlandsliebe auch auf seine Angehörigen und seinen Nächsten anwendet, sodass am Ende der Staat – nicht dem kahlen Felsen gleich – auf einem Schlachtfelde zu suchen ist, sondern – einem bewaldeten Berge gleich – in Gemeinschaft mit vielen andern seinesgleichen zu finden ist.
In wessen Liebe diese grosse Idee Platz hat, dessen Liebe entspricht den tiefsten Tönen mit der grössten auflösenden und ergreifenden Kraft und zugleich auch mit den unklarsten Konturen, in welchen alles seinen Platz finden kann. Es ist natürlich, dass dann bei der Weisheit, die jedes einzelne Ding klar umreisst und erfasst, schon mehrere Erkenntnisse nötig sind, um dem Gewicht einer derartig vollen Liebe-Erkenntnis entsprechen zu können. Eben deshalb braucht es entsprechend in den oberen Tonbereichen auch drei Töne, statt der zwei im untern (Liebe-)bereiche, um dasselbe Gewicht zu haben. Denn in jedem Begriffe der Weisheit ist zwar eine Portion Liebe gebannt enthalten, welche ja ursprünglich den Begriff erst werden liess. Aber es ist eben nur jener dem Begriffe entsprechende Teil der Liebe darin verborgen, und dieser ist in sich selbst nicht mehr frei, weil dem Begriffe dienend. Diesen Vorgang im Einzelnen beleuchtet, schildert das folgende Entwicklungsbeispiel:
Es sucht der bloss einen Tag alte Säugling schon die Brust seiner Mutter aus dem Urtriebe der Liebe nach Sättigung. Und hat er diese, so ist er befriedigt und sucht nicht weiter. Erst Monate später, wenn ihm seine Mutter nicht mehr genügend zu trinken zu geben vermag, wird er mit dem Löffelchen, gefüllt mit etwas Fruchtsaft und Mus, gespeist. Nun hat seine Liebe schon zwei Dinge, die sie ergreift; die Brust und das Löffelchen. Und später – wenn seine Liebe dies zu erkennen imstande ist – kommt noch die Zuneigung seiner Mutter hinzu. Wenn nun aber die Liebe des Kindes das Löffelchen verlangt, und die Mutter es ihm – weil zur Unzeit – nicht geben will, so steht diese Liebe vor der Erkenntnis der Unvereinbarkeit ihrer beiden Wünsche – der Zuneigung der Mutter und des Löffelchens zugleich. Das Kind wird zwar schreiend reklamieren, aber seine alles an sich binden wollende Liebe muss in ihrer Erregung erstmals erkennen, dass nicht alles vereinbar ist ohne eine gewisse Ordnung. Das ist der erste Schritt zur Weisheit! Seine Liebe kann ja alles haben, aber alles zu seiner Zeit. Natürlich ist das keine klare Gedankenweisheit oder gar Verstandesweisheit, die der Neugeborene da erklimmt, aber es ist tiefe Ahnung und ein Wissen im Herzen! Und Mütter, die ihren Säuglingen in solchen Dingen nachgeben, erzeugen aus der anfangs zuneigenden Liebe ihrer Kinder die Eigenliebe, welche sich stets zuerst in der Liebe zum Äussern zu erkennen gibt. Und wenn diese Liebe sieht, wie alles sich nach ihrem Willen zu fügen beginnt, erwacht in ihr der Wille zum Herrschen. Die Liebe zu Macht beginnt zu wachsen. Das Wachsen dieser verkehrten Liebe – der nach aussen gerichteten Eigenliebe – ist nicht nur beim Säugling durch die Lautstärke seines Schreiens wahrzunehmen, sondern entsprechend auch bei den tiefen Tönen in der Musik in der behauptenden Heftigkeit ihres Schalles ahnend wieder zu finden.
Wie schön wäre es doch, die vielen Mütter der oben beschriebenen nachgebenden Art würden solche Vorgänge besser erkennen und beachten, würden Zeit suchen und finden, diese Tragik der Entwicklung einer Liebe besser zu verstehen. Dann würden wir mehr Kinder finden, deren Liebe noch rein ist, wie die Kraft der tiefen Töne in der Musik, die sich schnell und leicht mit einem zweiten, wenn für sie anfangs auch noch Unverstandenen vereinen.
Aber auch bei nicht fehlgeleiteter und nach aussen gerichteter Liebe wird die Wärme der Tiefe sich stets steigern bis zum Lichte der Erkenntnis – aber dann nicht in die Lautstärke der Veräusserlichung, sondern in ihrer immer klareren Gediegenheit bis hinauf zum Lichte der vollen Erkenntnis (also entsprechend hinauf zu hohen Tönen), weil die Liebe in sich selbst nichts Fremdes duldet und alles ausgezeichnet haben will, was ihr nicht selbst entspricht. Darum sucht sie in sich nach allem, was ihrem Lebensgefühl nicht ganz entspricht, und sucht es zu wandeln oder auszuscheiden aus ihrem Bereich. Dafür sprechen so manche Prüfungen, die sich Liebende auferlegen können – entweder sich selbst oder dem Geliebten. Das allertiefste Beispiel dafür ist die Liebe Gottes, die durch ihre zwar weisheitsvollen, aber vor allem in der tiefsten Liebe begründeten Führungen, sowohl einzelner Personen, wie auch ganzer Völker, die Liebe ihrer Geschöpfe zu reinigen versucht, damit ihre Seligkeit der grösstmöglichen Freiheit, welche solch reiner Liebe zugrunde liegt, voll werde. Genau gleich, wie eine besorgte Mutter ihr Kind nicht zur Nahrungsaufnahme, sondern zur Aufnahme ihrer Liebe erzieht, so tut es auch die Liebe Gottes beim Menschen. Wohl erscheint es dem ahnungslosen Menschen dann oft ebenso hart, wie es einer ahnungslosen Mutter hart erscheinen mag, dem unzeitig bettelnden Kinde das Löffelchen vorzuenthalten. Denken wir an die Geschichte Hiobs! Hiob war glücklich in seinem Reichtume (also beim vollen Löffelchen), den ihm der Herr gewährte. Ja, er bettelte nicht einmal zur Unzeit. Und dennoch war die Antwort auf eine gewichtige Frage noch nicht gegeben worden – sollte Hiobs Liebe zum Herrn ganz rein sein: Liebte Hiob seinen Schöpfer des vollen Löffelchens wegen, oder würde er ihn auch lieben um seiner selbst willen? Würde er auf Gott und seinen Willen eingehen, oder verlangte oder erwartete er im unbeleuchteten Stillen seiner Liebe nicht doch umgekehrt – wenn auch nur ein wenig –, dass Gott auf ihn eingehen sollte. Das musste ihm die schwere Prüfung erst entdecken. Als er dann trotz seines grössten Elendes dennoch wieder die Liebe Gottes ergriff, und nun – seiner grossen Armut wegen – nur noch sie, um ihrer selbst willen, da auch war seine Liebe gereinigt und konnte sich ganz und für bleibend mit Gott vereinen. Da erst konnte auch sein äusserer – dem innern nun entsprechende – Reichtum wieder zurückkehren. Gott hat wohl um all das gewusst, aber eben Hiob noch nicht, und seinetwegen musste dieser Punkt beleuchtet werden. Die Weisheit dieser Erkenntnis ist wohl sehr hoch, sehr hart, und kommt einem auch kalt vor wie die hohen Töne der Musik, aber sie ist in ihrer vollen Reinheit notwendig, und es ist einer tiefen Liebe eigen, sie besitzen zu wollen; aber es liegt auch eine ungeahnte Seligkeit darin, sich so gereinigt der allerreinsten Liebe zu ergeben und eines zu sein mit ihr. Manche Menschen gibt es, die durch Not und Drangsal oder durch unsagbar schwere körperliche oder seelische Leiden derart gereinigt und ganz selig geworden, sich mit Gott und seiner Vorsehung, vereinigen konnten – wenn auch vielleicht nicht bereits schon für ihr ganzes ferneres Erdenleben. Die Rekonvaleszenz ist deshalb eine Zeit – wenn wir die Krankheit mit Geduld und Hingebung ertragen haben –, die jenen Stellen in der Musik gleicht, wo sich hohe, oft sogar dissonante Töne langsam harmonisieren, und bei ihrem leichten und sanften Herniedersteigen in der Melodie – gleich dem Tau des Abends – von den tiefen, der Liebe entsprechenden Tönen des Basses gleichsam bewillkommnend umfassen lassen und darin ihre endliche Ruhe finden. Und die Helfer und Betreuer solcher Kranken finden ihre Entsprechung in den darauf folgenden Bewegungen in der Tiefe des Basses, die einer dankerfüllten Regung der fürsorgenden Liebe gleicht. Am eindrücklichsten sind solche musikalischen Momente besonders dann, wenn die Melodie der hohen Töne von nur einem einzigen oder doch nur wenigen Instrumenten getragen wurde, denn in solchen Prüfungen sind wir Menschen ja auch meistens einsam. Aber auch umso ergreifender ist nachher der Empfang vieler Töne oder Stimmen der Tiefe, welche nicht nur die mannigfachen Regungen der dadurch neubelebten Liebe versinnbildlichen, sondern ebenso der Freude der daran teilgenommen Habenden und nun mit dem Gereinigten Vereinten entsprechen. Es stellt die Heimkehr von einer zwar äusserst anstrengenden, aber heilsamen Exkursion dar, anderseits aber auch das Ordnen im Lichte der unbestechlichen Weisheit zur Reinigung und Harmonisierung des Wesens zum möglichen Eingang in die pure, durch nichts mehr getrübte Liebe.
(Harmonische Melodien der Höhe, welche die Tiefen erregen und darin aufgenommen werden, sind Entsprechungen für Menschen, welche freiwillig und äusserst gewissenhaft in ihrem Innern solche Fragen betreffend der Art ihrer Liebe selber stellen. Ihnen fehlt die Dissonanz des äussern Zwanges zu diesem Erlebnis.)
Natürlich ist im Verlaufe eines Musikstückes diese Frage oft gestellt, an manches Instrument – in Teilaspekten auch –, aber dann auch immer wieder im Grossen und das Ganze umfassenden. Darin gleicht das Orchester mit seinen vielen Stimmen dem Gemüte des Menschen, welches sich mit vielem und in ganz verschiedener Weise beschäftigt. So muss beispielsweise nicht nur die Liebe zum Ehepartner geprüft und gereinigt werden, sondern auch jene zu den Kindern, welche beide einander gegenseitig auch wieder nicht tangieren dürfen, also wiederum Fragen aufwerfen, die wir im analysierenden Lichte der Weisheit lösen und ordnen müssen. Und alles zusammen, als Ganzes, müssen wir wieder mit der Liebe zu Gott oder zur Wahrheit – welche über allem stehen muss – in Einklang bringen. Das ergibt in uns selbst jene Vielfalt und jenen Vielklang, aber auch die mannigfachsten Unterschiede, wie sie im Klangbild eines Orchesters entsprechend hörbar dargestellt sind.
Natürlich sind nicht alle Stellen, wo die hohen Töne oder Melodien von den tiefen Tönen empfangen werden, den geschilderten innern Vorgängen entsprechend. Sobald eine in der Höhe der Weisheit oder der Erkenntnis ausgeführte Melodie von den tiefern Stimmen (Instrumenten) aufgenommen wird, wo also nicht begleitende Töne das Bild der Höhe aufnehmen, sondern wo sich das Melodienbild ganz in der Tiefe wiederfindet, wo fast alle Instrumente diese Melodie übernehmen, da entspricht dieser Vorgang demjenigen in eines Menschen Gemüte, da der sinnende Mensch zu einer schönen Erkenntnis gelangt und an dieser ein derartiges Wohlgefallen findet, dass er diesen lichtvollen Erkenntnisgedanken in seine Liebe aufnimmt, das heisst, ihn auch im alltäglichen oder irdischen Leben ausführen möchte. Dabei erfasst seine Liebe das Licht der Weisheit und wird als Kraft tätig, belebt den Willen und führt die Tat aus.
Es gleicht dieser Vorgang im Orchester aber auch der Mitteilung hoher und schöner Gedanken eines Einzelnen an andere, welche zwar aus sich selbst noch nicht zu solch reinen Weisheitshöhen vorzudringen vermögen, deren Liebe aber am Guten und Wahren der Weisheit hängt und diese in sich tatkräftig aufnimmt, wenn sie ihnen in irgend einer Weise begegnet. Denn die Tat, welche stets aus der Liebe kommt, ist der äusserlich verkörperte Gedanke, ist die äussere Realität innersten Lichtes, weshalb man an der Tat, oder an der Frucht, den innern Kern erkennen kann.
Immer ist also die Liebe für jede bewusste Tat der Grund von allem, denn nur sie ist die Kraft des Lebens, und es ist ein entsprechendes Zeichen der Zeit, dass die heutige Musik leicht und seicht geworden ist, wie die ohne Liebe betriebenen Verstandesgrübeleien der Wissenschaft, welche einen perfekten Menschen auf biologischem Wege kreieren möchte und nicht bedenkt, dass einzig die Liebe das Wesen des Menschen ausmacht. Nimmt man ihm diese, so ist er wohl leicht lenksam – wie das Tier durch seinen Instinkt auch –, aber er ist auch nicht mehr Mensch und hat keine eigene Kraft, denn die einzige Kraft des Menschen ist seine Liebe – wohin sie ihn auch immer ziehen mag! Wo es aber in der heutigen Musik schon tiefe und dann zumeist überdimensionierte Bassbewegungen gibt, geben sie den Takt, als das Sinnbild äusseren Lebens und Erlebens, also der Leidenschaft, an und entsprechen dabei der Liebe zum Sinnlichen, das heisst zu übermässiger und haltloser innerer, und äusserer Bewegung (Action) ohne Mass und Ziel.
Das war bestimmt eine ausgiebige Exkursion in den Bereich der Liebe und der Weisheit, aber ohne gehöriges Verständnis des Wesens dieser beiden Pole des Lebens wäre auch ein umfassendes Verständnis der Aussage der verschiedenen Tonhöhen nicht möglich.
Bleibt uns zur Betrachtung noch das grosse Feld der Töne zwischen diesen beiden Extremen – diesen beiden Polen – übrig. Es ist durchmischt von der Kraft der beiden und es entspricht deshalb auch am ehesten unsern Empfindungen. Es ist dabei die Liebe vermischt mit Weisheit, so wie es im Leben sich gestaltet, wo ebenfalls die hohe Weisheit für sich selbst nicht alles erfassen kann, was im Leben der Liebe begründet liegt, und wo die Liebe nicht erfassen mag, was sie behindernd einengt – für so lange, als sie sich nicht stark genug erregt, um im Lichte ihrer Erregung – die Weisheit schaffend – des sie Behindernden habhaft zu werden. So blind der eine Pol für das Wesen des andern ist, so praktisch ergibt es sich in ihrer Durchwirkung. Es ist nicht nur daran erkenntlich, dass uns diese Töne näher liegen, unserem Empfinden mehr entsprechen als die Extreme oder Pole – auch unseres eigenen Wesens –, sondern auch daran, dass ihre einzelnen Stufen sehr deutlich voneinander unterscheidbar sind und dass das Wesen des einzelnen Tones uns sehr viel gerundeter erscheint. Diese Töne des Mittelfeldes sind nicht so hart begrenzt wie die hohen Töne der Weisheit, haben aber dennoch ihre klare Linie von diesem Pole – sind aber anderseits auch nicht so auflösend, wie die tiefen Töne der Liebe, haben aber dennoch das Schwingen, oder – in der untern Mitte – das leise Beben von diesem Pole. Das macht sie in sich gerundeter und deshalb viel klarer unterscheidbar. Die Melodie bildet dann jenen Weg – einem Wanderwege gleich –, durch diese unterschiedlichen Erkenntnisstufen oder -höhen, welcher durch die der Melodie eigenen Rhythmik ein mehr oder weniger langes Verweilen in der Nähe des einen oder andern Polbereiches oder Poleinflusses ermöglicht.
Wenn wir wandern, so nehmen wir viele Dinge wahr. Die einen berühren mehr unser Herz und die andern eher unsern Verstand, und das ganz unterschiedlich von Mensch zu Mensch, derart, dass ein und dasselbe Vorkommnis bei einem mehr die Liebe anspricht und bei einem andern eher den Verstand.
So kann beispielsweise ein Ehepaar durch eine Landschaft wandern und besieht sich im Walde die Bäume und auf dem Felde die Blumen. Der Mann denkt im Walde darüber nach, wie unerhört imposant doch die grossen und mächtigen Bäume gestaltet sind. Er empfindet förmlich die Kräfte, welche an und in diesen Bäumen wirken und, daraus folgernd, die grosse Weisheit, welche diese Konstruktionen alle entworfen hat, und spürt, wie erst diese die Voraussetzung für den ganzen Wald überhaupt bilden, welcher wiederum die Voraussetzung für das vielseitige, im Walde keimende Leben ist. Kurz, er führt alles auf einen Grund zurück und geht mit Andacht und aller Wärme seiner Liebe auf diesen Grund ein. Seine Frau wiederum spürt eher die Kühle und die Finsternis des Waldes und überlegt, dass diese beiden lebensverneinenden Attribute des Waldes wohl schuld daran sind, dass die bunte äussere Pracht der Blumen im Walde keinen Einzug halten kann. Sie denkt also über die Folgen nach und das Klima des Waldes berührt sie im weiteren ebenso wenig wie das vielgestaltige Leben, das es ermöglicht oder die grossen Gedanken, welche des Mannes Gemüt und Liebe erregen, sodass mitten in der Dunkelheit des Waldes sein Gemüt erhellt wird von der in ihm lebendig und dadurch kräftig gewordenen Liebe.
Umgekehrt im Felde, wo die Frau begeistert die Pracht der Blumen geniesst und ihre Düfte beglückt einatmet und sich überlegt, wie doch aus ein und demselben Grunde und Boden so verschiedenfarbige Blumen entspringen können mit so verschiedenartigen Düften und mit so verschiedener Wirkung auf das Gemüt, und sie überlegt sich weiter, dass all das im Wesen einer jeden einzelnen Pflanze doch irgendwie schon vorhanden sein muss, und wie also auch im Boden, in der Luft und im Lichte das alles unerkannt vorhanden sein muss, ansonst es die Blumen nicht so verschieden und gesondert aufnehmen könnten, dass am Ende keine einer andern gleicht. Mit dem allem beschäftigt sich ihre Liebe, als ihr Grund des Lebens, die wieder nach dem Grunde fragt. Der Mann hingegen überlegt sich an diesem Ort eher, wie hoch das Gras schon steht und wann es wohl gemäht wird – ob man wohl noch durch dasselbe gehen darf. Er spürt den morgendlichen Tau an seinen Beinen, den er beim Gehen von den am Wegrand stehenden Gräsern und Kräutern streift, und merkt dabei, auf welche Weise die Wiesen von der Natur getränkt werden können, wenn der Regen ausbleibt. Er bleibt eher beim Lichte seines Verstandes, und die Wärme der Liebe regt sich weniger, weil ihn die äussere Pracht der Farben nicht so sehr anspricht wie die innere Reife und Ordnung einer Kraft, wie er sie in den bewundernswert architektonischen Formen der Bäume im Walde fand.
Wenn nun beide erzählen würden, wie die Wanderung war, so würde der Mann ungleich länger beim Waldabschnitt verweilen, während umgekehrt seine Frau ungleich länger der Wiesenerlebnisse gedenken würde, obwohl in der Wirklichkeit beide Wegabschnitte gleich lang gewesen sein mögen. Die Rhythmik der Melodie also erzählt uns durch das verschieden lange Verweilen in den einzelnen Tonbereichen von ihrem Wesen, das entweder eher der Liebe und der warmen Innerlichkeit, oder dem äussern Lichte der Weisheit verwandter ist. Sie zeigt dasselbe aber auch durch die Schnelligkeit ihrer Tritte, wobei die schnellen (= kurze Noten) eher dem Äussern den Vorzug geben, während die längeren und verweilenden (= lange Noten) dem innern Wesen der Andacht folgen.
Die innere Kraft einer Melodie aber erkennen wir vorzüglich an den Tritthöhen, die sie überwindet; ob sie also kapriziöse Sprünge vollführt, den Überschwang ihrer innern Kraft verdeutlichend (dem Wesen Jugendlicher, aber auch Künstlern entsprechend, welch letztere nur durch die Bewahrung ihrer Jugendlichkeit und Ursprünglichkeit zu dem geworden sind), oder ob sie eher in gleichmässigen Höhentritten sich vorwärts bewegt (dem Wesen des Erwachsenen entsprechend), oder auch mühselig, leidend in kleinsten Schritten die Höhen überwindet (wie das gebeugte Alter), oder zuletzt gar kindlich "ungeschickt" manchmal mit Hilfe eines oder mehreren tonartfremden Halbtonschrittchen eine Höhe oder ein Gefälle fast kletternd überwindet, was oft einen äusserst grossen Liebreiz im Hörer bewirken kann (wie er bei Kompositionen Mozarts sehr oft zutage tritt).
So vieles finden wir in den Bewegungen der Melodie durch den ganzen Tonbereich! Aber die Begleitung oder – in der Entsprechung – die Umstände, gestalten sich zumeist ganz anders, oft zwar gleichsinnig, oft oder mehrheitlich aber auch gegenteilig, wie das Schicksal oder die Führung der Menschen auch, welche zumeist durch widrige Umstände ein Talent, eine Weisheit oder gar die Kraft der Liebe zu erwecken und zu stärken bestrebt ist, und nur selten durch gleichsinnige Umgebung das Leben und die Liebe eines Menschen fördert, weil das erste eine aktive Stärkung, und das zweite bloss eine passive Stärkung ist, welche eher einer Minderung der Schwäche gleichkommt, als einer wirklich positiven Stärkung selbst, und darum zumeist nur bei ganz Schwachen, die Zeit der grössten Schwäche hindurch, geschieht. Darum ist die Begleitung sehr oft weniger prägnant und ausgeprägt in ihrem bewegenden Einfluss auf die Melodie, gleich wie gar viele äussere Umstände auch, welche die Art unseres Ganges bestimmen, ohne dass sie sichtlich auf uns einstürmen. Wo eine Begleitung hingegen drastisch bewegend wirkt, entspricht sie sehr oft eher der menschlichen Gesellschaft und ihren vereinten Gefühlen, als der umgebenden Landschaft und bewirkt darum auch in der Musik ein Aufnehmen und Wiedergeben von Melodienfetzen ähnlich den Gedankenfetzen bei grossen Erregungen, die, einmal hingeworfen, die ganze Gesellschaft – der Töne, wie der Menschen – stark bewegen und erregen können.
Alle diese Verhältnisse ergeben zusammen das so Bunte und Lebendige der Musik, welches – wie das Leben selbst – oft nicht zu begreifen, sondern nur zu erahnen ist. Immer aber gibt es – wie im Leben auch – wieder polarisierende Momente oder Stellen, wo die grosse, endgültige Frage wieder an den Hörer (oder im Alltag an den Menschen) herantritt, welche ihn sich alleine gelassen fühlen lässt, bis in ihm eine Entscheidung gefallen ist, und er bei einer positiven Wendung wieder zurückkehrt in den neu geordneten und gereinigten Schoss der Liebe.
P.S.
Eine Frage wurde in diesem Kapitel durch eine Feststellung nur aufgeworfen, aber nicht beantwortet. Jene, warum bei der viergestrichenen hohen Oktave, also in einem sehr hohen Tonbereich, die Dissonanz einer Sekunde nicht mehr wahrnehmbar ist. Besser wäre es zwar, diese Frage beim Kapitel über den Vielklang zu beantworten, aber dennoch kann hier so viel gesagt werden, dass bei ganz hoher Weisheit zwei einander widersprechende Fragen, Feststellungen oder Erkenntnisse keine Dissonanz ergeben, weil in ihr alle Widersprüche gelöst sind, zum Beispiel die Frage nach der völligen Freiheit, verbunden mit der Frage nach deren Begrenzung, oder auch die Frage nach der Grenze der Unendlichkeit. Denn sie erkennt: Freiheit ist stets durch die Freiheit eines Zweiten begrenzt. Gibt es aber kein Zweites, so ist die Freiheit darin beschränkt, dass sie in ihrer Liebe nicht auf ein Zweites eingehen kann, ihr eigenes Wesen darin also auch nicht erkennen kann, noch ihre Liebe darin stärken oder gar wandeln kann. Also ist die Freiheit im Lichte der Weisheit gesehen stets begrenzt; Entweder durch eine Zweite, oder aber durch das Fehlen einer Zweiten und der damit verbundenen Möglichkeiten. Aber noch viel mehr ist im Lichte der vollen Weisheit die Unendlichkeit in ein und derselben Sache (zum Beispiel der Zeit oder des Raumes) begrenzt, und zwar durch sich selbst, auf die Zahl "1". Denn eine halbe Unendlichkeit ist keine Unendlichkeit, und zwei Unendlichkeiten sind ein Unding, weil sie notwendigerweise an sich gegenseitig eine Begrenzung erleiden würden, und somit nicht unendlich sein können.
Wir haben damit nochmals einen der beiden so unerhört gewaltigen Pole des Lebens (Wärme und Licht, oder Inneres und Äusseres) berührt, welche alles Leben bedingen, die Weisheit nämlich, als den äussern Pol, dessen Gegenpol das Innere, die Liebe ist, welcher durch das Verbinden von vielem Begrenzten ein unbegrenztes Ganzes macht und das Unendliche ausfüllt mit Endlichem.
Wenn wir die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder, Erläuterungen und Entsprechungen auch noch so gut einsehen, begreifen und ihnen folgen können, so dürfen wir dennoch nie eine Musik danach beurteilen wollen, denn die Vielzahl der zu beachtenden Momente wäre viel zu gross, als dass wir sie fassen könnten; und überdies würden wir die eingangs erwähnte Feststellung durchgehends unbeachtet lassen, dass die Musik nur das Gemüt anspricht. Bei jenen Stellen aber, die uns besonders nahe gehen, und die wir nicht so leicht vergessen, können wir unser Inneres unter Umständen dadurch beruhigen und bereichern, dass wir sie in der hier beschriebenen Art zu verstehen versuchen. Dann werden wir möglicherweise ungeahnte Blicke in unser eigenes Gemüt tun können.
24.1.89 und August 89
nach oben
DIE INTENSITÄT DES TONES
Jeder Ton als solcher ist die Unterbrechung der Stille, also sind die Töne in der Stille begründet. Selbst in einem Gewirr vieler Töne ist ein jeder neue Ton die Unterbrechung der Stille, jener Stille nämlich, die den Raum des nun erklingenden Tones beinhaltet; und wäre es nicht so, wie möglich könnte er als solcher gehört werden. Wo nämlich bereits ein solcher Ton erklingt, kann ein gleicher zweiter nicht mehr gehört werden; einzig eine Zunahme der Erregung kann noch wahrgenommen werden. Je nach der Art und Weise aber, wie ein Ton erklingt, empfinden wir nachträglich die vorangegangene Stille oder Ruhe (Ton-Ruhe); aber darum kann genau so gut gesagt werden, dass die Art und Weise der Stille oder Ruhe das Wesen der Töne mitgestaltet. Ein lauter und heftiger Ton in eine Stille gegeben, schneidet diese Stille oder Ruhe, und diese Stille wird nachträglich als begrenzter Raum, als einen Zeit-Raum empfunden. Die Leere der Stille wurde durch den Ton begrenzt. Also vermag umgekehrt nur eine Leere der Stille einen lauten Ton zu bedingen. Denn der laute Ton ist in sich selbst so leer, wie ehedem die Stille. Er belegt einfach den ihm zugedachten Raum, bewirkt aber als solcher und als solches nichts, als dass er mit seinem scheinbaren Etwas das ebenso scheinbare Nichts verdrängt. Er geht nicht über seine Grenze hinaus, sondern belegt ganz einfach seinen Platz, etwa vergleichbar einem Atome, welches nichts anderes ist, als ein winzig kleines Kraftfeld im unendlichen Raume. Da, wo es ist, unterbricht es die Unendlichkeit mit seiner Endlichkeit, aber in sich selbst ist es genauso, wie die Unendlichkeit selbst, eine Kraft in einem Raum; nur eben in sich begrenzt, sowohl der Kraft, als auch dem Raume nach, und deshalb endlich. Aber auch seiner Wirkung nach ist es begrenzt: durch die Abgrenzung der speziellen Kraft und des speziellen, von ihr ausgefüllten Raumes. Wie alles Starke uns als Aufforderung entgegenkommt, uns selbst dem Starken anzupassen, so kommen auch starke Töne, die an unser Ohr dringen, im Imperativ – nicht etwa um Einlass nachsuchend, sondern sich Einlass verschaffend. Wir können sie nicht überhören und haben mit unserm innern Ausgleich, nach dem sie gebieterisch verlangen, so sehr zu tun, dass wir uns mit ihrem eigentlichen innern Wesen nicht gleichzeitig mehr auseinandersetzen können. Zu sehr sind wir mit dem Ertragen beschäftigt, als dass wir im Erkennen tätig werden könnten. Es verhält sich mit den Tönen in dieser Beziehung nicht anders, als es sich mit allen andern Eindrücken verhält: dass die starken uns auffordernd oder herausfordernd entgegenkommen, oder - deutlicher gesagt, entgegentreten:
Während wir eine Hitze als unser ganzes Wesen erlahmen machend empfinden, und eine grosse Hitze gar als tödlich empfinden, nehmen wir einen geringen Hitzegrad, den wir besser "Wärme" nennen, als belebend wahr. Wir verspüren in ihr die Bewegung und das Bewegende, während wir in der Steigerung das Erlahmende verspüren.
Ein anregendes Mittel in der Medizin erfährt bei fortgesetzter Steigerung der Gabe stets die Umkehrung seiner Wirkung, in ein lähmendes Gift (z.B. Nikotin).Aber auch die Empfindungen des Gaumens folgen demselben Prinzip. Der saure Saft der Johannisbeere, der uns bloss sauer vorkommen will, wenn er, unsere Gefühle herausfordernd, unseren Gaumen und die Zunge benetzt, gibt uns mit seinem heftig starken Eindruck nur die Grenze seines Wesens kund, die wir auszuhalten oder zu ertragen genötigt sind. Würde die Heftigkeit seines Eindruckes auf unsere Sinne gemildert durch eine Vermischung mit Wasser, so könnte mit zunehmender Verdünnung die Säure so stark gemildert werden, dass wir nebst dieser auch noch die Süsse seines Zuckers verspüren oder wahrnehmen könnten. Bei noch grösserer Verdünnung, oder Milderung seines Eindruckes auf unsere Sinne, würden wir sogar das Bittere, welches ebenfalls in ihm liegt, zu empfinden beginnen.
Aber auch mit unseren Augen können wir dieselben Gesetze feststellen: Wenn wir eine Kerzenflamme betrachten, so können wir ihr Inneres erkennen und ihre Erscheinung zergliedern in das blaue Herzflämmchen, das zuinnerst und zunächst am Docht sein Dasein fristet, in die gelbe Flamme, die sich, in der Helligkeit nach aussen hin zunehmend, über dem Herzflämmchen erhebt, und in einen Schein, welcher sich um die Flamme verbreitet. Je dunkler nun der Raum ist, und je heller und grösser die Flamme, desto geringer und undeutlicher wollen uns diese Unterschiede erscheinen, weil die Heftigkeit des Eindruckes auf unser Auge durch die grössere Ausschliesslichkeit zunimmt. Je dunkler der Raum, desto heller und undifferenzierter erscheint uns also die Flamme und umgekehrt: je heller die Flamme, desto dunkler erscheint uns der Raum. Je heftiger die Flamme, desto geringer – also verhältnismässig schwächer und kleiner – erscheint uns der Schein; je kleiner oder gedämpfter die Flamme, desto grösser und verhältnismässig heller empfinden wir den Schein. Weder die Dunkelheit noch das grelle Licht lassen uns das Leben empfinden, aber durch den milden Schein wird das Wirken des Lebens in der Flamme sichtbar, und die Kraft desselben gibt sich uns als alles Leben bedingenden Urgrund (für das Sehen und Schauen) kund. Die schwache Flamme lässt ihr Zentrum – ihren Grund – erkennen, und ihre Wirkung wird in ihrem Scheine offenbar. Der Grenzraum des Lichtes und der Dunkelheit wird nicht nur breiter, sondern die Grenze selbst auch stets undeutlicher. Das absolute Dunkel wird durch den Schein der Flamme belebt und kommt darin in einen mit dem Lichte ausgewogenen Zustand – tritt für unser Auge also erst jetzt in Erscheinung – und wir erkennen im Scheine sowohl die Dunkelheit als auch das Licht, wie sich beide – ringend – in einem Gleichgewicht befinden. Ohne das schwache Licht aber wäre die Dunkelheit – als Nacht oder Tod für unser Auge – diesem weder sicht- noch erlebbar.
Geradeso verhält es sich mit leisen Tönen. Wenn ein solch leiser Ton sich gewisserart der Stille entwindet, so empfinden wir die vorangegangene Stille nachträglich nicht als Leere, sondern als einen absolut ausgewogenen Zustand (der Kraft, denn nur Kräfte lassen sich auswägen). Wir empfinden sie auch nicht als Raum, weil Zustände keinen Raum benötigen, sondern verspüren in solchen Tönen das Leben oder die Lebenskraft, welche durch ein Ungleichgewicht oder eine Unausgewogenheit manifest wurde; sich verraten hatte, sich uns dadurch aber auch mitgeteilt hatte und dadurch unsere eigene Kraft in eine Erregung oder kleine Unausgewogenheit gebracht hatte. Ähnlich wie die Liebe, wenn sie sich manifestiert und sich dadurch – absichtlich oder unabsichtlich – zu erkennen gibt, wieder Liebe erregt im Erkennenden, so geschieht durch das sachte Entstehen eines Tones ein ebenso sachtes Aufnehmen des Tones selbst, und ein Darauf-Eingehen; es bildet sich also ein Ungleichgewicht im Aufnehmenden, welches derart gestellt ist, dass es mit dem aufgenommenen Tone zusammen ein neues Gleichgewicht bildet.
Ein solch sachter oder leiser Ton, der sich der Stille entwindet, bewirkt also viel, ja unendlich vieles! Jeder Aufnehmende muss alle seine Kräfte bewegen und in eine neue Ordnung bringen, um mit dem aufgenommenen Tone in ein Gleichgewicht zu kommen. Ein solcher Ton ist nicht einfach eine Einheit mehr, gewissermassen die Zahl "eins", die zu einer andern Zahl von Ideen hinzugezählt werden kann, sondern er ist eine alle vorhandenen Kräfte bewegende und neu ordnende Kraft. Denn er ist und wirkt mehr inwendig als nach aussen. Er ist mehr Sein als Schein und deshalb lebendig; wirkt auch belebend auf das Innere, während ein starker Ton dem Schein der Äusserlichkeit entspricht, auf den wir uns einzustellen haben, der uns aber weiter nichts mehr offenbart – geradeso, wie die sehr helle Flamme nur bewirkt, dass wir unsere Blicke entweder von ihr wenden, oder unsere Augen etwas zukneifen. Die schwache Flamme aber enthüllt unseren Blicken ihr eigentliches Wesen, und wir dringen tief in dasselbe ein mit unserem Blick, wenn wir die entsprechenden Regungen in uns selbst, in ihr gleichnisweise dargestellt, erkennen.
Ein feines Ohr (oder besser: ein aufnahmefähiges Gemüt) wird dasselbe auch vernehmen, wenn es aufmerksam einem lauten und einem leisen Tone lauscht. Der laute Ton nimmt einen klar bemessenen und abgesteckten Raum ein. Er zieht gewissermassen wie ein Band durch die Stille, die er zerschneidend unterbricht. Innerhalb seiner Ränder ist die Stille ausgefüllt mit "Ton", während ausserhalb derselben die Stille bleibt. Ein leiser Ton hingegen lässt eine ihm eigene Schwingung erkennen, welche sich zwar auch in einer Bandbreite oder in Grenzen hält, aber wir erkennen diese Grenze nicht genau, denn je genauer wir lauschen, desto erregter kommt uns erstens der Inhalt vor und desto breiter erscheint uns zweitens jener Raum, bei welchem wir ehedem das Empfinden hatten, dass es der Grenzraum war. – Wieder gleich dem Erlebnis bei der schwachen Kerzenflamme, welche uns ihr Inneres offenbart, und bei welcher der Schein – der Schauplatz des Ringens von Licht und Dunkelheit – nie so recht begrenzt werden kann, und uns deshalb mehr berührt, belebt und dadurch stärkt als scheinbar klare Grenzen, welche aber nur darum klar scheinen, weil sie unseren Sinnen gegenüber gebieterisch auftreten, sodass wir das Feld einfach räumen und dadurch weiters keine Erlebnisse mehr haben.
Noch deutlicher als irgend sonst wo erleben wir diese Erscheinung in einem relativ kleinen, aber hallenden Raum, wie ihn beispielsweise die Badezimmer oft darstellen. Wer in einem solchen Raume, nach vorheriger gehöriger Sammlung in der Stille, einen leisen, zarten Ton summt oder singt (als offenes "A"), der erkennt bald, wie viele und abermals viele Bewegungen in diesem Tone enthalten sind, und merkt stets klarer, wie unsicher er die eigentliche Höhe ausmachen kann, und wie wenig klar er sich selbst über die Intensität des Tones werden kann, weil diese ständig zu- und abnimmt. Diese Erscheinung aber liegt nicht etwa an der menschlichen Stimme, denn der leise Ton eines Klaviers verrät uns genau dasselbe. Ja, alle auf Instrumenten erzeugten leisen Töne lassen das Beschriebene erkennen.
In seiner Sachtheit und Zartheit empfinden wir einen Ton überhaupt eher als eine Frage, während ein lauter Ton einer Aufforderung gleichkommt und beherrschend wirkt, und dadurch seine Äusserlichkeit manifestiert. Denn nur das Äussere kann den Menschen beherrschen, indem es sein Inneres verschüttet und untätig macht. Das Inwendige alleine aber ist die Kraft und das Leben, und es belebt auch das Innere Anderer; und wäre es nicht so, wie würden wir Menschen dann von Gott belebt, wenn nicht durch sein feineres, inneres Wirken.
Ebenso belebt uns eine Frage oft ungemein, während uns eine Behauptung oft lähmen kann, oder einen Starken vielleicht zu einer Gegenbehauptung herausfordert. Nach einer solchen aber bliebe es wieder ruhig, dieweil eine Frage noch ständig bohren kann.
Verdeutlichen wir uns das Gesagte am Tone eines Instrumentes, welcher für sich alleine im ureigentlichsten Sinne nicht als musikalisch empfunden werden kann - am Ton des Paukenschlages! Ein lauter Paukenschlag setzt einen Punkt, ob er in die Stille oder in den Lärm einer lauten Musik gegeben wird. In der Stille ist er Anfangspunkt, im Lärm der Musik entweder Höhepunkt oder Endpunkt. Nicht umsonst wird die Pauke vor allem bei Marsch- und Militärmusik reichlich eingesetzt. Sie gebietet mit einem jeden Schlage den Beginn eines Trittpaares: "links – links – links –", der laute Ton des Imperativs.
Wie ganz anders hingegen nehmen sich ganz leise, sachte Paukenschläge aus; ganz gleichgültig, ob sie in die Stille gegeben werden oder entlang zarter Töne und sanfter Melodienfolgen, gleichsam mahnend, sich hinziehen – oder leise pochend dazwischentreten. Wie herrschend sind sie im Äussern der Lautstärke, gleich dem Donner im Unwetter, und wie väterlich milde in der Stille ihres innern Wesens, gleich dem Pochen des liebenden Herzens!
Wenn im Aufruhr und Gewühl des lauten Orchesters Paukenschläge zu hören sind, so erleben wir sie zumeist als gewaltsam ordnende Kraft, welche alle Kräfte des Orchesters übertrifft, und sie gleichen dann der aussen wirkenden Kraft Gottes, die richtend ordnet und beherrscht, ähnlich wie Blitz und Donner im Gewitter, wo grellstes Licht und alles übertönender Donner den Druck der Schwüle und die Kraft des Sturmes brechen - oder ähnlich der Sintflut, wo das äussere Wirken Gottes die Menschen gefangen nahm im Tode. Solche Paukenschläge gleichen Verurteilungen, welche den Schuldigen treffen und beherrschen – aber ihn nicht ändern. Eisig wird der Verurteilte bleiben in seinem innersten Trotze. Dieselben Paukentöne aber können auch – wenn sie ganz sachte und leise an unser Ohr dringen – unser Innerstes ergreifen und erschüttern, gleichsam bebend machen, wie es nur Fragen zu tun vermögen – väterliche Fragen, wie sie sich durch das Pochen unseres Gewissens kundtun. Sie machen uns nicht verstummen in eiskaltem Trotz, sondern bewegen uns in unserer Unvollkommenheit und muntern uns auf, doch endlich das Bessere anzunehmen, das Inwendigste, die Liebe nämlich, von der es wieder heisst, dass Gott sie ist.
Wie sind doch – eigenartig genug – dieselben Paukentöne einmal Tod und einmal Leben zugleich, einmal äusserlich wirkend und einmal innerlich wirkend – ähnlich dem Wirken Gottes, das uns äusserlich Gesetze gibt und Schranken setzt im Wesen der Natur, und uns innerlich zugleich erheben will über alle Schranken der Krankheit und des Todes, durch die Kraft und das Opfer der Liebe. Wie unendlich nahe kommt Er uns da, und wie unendlich weit und hoch steht Er im andern! Ebenso nahe gehen uns die leisen Paukenschläge, wie die pochenden Fragen des Liebesgewissens, und ebenso weit stehen sie in ihrer lauten Stärke von unserem Herzen entfernt, als Richter der äussersten Verhältnisse.
Betrachten wir zuletzt noch ein Orchester als Ganzes. Ja, es ist wahr, es kann uns oft auch bei relativ grosser Lautstärke noch mitreissen, wenn wir noch jugendlich genug sind, und deshalb noch grosse Freude am Äussern – am Sinnlichen – haben, und zudem die Musik im Grossen und Ganzen im Harmonischen bleibt. Aber selbst dann wird es bei weiterer Steigerung – hin, bis zum Toben des Orchesters – zu einer immer grösseren Distanzierung zwischen uns und dem Orchester kommen. Wir nehmen, nach anfänglicher Miterregung, gewisserart unbeteiligt den Aufruhr aller Töne wahr, und vielleicht erwarten wir sogar die Endpunkte setzenden Paukenschläge – jedenfalls nehmen wir sie als erlösend wahr. Wenn dann aber in die eingetretene Stille oder Ruhe leise, reine Töne sich zu erheben beginnen und in sanfter Melodienfolge sich hinziehen und mit der Zeit vermehren, so nehmen wir innig teil an dieser Musik und werden durch die verinnerlichte und gesänftete Kraft mehr erregt und ergriffen als von allem andern vorher, und wir empfinden geradeso, wie die Worte aus einem Lied es ausdrücken:
Da zieht die Andacht wie ein Hauch
durch alle Sinne, leise,
da pocht ans Herz die Liebe auch
in ihrer stillen Weise.
Nach der Betrachtung der zwei Pole eines und desselben Tones – laut und leise – bleibt uns noch zur Betrachtung übrig die Bewegung zwischen diesen beiden Polen, also die Zunahme oder Abnahme der Lautstärke, was leicht erratbar die Bewegung von innen nach aussen und von aussen nach innen versinnlicht. Die Zunahme eines und desselben Tones ist nicht bei allen Instrumenten möglich. Während Streich- und Blasinstrumente den Ton-Laut steigern können, ist das den Zupfinstrumenten, der Harfe, dem Klavier und den Schlagzeugen beim einzelnen Ton nicht möglich; dort kennen wir nur die Abnahme – das Verklingen also.
Wenn wir sanfte Streichertöne sich steigern hören, besonders im mittleren bis schwach höheren Tonbereich, so empfinden wir diese Bewegung der Lautstärke als innig. Das Anschwellen eines Tones ist dabei vergleichbar dem Anschwellen der Liebe, der Begeisterung oder der Dankbarkeit, welch letztere beide wieder nur eine bestimmte Form der Liebe sind. Dieses Innigwerden kann uns sehr zu Herzen gehen, solange es leise Töne sind, die sich sachte ins Heftigere und Lautere steigern. Dieselbe Steigerung kann uns aber auch mitreissen, wenn sie von laut zu sehr laut geschieht. Also ist nicht jede Steigerung unbedingt von gleichem Wert, und deshalb auch nicht von gleicher Wirkung beim Hörer – ganz unberührt davon, welcher Steigerung der Hörer den Vorzug geben wird, was wiederum nur eine Folge seines eigenen Wesens ist. An einem ausführlichen Beispiel wollen wir diese Steigerung vom Leisesten ins Leise, und von da über das Lautere ins Laute und Lauteste in ihrer Wirkung zu erkennen versuchen.
Vergegenwärtigen wir uns einen Knaben von etwa acht Jahren Alters, der in einer so genannt gut situierten Familie aufwächst. Der Haushalt wird korrekt geführt; alles ist sauber und ordentlich – tadellos. Vater und Mutter sind beschäftigt mit Geld verdienen einerseits und mit gesellschaftlichen Verpflichtungen anderseits. Die übrigen Kinder, welche schon älter sind, gehen bereits eifrig ihren Pflichten, aber auch Lustbarkeiten ausserhalb des Hauses nach. Alle wurden von Dienstmädchen betreut und aufgezogen, die jeweils nur für ein oder zwei Jahre verpflichtet waren – nicht, um zu dienen, sondern um die Sprache zu lernen. Dass unser Knabe dabei kein Philosoph werden wird, ist klar; und es ist schon viel, wenn er bei all der kultivierten Äusserlichkeit überhaupt zu merken beginnt, dass es, als Gegensatz dazu, eine Innerlichkeit gibt, und er gar feststellen könnte, dass das auch bei ihm eigentlich der Fall sein müsste.
Nun geschieht es aber, dass ein äusserst bescheidenes, dienstfertiges Mädchen mit einem äusserst grossen Pflichtbewusstsein und einer angeborenen mütterlichen Wärme neu diese Dienstmädchenstellung einnimmt. Bei all dem Blödsinn, welcher dem unbeschäftigten und verzogenen Knaben in den Sinn kommt, wehrt auch dieses Dienstmädchen ab, aber nie, ohne sein Verbot zu begründen und zu versuchen, dem Knaben begreiflich zu machen, dass am Ende nur er selbst darunter leide, wenn er Taten nur aus Spielerei, und nicht aus ernstem Grunde vollführe. Öfters als seine Vorgängerinnen bringt es etwas in Ordnung, was der Knabe vertan hat, und trotz der grossen Arbeitspflichten nimmt es sich – wenn nötig abends – Zeit, mit dem Knaben zu reden, ihm Vernünftiges zu zeigen, ihm zuzuhören und ihn dabei zu lehren, sich selber zu erforschen und zu erkennen.
Schon nach kurzer Zeit beginnt der Knabe den Unterschied – nicht nur zu allen frühern Dienstmädchen, sondern auch zu Vater und Mutter und überhaupt zu allen ihm Bekannten – zu spüren. Er empfindet die Weichheit des Gemütes, den übersanften Druck des Ernstes, das Leben des Eifers für das Gute, die Weite der Geduld und die Frische der Annahme in seiner neuen Betreuerin. Er wird dabei und dadurch aufmerksamer, ernster und leichter lenksam. Mit der Zeit entwickelt sich eine Zuneigung – welche stets schon eine Form der Liebe ist. Er beschäftigt sich mit dem Dienstmädchen in seinem Innern. Er betrachtet seine Art, auf etwas einzugehen. Er vergegenwärtigt sich die Tiefe seines Ernstes, der überall noch Gründe sieht, wo er selbst keine mehr vermutet. Er versucht, seine Wärmeausstrahlung zu verspüren, wenn es nicht bei ihm ist, und versucht, diese zu ergründen.
Das alles stellt – zu Beginn – das allerleiseste Erklingen eines Tones dar, und entspricht im weitern Verlaufe – bis dahin – einer allerzartesten Zunahme des Tonlautes - einem unmerklichen und dennoch beglückenden Inniger- und Kräftiger-Werden. Der Knabe ist glücklich, zum ersten Mal in seinem Leben. Ein sanfter Hauch der Erkenntnis belebt ihn. Immer mehr und immer öfters beschäftigt er sich mit dem Wesen des Mädchens; ja, er versucht, ihm ähnlicher zu werden und freut sich sogar manchmal, wenn er ihm durch Mithilfe bei der Arbeit eine Freude machen kann.
An einem Sonntag, an welchem das Mädchen zu einem dreitägigen Urlaub nach Hause fuhr, sah er es in seinen Sonntagskleidern. In der für ihn darauf folgenden, sehr leeren Zeit von drei Tagen sah er stets von neuem wieder seine Gestalt in seiner Erinnerung, wie sie auf dem offenen Bahnsteig stand. Er sah den Wind spielen mit seinem weiten Rock, sah die an Ernst gemahnende Umgürtung seines Leibes, die kein Spiel zuliess. Sah die schönen, grossen Augen und das sanft gewellte Haar, welches das schöne, harmonisch ovale Gesicht umgab und erinnerte sich auch noch an den sanften Glanz, welchen ihm die Sonne verlieh. Dabei wurde er eines Teiles voll Freude und Dankbarkeit darüber, dass der für ihn so wichtig gewordene und ihm so gut tuende Mensch so schön war, und er achtete anderseits von diesem Tage an strenge darauf, ob nicht irgendwer anderer etwa noch schöner wäre, was ihm gar nicht gefallen hätte.
Bis dahin ist nun der immer lauter werdende Ton soweit beschrieben, als er immer noch an Kraft und Innigkeit zunimmt, ohne eigentlich laut zu werden, aber doch schon an eine mittlere Lautstärke zu grenzen beginnt. Die unendlich langen drei Tage wurden für den Knaben dadurch noch verlängert, dass der letzte Eindruck, den er von seinem Dienstmädchen fest in seiner Erinnerung behielt, sein äusseres, vergängliches Bild war. In seinem Wesen, das ihm bisher vor allem aufgefallen war – ja, das ihn erst geweckt hatte, hätte er weiterleben können, ohne es zu sehr zu vermissen; aber seine Gestalt, die unendliche Lieblichkeit seiner Bewegungen und die zuneigende Freundlichkeit seines Lächelns beim Abschied, die Wärme und Fülle seines Schosses, so, wie sie der weite Rock verdeutlicht hatte, das alles fand er an sich selber nicht, und das wurde deshalb zum Grunde einer immer heftiger werdenden Schwärmerei, die ihn alles Innere beinahe vergessen liess – ja, die ihn alles Innern völlig entblödete. Dieser Lebensabschnitt gleicht der Zunahme der mittellauten Töne zu den lauten. Man kann sie vielleicht auch noch als innig bezeichnen, aber besser wären die Worte "leidenschaftlich" und "hinreissend".
Nun kommt das Mädchen zurück, und der Knabe springt ihm entgegen und drückt es an sich. Er fühlt dabei erstmals wirklich die Weichheit seines Körpers (anstatt seines Gemütes), spürt die Wärme seines Leibes und – ist dabei wie berauscht. Er sucht bald nur noch das, anstatt die Wärme der Besorgtheit, die Weichheit der Demut und der willigen Arbeitsamkeit. Und weil ihn das Dienstmädchen solches nicht gewähren lassen will, wohl erkennend, dass das eine leidenschaftliche Spielerei ist, so wendet er sich im Verlaufe von nur kurzer Zeit von ihm ab, und sucht, und findet das Gesuchte anderswo – – überall – jederzeit – bei allen.
Es gleicht diese Periode oder Episode der Zunahme an sich schon lauter Töne zu grellsten Lautstärken, welche unser Ohr beleidigen, und wir verstehen durch dieses Beispiel erneut, wie äusserlich starke Töne an sich wirken.
Wie – ja wie nur kommen wir aus dieser schrillen Äusserlichkeit wieder nach innen? "Ganz einfach durch die Abnahme der Tonlautstärken", würde der Musiker sagen. Aber – wie lässt sich diese im Leben bewerkstelligen, und wie muss sie in der Musik beschaffen sein, damit wir sie als dem Leben entsprechend erkennen und schätzen – ob uns dieses Entsprechungsverhältnis bewusst wird, oder nicht? Von der Äusserlichkeit zurück zur Innerlichkeit zu kommen, ist kein so leichtes Unterfangen wie das Umgekehrte; das zeigt uns ja das vergebliche Bemühen Gottes, seine Menschen um sich – der ja das Innerste ist – zu versammeln. Aber auch andere Beispiele verdeutlichen das. So ist es viel einfacher, aus einer Vorstellung in eine, der Vorstellung entgegengesetzte Wirklichkeit zu treten, als von irgendeiner Wirklichkeit zu einer ihr entgegengesetzten Vorstellung zu gelangen. Weil wir Menschen ja nur das Anfassbare, Mess- und Wägbare als Wirklichkeit betrachten, heisst in diesem Falle Wirklichkeit: "Äusserlichkeit". Natürlich ist die reelle Wirklichkeit jedoch nur innen. Das merken all die Einsamen unter den Vielen. Weil "viel" für sie nur aussen ist, während innen nichts mehr vorhanden ist, weder eine Liebe zu den Vielen, noch weniger eine Liebe von den Vielen für den verarmten Einen.
Das Abnehmen einer Äusserlichkeit – oder der Tonstärke in der Musik – kann, bei grosser Lautstärke, also erst nach einer gewissen Zeit geschehen, zumeist nach einigen Dissonanzen: Der Knabe muss in all seiner ihn selbst sehr verzehrenden Äusserlichkeit zuerst erwachsen werden, und muss dann eine möglichst Schöne zu seinem Weibe nehmen. Er muss zu spüren beginnen, wie in der weichen, zarten Leibesbrust seines Weibes, in einem verhärteten Herzen, die eitelsten und selbstsüchtigsten Gedanken reifen – muss fühlen, wie der so zarte und eindrucksempfängliche Leib gierig und nimmersatt wird, sodass alles nur ihm zu dienen hat – muss erkennen, wie die schlanke Taille bloss eine Verengung oder gar baldige Trennung alles Geistigen der Liebe vom Leiblichen darstellt. Dann wird das äussere Feuer – oder die Lautstärke der Töne – erstmals abnehmen. Es müssen die Kinder aus solcher Ehe grösser werden, und er wird in ihnen und ihrer Lieblosigkeit, ihren Eltern gegenüber, den Charakter aller Äusserlichkeit noch besser zu erkennen vermögen – und die Lautstärke der Töne wird entsprechend nochmals abnehmen bis zu erträglicher, mittlerer Stärke. Dabei wird der so frühzeitig Alternde beim Anblick seiner Kinder und der ihm dämmernden Erkenntnis der Hoffnungslosigkeit unvermittelt an seine eigene frühe Jugendzeit erinnert – und jäh beginnt er zu erkennen, welch ungeheuren, inneren Reichtum er damals über Bord geworfen hat mit der Annahme der Äusserlichkeit.
Hier wird die Tonstärke jäh zurückweichen – abnehmen, und eine gewisse Dramatik dieses Vorganges wird dem aufmerksamen Hörer nicht entgehen. Langsam kommt dann die Beschäftigung mit den innern Werten und die am Ende gänzliche Vernachlässigung des äussern Kultes – was durch nochmalige, stetige Abnahme der Tonlautstärke versinnlicht wird –, bis dann, im Eingehen auf immer tiefere Erkenntnisse über das Wesen des Menschen, wieder eine Liebe erwacht, aber diesmal eine Liebe zu den inneren Werten – was dann schon wieder durch eine Zunahme der Tonstärken versinnlicht würde, aber schön bescheiden, und darum beschränkt auf die leise Seite der Tonstärken.
Es ist klar, dass natürlich im Weibe dieses Mannes – weil zeitlich verschoben – gleichzeitig eine ganz andere Entwicklung abläuft; das erst ergibt ja den Grund für ein Orchester, wo nicht nur Melodie und Tonhöhenfolge, sondern auch die Lautstärken der verschiedenen Instrumente ganz unterschiedlich voneinander zu- und abnehmen, und so einen Zusammenklang bilden, welcher dem Leben entspricht, und welcher uns nur dadurch so sehr und so tief zu berühren vermag – auch dann, wenn wir diese Entsprechungen nicht verstehen. Denn mehr als alles Verständnis bewegt uns die Ahnung! Sie alleine macht uns unruhig und lebendig – das Verständnis hingegen beruhigt eher und dämpft.
Das Verklingen eines Tones endlich ist die Abnahme seiner Lautkraft bis zum Verschwinden aus dem Hörbereich, und gleicht der Abnahme unserer Sinneseindrücke, hin, bis zur reinen geistigen Verarbeitung in unserem Gemüte, wobei wir nicht sicher bestimmen können, ob dabei der Sinneseindruck nur schwächer und schwächer wurde, bis zum Verschwinden, oder ob er nur unbedeutender und unbedeutender wurde, angesichts der vielen geistigen Erkenntnisse, die daraus gezogen wurden, bis zur völligen Auflösung (geistigen Verdauung). In jedem Falle ist gerade diese letzte Abnahme der Lautstärke – das Verklingen also – das deutlichste Beispiel für das dem Innern entsprechende Wesen der leisen Töne. Das Verklingen ist gleich dem Abend, dessen sanftes Licht demjenigen des Morgens wieder gleicht, damit wir, dadurch angeregt, unsere tägliche Wegstrecke – sie kontrollierend – in unserem Innern noch einmal durchwandern und all die vielen Ansätze mit dem Zuge nach aussen hin erkennen, um ihnen im neuen, künftigen Tage nicht mehr zu folgen – und umgekehrt, jene Ansätze mit dem Zuge nach innen deutlicher wahrnehmen, um diese vermehrt zu beachten und ihnen damit grösseres, wegweisendes Gewicht zu verleihen. Denn das Letzte bleibt das Innere, wie es schon das Erste war! Dieselbe Melodie in einem Musikstück, nach vorheriger, lauter Orchesterentwicklung, ganz leise wiederholt, ist denn auch gleichsam eine "Erinnerung", also der Erkenntnis des Mannes in unserem Beispiele gleich, als er zu begreifen begann, wo der Reichtum in seiner Jugendzeit gewesen war. Diese "Erinnerung" geht uns jeweils besonders tief; führt sie doch den Menschen zu seinem Ausgangspunkte zurück – zu Gott.
Das aber ist nur eines von unzähligen Beispielen. Dieselbe Entwicklung erleben wir beinahe überall: Ein Künstler beispielsweise, der seinen Ahnungen nachgeht und sie erforscht, um sie andern verständlich machen zu können – der also das Inwendige nach aussen hin begreiflich machen will, ist sehr stark versucht, mit seiner Liebe am äussern Werk hängen zu bleiben und den Wert darin zu erblicken; dabei besteht doch der Wert des Künstlers, wie jedes anderen Menschen auch, nur darin, sein Inneres möglichst genau nach seiner Erkenntnis zu gestalten, und damit die Erkenntniswahrheit in sich zu beleben – und nicht darin, die Wahrheit in seinem Innern in die tote Äusserlichkeit zu geben, um sie damit zu verlieren. Wenn er sich innerlich mit seinem Werk abgibt, so entspricht das der Verstärkung eines Tones zu grösserer Innigkeit. Wenn er sich an die Ausführung macht, so nimmt diese Innigkeit zu, bis sie hin- oder mitreissend wird (während der Arbeit) – und abstossend während der Präsentation. Erst nach dem Erkennen der dabei eintretenden, innern Armut nimmt die Lautstärke entsprechend wieder ab, und mit der Neubelebung der Erkenntnis in sich selbst – durch sein tägliches danach Tun – nimmt entsprechend die Lautstärke wieder zu (jedoch nur im leisen Bereich).
Jede Mutter ist, sofern sie das zu erkennen vermag, ihrem Kinde gegenüber in der gleichen Situation wie der Künstler. Auch sie muss ausserhalb sich selbst – in ihrem Kinde – zu formen beginnen, ohne dass sie darüber ihre eigene, innere geistige Form vernachlässigen darf. Sie muss innere Erkenntnisse, in äussere Worte gekleidet, weitergeben, ohne dass sie in sich selbst den Inhalt zu verlieren beginnt, welcher alleine sie beglücken kann, und sie fähig macht, nebst der Lehrerin auch ein Vorbild zu sein.
Schlussendlich begibt sich ein jeder Wanderer nach aussen, und will sich vom Gesehenen beleben lassen, welches jedoch stets stärker auf ihn zu wirken beginnt, je länger die Wanderung dauert und je grossartiger das Geschaute ist. – Auch er hat die Chance, das Geschaute zu verinnerlichen, wenn er die Wanderung unterbricht oder beendet. Wir alle aber sind in unserem irdischen Wesen Wanderer. Wen sollte da die Zu- und Abnahme der Tonstärke nicht berühren, und wem – wenn auch nur ahnungsweise – sollte sie nichts zu sagen haben?
Eine weitere Möglichkeit der Veränderung der Tonintensität – der starke, und besonders der jähe Wechsel zwischen sehr laut und leise (ohne Steigerung) – ist eine Gegenüberstellung der Innerlichkeit gegenüber der Äusserlichkeit – oder hier wohl besser und deutlicher: gegenüber der Aussenwelt. Er drückt die ganze Dramatik des menschlichen Lebens aus, sofern es sich in seinem Innersten bereits gefunden hat und zu konsolidieren beginnt. Deshalb ist es gar nicht so verwunderlich, dass jene zwei Komponisten, welche diese Art der Gegenüberstellung ganz besonders zu ihrem "Thema" gemacht haben – Beethoven und Verdi –, zu den beliebtesten gehören, und das vor allem auch bei solchen, die sonst der klassischen Musik nicht allzu sehr offen stehen. Diese empfinden dennoch zutiefst die entsprechende Aussage in der Musik, die sehr oft in enger Beziehung zu ihrem eigenen Leben steht. Beide Komponisten hatten hohe Ideale, welche durch den Gang der äussern Dinge sehr oft bedroht wurden. Das wohl zutiefst greifende Ideal, welches von äussern Umständen durchkreuzt werden kann, ist für jedermann die glückliche Liebe und Ehe, welche bei dem Erstgenannten nie stattfinden konnte und beim Zweitgenannten ein erstes Mal vom Schicksal der Krankheit und des Todes zerstört wurde. – Aber auch die eigene Natur muss bei so subtilen, inneren Vorgängen als "aussen" bezeichnet werden. So etwa in Gegenüberstellung zum innerlich verherrlichten Ideal von Gesundheit, Kraft und Harmonie, wie es bei Beethoven nicht nur durch sein Temperament deutlich zum Vorschein kam, sondern später auch durch seine Krankheit.
Bei Mozart wiederum finden wir – vor allem bei den Piano-Stellen – sehr oft die Zunahme der Tonintensität. Er war es auch, der die kleinsten und intimsten Vorgänge für so gross ansehen konnte – und daran selber gross wurde –, dass ihm auch viele äusserliche Widerwärtigkeiten nicht als Gegensatz dazu vorkamen, sondern – trotz ihrer sehr oft bedrängenden Natur – als Unbedeutendheiten (immer im Vergleich zu den ihn innerlich beschäftigenden Themen). Bei ihm finden wir die Steigerung in den überlauten Bereich selten. Es wäre hier also bereits aus der Musik des Künstlers zu erkennen, wie sein Wesen wirklich war, sodass die neuerliche Darstellung seines Charakters – wie im "Amadeus"-Film aufgezeigt – nicht nur durch die in sich gespaltene Musikforschung als teilweise bestritten erscheint, sondern mehr noch durch die Aussage seiner Musik selbst.
24. 5. 1987 & 17. 1. 1989
nach oben
TONLÄNGEN UND TONÜBERGÄNGE
Im bisherigen Verlauf unserer Betrachtungen über das Wesen und den Grund der Wirkungen der Töne haben wir vor allem feststellen können, dass das Wesen eines einzelnen Tones äusserst stark und vielfach wirkend sein kann. Sein Wesen ist nicht nur derart stark und ausgeprägt genug, uns ganz bestimmte Empfindungen zu vermitteln, welche wir ahnungsweise zu erfassen vermögen, sondern es ist so stark, dass es sogar in den Verhältnissen zu andern Tönen zu einer eigenen "Persönlichkeit" wird, deren Eigenheiten sich mit Eigenheiten anderer entweder vertragen oder nicht vertragen können. Das werden wir im Kapitel "Vielklang" noch deutlicher erkennen. Aber auch schon die Betrachtung hoher und tiefer Töne hat uns das verdeutlicht, indem wir beispielsweise sahen, dass ein in der Tonhöhe mittleres "c' " nicht dasselbe Auflösungsvermögen hat wie ein unteres oder unterstes "C1" und dass ein hohes "c''' " eine Schärfe und Bestimmtheit hat, welche allen mittleren und unteren "c" fehlt. Es ist zwar ein "C" zu einem "E" – als Terz (von 1 zu 3) – in allen Oktaven oder Höhenlagen harmonisch und zu einem "D" – als Sekunde (= Schritt von 1 zu 2) – im Prinzip ebenfalls in allen Oktaven disharmonisch; darin gleichen sie sich alle und heissen deshalb berechtigt alle gleich, nämlich "c". Aber das tiefe "C1" hat dabei eine so allgemeine Schwingung, dass es in sich sogar eine Sekunde noch fast fassen kann (also eine Dissonanz fast aufzuheben vermag – wie wir im nächsten Kapitel noch sehen werden), und darin ist es einem mittleren "c" so unähnlich, so überlegen, soviel tiefgründiger auch, dass ihm sein Nachbar, das tiefe "D1" in dieser Hinsicht ähnlicher ist, als ein mittleres "c", welches diese Eigenschaft nicht mehr besitzt.
Es hat also jeder Ton für sich ein so starkes, eigenes Wesen, dass er mit andern nur beschränkt vergleichbar ist, zwar Ähnlichkeiten mit – von der Tonleiter her gesehen – ihm verwandten Tönen hat, aber anderseits auch – von der Höhen- und Tiefenlage her gesehen – ebenso grosse Ähnlichkeiten mit von der Tonleiter her nicht verwandten. Es ist also jeder Ton in seiner Weise einmalig! Das alles merken wir vor allem dann besonders gut, wenn wir nur ihn alleine hören oder auch, wenn wir nur einen einzigen Vielklang hören, sodass wir uns ihm alleine hingeben können. Je länger wir dabei auf einen einzelnen Ton oder einen einzelnen Vielklang eingehen können, desto reicher und reichhaltiger kommt er uns vor. Das werden wir vor allem bei der Betrachtung der Vielklänge noch erleben. Ja, so reich kommt ein solch einzelner, wohlklingender Vielklang dem beschaulichen Betrachter vor, dass er sich gar nicht von ihm zu trennen vermag und darüber beinahe vergisst, dass diese so wesensstarken Töne auch zu einer Musik zusammengefügt werden können. Erst bei genügender Auskostung des Wesens eines Tones, oder auch eines Vielklanges überkommt den tief erfassenden Hörer der Wunsch, das soeben erfasste Wesen oder Bild durch den Kontrast zu einem weiteren, andersartigen Wesen oder Bild (Ton oder Vielklang) zu verstärken, zu pointieren, und so in seiner gesamten Wirkung noch besser erfassen zu können. Das ist eine Wirkung der Beschaulichkeit, die unserer heutigen Zeit leider so stark abhanden gekommen ist, dass ihr beinahe der gesamte Reichtum eines Inhaltes verloren gegangen ist. Unsere Zeit kennt nur die Veränderung (Variation) und die Kombination. Inhalte kennt sie (und hat sie) deshalb kaum mehr.
Einige Beispiele mögen das verdeutlichen und uns zeigen, was Beschaulichkeit ist und wie reich sie macht:
Vom Geschmack des Brotes hat der Mensch zwar schon eine Vorstellung. Zumeist vor allem jene, dass es alleine genommen nicht besonders schmeckt. Er kennt eher die Kombinationen: Brot mit Butter oder mit Konfitüre oder mit beidem, Brot mit Käse, Brot als Beispeise zu Mittag, auch in einer Sauce als Saucenbrot etc... Wenn wir aber in einem beschaulichen Momente – vielleicht an einem schönen Sonntagmorgen, wenn wir die Stille geniessen und uns noch nicht so richtig klar darüber sind, was wir unternehmen wollen – uns entschliessen, einmal ein Stück Brot ganz für sich alleine zu kauen, um seinen ganzen Geschmacksreichtum einmal so richtig erfassen zu können, so werden wir folgendes merken können: Der Bissen Ruchbrot, den wir uns vom ganzen Stück abbeissen, hat eine etwas mehlige Oberfläche, welche durch ihre Trockenheit bald die Säfte unserer Speicheldrüsen anregt. Und erst mit der zunehmenden Vermengung des Brotes mit unserem Speichel werden wir des würzigen Geschmackes voll gewahr. Wir erkennen und geniessen das leicht Bittere der dunkel gebrannten Brotrinde, wie sie mit dem leicht Salzig-säuerlichen des weichen Inhaltes harmonisch kontrastiert, und wir verspüren im weiteren Verlauf die Erwärmung des Speisebreies sowie unserer Mundhöhle durch den regelmässigen Kauvorgang, und empfinden, wie die anfangs trockene und bröckelige Brotmasse zu einem stets homogeneren Brei wird, der uns seine Würze in demjenigen Masse mehr verspüren lässt, in welchem er sich durch die Speichelaufnahme unserm Wesen mehr verbindet. Dabei beginnen wir fast ungläubig überrascht zu verspüren, dass auch eine gewisse Süsse in dem Brei des gekauten Brotes steckt; und je mehr wir ihn weiterkauen – obwohl wir ihn in diesem Zustande an einem gewöhnlichen Tage, bei einer gewöhnlichen Mahlzeit, schon längst hinuntergeschluckt hätten –, desto mehr verspüren wir diese Süsse mit einer solchen Deutlichkeit, dass uns das ganze Brot leicht und angenehm süss erscheint. Es hat sich aus dem kraftvollen Aroma, welches wir in unserer Erinnerung noch zu verspüren glauben, ein milde süsser Brei entwickelt, dessen zarte Würze uns vielleicht an die Kost unserer frühesten Kindheit erinnert. Wie reich beschenkt und dankbar schlucken wir dann – fast andächtig – den ordinären Bissen Brot. Wie sanft und zart, wie unendlich behutsam wandelte sich das Aroma von kraftvoller Würze in das zarteste Süss, und wie reich ist doch das Wesen dieser Süsse im Vergleich zur ordinären Süsse einer Konfitüre!
Das alles erlebten wir nur aus den beiden Gründen, dass wir uns erstens nur mit einer einzigen Speise beschäftigten und uns zweitens viel Zeit dafür nahmen. Diese Beschaulichkeit liess uns viel mehr erkennen – liess uns den Inhalt viel deutlicher wahrnehmen und auch in seiner Gesamtheit erfassen und vermittelte uns dadurch einen grösseren Reichtum, als es die besten Kombinationen aller nur erdenklichen Speisen zu vermögen imstande wären. Genau dasselbe erkennen wir bei Tönen, wenn sie einzeln oder in einzelnen Gruppen zu uns sprechen und ihre Länge uns Zeit genug dafür gewährt, uns ganz in ihr Wesen zu versenken.
Als weiteres Beispiel diene uns die Betrachtung eines Wortes, zum Beispiel "Vater". Dieses Wort fasst so viele Begriffe und Möglichkeiten in seinem Wesen, dass wir sie kaum alle aufzählen können: Der Vater ist stets der Erste, denn ohne ein Zweites, Nachfolgendes gäbe es keinen Vater. Der Vater setzt auch stets eine Tätigkeit voraus. Im reinen Sinne des Wortes setzt "Vater" auch Liebe voraus, oder anders gesagt, ist Liebe der Grund oder das Grundwesen eines Vaters. (Andernfalls müssten wir bloss das Wort "Erzeuger" oder "Zeuger" brauchen, denn der Erzeuger erzeugt bloss, aus welchem Grunde auch immer – es muss nicht Liebe sein. Während ein Erzeuger nach der Erzeugung mit dem Erzeugten im weitern Verlaufe der Zeit in keinem Verhältnisse bleiben muss, um ein solcher zu sein, bestimmt die Liebe des Vaters ihn zu einem steten unwandelbaren Verhältnis zu seinem Kinde.) Denn der liebevolle, ernste Vater wünscht sich nicht bloss ein Kind, sondern möchte es auch glücklich und selig wissen, und wird schon von Anfang an alle Verhältnisse so gestalten oder beeinflussen, dass das werdende Kind so und dergestalt zu seiner einstigen Freiheit gelangen wird, dass es zwar in der Liebe zum Vater eine stetige Verbindung zu ihm hat, die aber weit genug ist, dass es in seiner fernem Entwicklung frei bleibt, trotzdem – ja sogar weil – diese Verbindung bestehen bleibt.
Alle Vorkehrungen des Vaters sind dem Wesen und der Entwicklung des Kindes angepasst, damit es in seiner Erkenntnis derart zunehme, dass es die damit gewonnene Freiheit der Entscheidung stets der Liebe weiht, und aus seiner Freiheit heraus auch immer wieder die Wege der Liebe wählt. Aller Ernst des Vaters und die aus ihm sich für das Kind ergebenden zeitweiligen Beschränkungen sind bloss der Liebe zur Erhaltung dieser allein selig machenden Kraft in seinem Kinde entsprungen. Ob dieser Vater tadelt oder lobt, ob er sich mit seinem Kinde – es ziehend und erziehend – beschäftigt, oder es scheinbar sich selbst überlässt, um die Entwicklung seines eigenen Wesens zu ermöglichen, es entspringen alle seine Handlungen der Liebe. Kurz, der richtige oder wahre Vater kann tun, was immer nur sich denken lässt, so tut er es dennoch immer bloss aus einem Grunde, aus dem Grunde der Liebe zu seinem Kinde.
Wenn er beispielsweise wie zufällig gerade dann nicht hinsieht, wenn sein Kind sich in irgendeinem Fache oder in irgendeiner Kunst zu produzieren beginnt, so ist seine im Innersten tätige Liebe voll damit beschäftigt, alle Einbildung und jeden Eigendünkel des Kindes frühzeitig zu ersticken, weil sie weiss, dass diese Eigenschaften den Menschen von der Liebe, und damit auch von seinem Nächsten, aber vor allem auch vom Vater isolieren, und dass die aus solchen Charaktereigenheiten resultierende Haltung dann später auch zum Grund für so manche Depressionen der Erwachsenen wird, weil sie sich durch das aus ihnen sich ergebende Leistungsstreben, das nicht der Liebe dient, von ihren Nächsten isoliert haben. Wie tief in die Psychologie hinein und damit in die späteste Zeit seiner Kinder wäre also hier das Wort "Vater" zu verfolgen, also gerade dorthin (in die Erwachsenenzeit des Kindes), wo der oberflächlich Betrachtende und Urteilende glaubt, dass es aufhöre, seine Berechtigung zu haben. Das alles können wir nur dann ersehen und erkennen, wenn wir uns dem Worte "Vater" alleine stellen; ihm alleine begegnen, und es auskosten in aller Fülle seines Wesens und seiner Möglichkeiten.
In einem Satz, wie etwa: "Der Vater merkte nicht auf das Spiel seinees Kindes, bis es hinfiel", würden wir den "Vater" kaum mehr vermuten, oder zumindest nicht verstehen, wenn wir uns die weiter oben stehenden Gedanken nicht gemacht hätten. Und im Satz: "Der Vater verbot ihm, mit den Streichhölzern zu spielen", erleben wir den Vater als die verneinende, negative Kraft – als Schranke des kindlichen Willens. Im Satz: "Das Kindlein barg sein Gesichtchen in die Hände seines Vaters." erleben wir denselben Vater als "Heimat", als "Zuhause", als Kraft auch und als Trost. Drei Sätze, drei Väter, ja: drei voneinander derart abstehende Gegensätze, dass wir sie kaum mit einem einzigen Begriff zu benennen wagen würden, wäre da nicht die gedankenlose Gewohnheit, die uns das im Alltagsleben tun lässt. Diese Gegensätze oder Widersprüche ergeben sich aber nur aus der blossen, unbedachten Verbindung dieses einen inhaltsschweren und wesensreichen Wortes mit andern Wörtern zu einem Satz zusammen. Würde das Wort für sich alleine betrachtet, so wie wir das vorher getan haben, so wäre jedoch alles dies in ihm zu finden, aber so frei, so unbestimmt und dennoch so unbeschreiblich nuancenreich, dass es uns nur als unermesslich reiche Einheit vorkommen muss, und niemals als Gegensatz – ähnlich, wie wir die Süssigkeit des gekauten Brotes nicht als Gegensatz zu seiner ursprünglichen Würzigkeit empfinden, sondern als Reichtum einer und derselben Speise.
Genau so sind im einzelnen Tone – und noch deutlicher im einzelnen Vielklang – alle Möglichkeiten vorhanden, welche uns dann im Verlaufe der Musik durch die Tonfolge auch offenbar werden können, aber dort eben nur stets in der ausschliessenden Bestimmtheit des einzelnen Tonfolgevorkommnisses oder -erlebnisses, also ohne die Berücksichtigung des gesamten Reichtums der übrigen in ihm enthaltenen weitern Möglichkeiten. Ein drittes Beispiel soll uns das noch weiter verdeutlichen:
Wenn wir ein Brett aus einem schönen Holze eingehend betrachten, so erfahren wir mehr über das Holz und können uns ins Wesen des Holzes – ein Geübter gar ins Wesen und die Art des Baumes, von welchem das Brett stammt – versetzen. Wir erkennen beispielsweise beim Tannenholz die harten und gediegenen Jahrringe, die golden glänzend das weichere Holz des Frühjahrszuwachses durchziehen, und erkennen an ihrem mehr oder weniger geraden, oder dann eben welligen Verlauf, wie gerade oder wie geschwungen der einstige Stamm gewachsen sein mochte. Wir unterscheiden das härtere Holz der mageren Jahre mit nur langsamem Wachstum an seinen vielen engen Streifen oder Jahrringen von dem weicheren, schnell gewachsenen Holz besserer Jahre mit phantasiereicherer und lockerer Zeichnung der Jahrringe, das sich vom vorigen unterscheidet, wie der Erlebnisreichtum der Jugend eines glücklichen Kindes vom kargen Jugendlos eines armen Waisenkindes. Wir sehen in einem Brett aus Eichenholz die unzählig vielen Queradern oder Markstrahlen, welche die Jahrringe durchbrechen, und das Holz hart und unbeugsam machen, gleich den vielen Widersprüchen, welche ein eifriger Gelehrter aus der Natur der Dinge, seinem eingelernten Fache gegenüber, als quergestellt erkennen muss, soll sein Bild der in der Ausbildung einmal angenommenen Lehre seines Faches gediegener und probehältiger werden. Aber wir erkennen aus diesem Holzbilde auch den Grund zum so knorrigen Wuchs der Eiche und begreifen dabei auch, dass bei einem gediegenen Gelehrten der Grund zu seiner Einzigartigkeit die von innen nach aussen strahlende Liebe ist, welche seinen Bildungsprozess eher autodidaktisch gestaltet, sodass sich sein "Holz" in Härte, Widerstandsfähigkeit und Dauerhaftigkeit wesentlich vom weichen, schnell gewachsenen "Holz" eines blossen Schulgelehrten unterscheidet. All das können wir wie eine erzählte Geschichte erleben, wenn wir uns nur die Zeit nehmen und uns in das Wesen des Holzes vertiefen wollen; und wenn das Ausmass des Brettes Raum genug gewährt, den Zeichnungen des Holzes folgen zu können. Dieser Raum ist zumeist die Breite des Brettes und ist vergleichbar dem (Zeit-)Raum eines Tones. Erst der gehörige Raum also lässt uns das Wesen einer Sache oder einer Erscheinung voll erfassen. Würden wir aber das Brett in einem angenommenen Falle in seiner Breite so weit ausdehnen, dass es nicht mehr überschaubar würde, so würde es zum viel zitierten Brett vor dem Kopfe, und wir wären seiner überdrüssig und versuchten, uns von ihm zu entfernen. Also hat alles seine Grenzen bei der Aufnahme in unser Gemüt. Diese Grenze der Aufnahmefähigkeit lässt uns dann anderseits aber auch Platz und Zeit finden zur Aufnahme anderer Wesenheiten und Inhalte, aber: sie versetzt uns auch, vom Innern herkommend, wieder ins Äussere; denn die Grenze ist stets das Äusserste einer Sache. Und da haben wir beim Holz ein interessantes Beispiel dafür, wie wir mit dem Spiel der Grenzen den Inhalt verdecken können – oder wie wir durch die Art der Begrenzung einen andern, neuen "Inhalt" vermitteln können, dann jedoch nicht mehr den Inhalt des Materiales, sondern den Inhalt oder das Wesen des Begrenzenden oder des Vermittlers selbst.
Stellen wir uns noch einmal das in der Breite unbegrenzte Brett vor, wie es vor uns stünde, wie eine Wand, auf welcher wir die mehr oder weniger senkrecht verlaufenden Jahrringe erkennen können. Wenn wir nun dieses Brett dadurch begrenzen würden, dass wir es in unregelmässigen Abständen durch stets gleich breite, senkrechte Schlitze unterbrechen würden, so hätten wir bereits eine lebendige Wand vor uns, welche, ähnlich wie ein Gartenhag, aus einzelnen senkrechten Brettern, aber von unterschiedlicher Breite bestünde. Wenn ein Künstler diese Zerteilung des vorher unbegrenzten Brettes vorgenommen hätte, so wäre bestimmt stets jene Partie des Holzes, welche eine ungemein reichhaltige und kräftige Maserung oder Zeichnung aufgewiesen hätte, nicht, oder nur an wenig Orten unterbrochen worden, und die Unterbrüche hätten sich dort gehäuft, wo die Struktur oder Maserung des Holzes eher gleichmässig, langweilig oder kaum sichtbar gewesen wäre. Das Ganze ergäbe eine zwar ungewöhnliche, aber dennoch äusserst lebendige Wand, oder einen merkwürdig lebendigen, wenn auch nicht ganz alltäglichen Holzzaun.
Bei der Betrachtung desselben würde uns an den strenger unterbrochenen Stellen auffallen, wie sehr die öftere Unterbrechung der Fläche die Holzstruktur in ihrer Wirkung zurückdrängen würde und ihre eigene Wirkung auf den Betrachter zu entfalten begänne. Diese Wand, oder dieser Zaun, aber gliche dennoch bereits einer Musik, und zwar der Musik eines Komponisten, der sowohl die Töne oder Tonlaute sprechen liesse, als auch die Wesenheit (Rhythmik) der angebrachten Unterbrechungen, welche einen Teil der Melodie bilden. G.F. Händels Feuerwerkmusik wäre ein gutes Beispiel dafür. Die Ouvertüre sowie der dritte Satz, ein Largo, welche beide von langen, tragenden Tönen oder Vielklängen gestaltet sind, wirken zumeist stark durch das Wesen der Töne und die Wesenheit der Vielklänge selbst, ohne dass der Wechsel von Ton zu Ton, also der Unterbruch, ein allzu starkes, eigenes Wesen ausbildet – vergleichbar der schönen Maserung des nicht zertrennten Brettes. Dann aber kann sie wieder Stellen aufweisen (besonders im zweiten Satz, aber auch im Allegro-Teil der Ouvertüre), wo der Unterbruch, oder das Muster der Unterbrüche, stark das Wesen der gesamten Musik mitgestaltet – ähnlich den öfters unterbrochenen Stellen des Bretterzaunes (kurze Töne). Bei anderen Komponisten sind es zumeist nur die langsamen zweiten Sätze, welche die Töne eher als ihre Unterbrechung sprechen lassen. Hierbei sind vor allem Töne des mittleren Höhenbereiches solche, für die es schade wäre, sie zu schnell zu unterbrechen, denn ihre Wesenheit ist die reichhaltigste, wie wir im Kapitel über die Tonhöhen festgestellt haben, indem sie in sich selbst sowohl die auflösende Kraft der tiefen Liebesschwingungen in sich haben, als auch die konzentrierte, gestaltende plastische Kraft der der Weisheit entsprechenden hohen Töne. Sie weisen also – entsprechend unserm Bilde – die reichhaltigste Holzmaserung auf.
Eine eher regelmässigere Unterbrechung des imaginären Holzbrettes würde einem normalen und üblichen Lattenzaun, mit senkrechten Latten, entsprechen. Er entspräche eher dem Bilde der barocken Musik, welche stets dem Verstande näher steht, als dem Gemüte – wie die mathematische Teilung eines Zaunes auch! Sie wurde durch Überlegung viel mehr beeinflusst, als durch das Gefühl. Jeder Ton war bei solchen Überlegungen eher ein Material, als ein Wesen, und das Wesen der Musik war dabei streng, wie die Logik des Verstandes. Zu dieser Logik gehörte die Vielstimmigkeit oder Polyphonie. Man wollte jeder Stimme durch ihre Vollständigkeit das Gewicht der Berechtigung geben. Zwar ein recht schöner, ja wahrhaftig ein prächtiger Gedanke, wenn man den Grund dafür in der Liebe, der Brüderlichkeit und Gleichheit sucht und erblicken kann. Jedoch zeigt die Praxis, sowohl im menschlichen Leben als auch in der Musik, dass dabei so viele Verhältnisse berücksichtigt werden müssen, dass die Entfaltung der einzelnen Stimme dadurch stark eingeschränkt wird. Das Teilen, oder die Teilung zwischen den Tönen, also der Unterbruch des Tones ist der vorherrschende Eindruck des Hörers, wobei natürlich diese Teilung weniger in der Länge der Pausen – oder den Zwischenräumen des Zaunes – sich manifestiert, als in der immensen Anzahl der Töne – oder "Lättchen" des Zaunes. Die daraus resultierende Fülle oder Überfülle von Bewegung, in einem barocken Musikstück ist also künstlich und resultiert von der Teilung. Sie entspricht der Fülle des Verstandes, welcher zappelig und unruhig macht – wie die Vielzahl schmaler Latten eines Zaunes –, und keineswegs der Fülle des Gemütes, welche wärmend löst und ausgleichend beruhigt – wie die sanfte Maserung des Holzes.
Ein Wort noch zum schönen Grundgedanken der Polyphonie, welcher es einem einfühlsamen Denker beinahe schwer machen kann, sich von ihr zu trennen, weil er darin die Gleichberechtigung eines jeden Menschen symbolisiert sieht und auch empfindet:
Es ist die Gleichberechtigung der Stimmen zwar der tiefsten Liebesempfindung eines aufrichtigen und wahrhaftigen Menschen entsprechend, aber wenn er sich bloss im Verstande damit beschäftigt, verliert er leicht den Überblick. Wenn nämlich die Gleichberechtigung der Stimmen darin alleine besteht, dass sich eine jede unentwegt betätigt und zu Worte melden darf – ja soll, so haben wir bei einer menschlichen Gesellschaft bald einmal einen solchen Lärm, wie er sich in Bädern, auf Bahnhöfen oder bei sonstigen Massenversammlungen sofort bildet. Wollen wir dieser Erscheinung vorbeugen, so müssen wir – wie in der Polyphonie – die einzelne Stimme durch Regelungen derart einschränken und einengen, dass wir uns fragen müssen, ob wir ihrem Wesen damit nicht mehr Abbruch tun, als wenn wir sie schweigen liessen, weil beim Schweigen, beim Fehlen äusserer Worte, denn doch eine ungestörte innere Entfaltung möglich wäre. Wie ist es denn aber im Leben selbst, wenn es harmonisch verlaufen soll? Schweigt da die Stimme des Kindes nicht, wenn sich die Stimme der Mutter erhebt? Und wieder schweigt dann aber diese, wenn sich, zum Beispiel bei einer Krankheit, die Stimme des Arztes erhebt. Ein anderes Mal schweigt die Stimme des Erfinders, wenn sich die Stimme des Mechanikers erhebt und erklärt, dass zwar die der Erfindung zugrunde liegende Idee sehr gut sei, aber in der Praxis nicht zu realisieren; und wieder schweigt dann die Stimme des Mechanikers, wenn ihm die Stimme des Erfinders zur Idee auch gleich noch die erforderlichen, neuartigen Werkzeuge beschreibt, welche die Herstellung der neu erfundenen Vorrichtung ermöglichen. Und zuguterletzt noch eine Frage zu unserm an zweiter Stelle aufgeführten Beispiel: Hatte das Schweigen des Vaters bei dem sich produzieren wollenden Kinde nicht mehr Gewicht, als eine zurechtweisende Belehrung? Ist überhaupt das Vorbild als solches nicht stärker als die kräftigste Stimme? Und doch besteht das Vorbild im Schweigen der Stimme und der alleinigen Sprache der Tat. Also kann doch eine schweigende Stimme unter Umständen eine stärkere Sprache führen! Natürlich wissen wir dann nicht, ob das Schweigen ein blosses Erlahmen der Stimme ist, oder dann eine stärkere Sprache durch das Vorbild. Im angezogenen frühern Beispiel eines Vaters könnte ja ein anderer – ein blosser Erzeuger, statt wirklicher Vater – des Kindes sein Sich-Produzieren in Wirklichkeit nicht wahrgenommen haben – also nur zufällig seine Stimme nicht erhoben haben. Aber das Kind spürt es wohl, ob ein um sein Wohl stets bekümmerter Vater gerade nur dann nichts sieht, wenn es sich zu produzieren beginnt, und allenfalls erst nach einem etwaigen Unfall oder Missgeschick kurz und ruhig ein aufklärendes Wort genau darüber findet, was er doch vorhin durch sein Schweigen nicht bemerkt zu haben schien. Also besteht doch die Harmonie des Lebens – wie der Musik – darin, dass eine jede Stimme sich nur dann erhebt, wenn es nötig und für das Ganze am zweckdienlichsten ist, im übrigen aber bescheiden schweigt, wenn es sie nicht erfordert – oder – gar ostentativ schweigt, wenn das Vorbild stärker wirken soll, als die Stimme.
Die Verhältnisse so besehen, müssten wir uns eher einen Zaun vorstellen, dessen Lättchen diagonal also sich kreuzend schräg gestellt sind. Dabei sind zwar die Pausen wohl recht gross, aber die Lättchen – den einzelnen Tönen entsprechend – ziehen sich in einer grösseren Breite dahin, und die Pausen – entsprechend den Zwischenräumen – lassen die sich beengenden oder kreuzenden Lättchen – oder Töne – besser sicht- oder hörbar werden. Der Zaun wirkt ebenso einheitlich, wie der vorherige, mit senkrechten Lättchen, aber weniger stereotyp, eher verbunden, eben fliessend wie die Melodien in der Harmonie (Klassik). Längere Töne wirken sich dabei sehr gut aus, beleben und vertiefen die Wirkung der Musik auf unser Gefühl zwar, ähnlich wie bei Händels Feuerwerksmusik im ersten und dritten Satz, aber sie fliessen mehr, wie in den langsamen zweiten Sätzen der Klassiker, sie lockern eher und wirken dadurch nicht so gravitätisch.
Aber nicht nur die Länge der Töne, sondern in beinahe ebensolchem Masse die Übergänge von einem Ton in einen andern, nächstfolgenden bestimmen den Eindruck oder die Wirkung auf unser Gemüt. Der gebundene, sanft fliessende Übergang ("legato" genannt) von einem Tone zu einem nächsten, lässt uns die Kraft der Schwingungen verdeutlicht wahrnehmen. Es findet gleichsam ein leiser Wechsel statt, und in dieser Hinsicht tritt die Grenze des einzelnen Tones – als ein Äusseres – weniger in den Vordergrund, die innere Wesenheit bleibt manifest. Es entsprechen solche Übergänge in ihrer Wirkung auf unser Gemüt den leisen Tönen. Sie sind gewachsen – nicht gefügt – und entsprechen dem Gemüte eher, als dem Verstande. Wir folgen solchen Übergängen mit dem Gefühl der Erfrischung der Toneinwirkung auf unser Gemüt. Der abrupte Wechsel von einem Ton zum andern hingegen verdeutlicht die Grenze zwischen den Tönen und streicht damit die Äusserlichkeit des Tones durch die Grenzbetonung heraus. Diese Übergangsart ("staccato" genannt) finden wir eher bei kurzen Tönen und öfters bei lauten als bei leisen. Solche Tonfolgen sind nicht gewachsen, sondern gefügt; sie entsprechen dem Verstande und den Worten, die wir – unseren Gefühlen nachgehend – zusammenfügen müssen, um unsere Gefühle und Gedanken nach aussen bringen zu können, damit sie andern zugänglich werden. Sie regen deshalb – wie die Worte auch – vorerst den Verstand an, sie entsprechen der äussern Erregung und Bewegung, dem sympathischen Nervensystem also, und finden sich vermehrt bei Tanz, Spiel und allgemeiner äusserer Belustigung. Sie drängen eher zur Ausgelassenheit, während fliessende Übergänge verinnerlichen, ruhig stimmen, die Worte verstummen lassen und die Gefühle erwecken, welche viel eher fliessen können als Worte. Sie entsprechen dem parasympathischen Nervensystem des Menschen. Durch den Wechsel von Legato und Staccato verdeutlicht sich – ähnlich wie beim Wechsel von leisen und lauten Tönen – der Gegensatz von innerem Erleben und äusserer Handlung, also der Wechsel von einem Zustand in einen andern. Denn es drängt ja auch tief Gefühltes stets zur Mitteilung, und die Mitteilung sollte dann, umgekehrt, beim Empfänger stets zur Ruhe drängen, damit das Mitgeteilte wirklich in unser Wesen aufgenommen werden kann. Kurze und vor allem abgesetzte (staccato) Töne versinnlichen stets auch eine äussere Bewegung. Der kurze Ton wirkt nur als Unterbrechung, entweder einer Stille oder anderer Töne, was wir ganz gut daran erkennen, wenn wir uns nachträglich an die Wesenheit eines einzelnen kurzen Tones aus einer schnellen Tonfolge erinnern wollen, und diese kaum oder auch gar nicht mehr nachempfinden können, sondern in unserer Erinnerung lediglich die Art des Auftauchens und die Schnelligkeit seines Vergehens haften geblieben ist. Manches Mal erinnern wir uns gar nur des "Zuges", den die ganze Tonfolge gehabt hat. Dieses Erlebnis kommt der äussern Bewegung gleich, welche in sich selbst auch weder Farbe noch Inhalt hat, sondern nur einen Ausgangspunkt und ein Ziel, mit dem dazwischen gelegenen Weg. An einem Vergleich aus einem andern Sinnenbereich unseres Wahrnehmungsvermögens lässt sich das wohl am besten erklären. An einem Bilde, welches wir zwar mit den Augen wahrnehmen, welches jedoch in all seiner steten Wandelbarkeit genau dem Hörbilde der Töne entspricht. Es ist das Bild der Natur. In ihm haben wir stets einen Boden oder Grund im untern Bereich, welcher alles trägt und aus welchem sich alles entwickelt. Ihm entspricht die Liebe und deshalb auch die tiefen Töne der Musik. Wir haben aber im Bilde der Natur auch immer einen hellern, oft schön blau erstrahlenden Himmel, dessen Licht uns erst das Erkennen alles Seienden ermöglicht. Er entspricht den hohen Tönen der Musik und der Weisheit. Dazwischen haben wir die Mittler zwischen dem Boden oder Grunde und dem Licht, die Bäume und Sträucher, in der Ferne aber auch die Berge. Die Pflanzen wachsen aus dem Grunde (der Liebe oder ihres Dranges) dem Lichte (der Weisheit) entgegen, entfalten erst dadurch ihr eigentliches Wesen vor unsern Augen und vereinigen damit zugleich beides in sich (die Stoffe der Erde mit der Luft und dem Lichte des Himmels), aus welcher Durchdringung dann erst die Voraussetzung zur Frucht geschaffen wird. Ähnlich die Berge, welche durch das unterirdische Feuer in die Höhe getrieben wurden und nun aus der lichten Höhe die Lebensfeuchtigkeit an sich ziehen und in Form des Gletschers und des ewigen Schnees an sich binden, um ihr Wasser endlich dann den Tiefen und Niederungen der Erde als "Frucht" weiterzugeben. All das entspricht dem mittleren Tonbereich. Wir können in diesem Bilde, in dieser Landschaft, sogar unsere Blicke senken und nur das Gestein und die Kräuter des Bodens betrachten, so können wir dennoch gut wahrnehmen, woher das Licht kommt. Wenn wir anderseits die Wolken, hoch oben in der Luft, betrachten, so nehmen wir den dunkeln, zum Boden gehörenden. Horizont dennoch wahr. Wenn wir in einem Walde spazieren, so kommt das Licht – wenn diesmal auch abgeschwächt und gefärbt – dennoch von oben, und wenn wir auf eines Berges Spitze stehen, und ringsum nur Licht und Luft wahrnehmen, so nehmen wir dennoch auch den Boden oder die Erde wahr, auch wenn sie dabei einen noch so kleinen Teil unseres Blickfeldes einnimmt.
Das alles bis dahin Beschriebene des Bildes gehörte eigentlich in das Kapitel der Tonhöhen. Denn bei einem Orchesterwerk hat es ja auch stets tiefe, mittlere und hohe Töne, praktisch in jedem Augenblick. Mögen auch einzelne Stellen noch so durchwirkt sein mit bloss hohen oder bloss tiefen Tönen, so finden sich praktisch immer noch welche des Gegenpoles im musikalischen (Natur-)bilde. Selbst wenn diese auch eher der Mitte angehören, so tragen sie doch auch den jeweiligen Gegenpol in sich. Das alles bleibt in sich selber immer gleich. Es entspricht den geistigen Voraussetzungen, welche sich auch stets gleich bleiben.
Nun kommt aber in dieses ewige Bild der natürlichen (wie entsprechend eben auch der geistigen) Verhältnisse eine zweite Komponente, jene der Bewegung:
Wenn wir, eine schöne Frühlingslandschaft betrachtend, etwas verweilen, und dabei plötzlich aus dem dunklen Schatten eines Waldrandes ein, zwei oder drei Rehe springen sehen und dann mit unsern Augen ihre graziösen und dennoch kraftvollen Sprünge verfolgen, so haben wir etwas erlebt, das uns das ganze vorher innegehabte Bild vergessen, ja es förmlich vergehen macht. Diese Bewegungen kennen nämlich keine Farbe, keine Helligkeit und keinen Schatten, sie liegen in einer andern Dimension.
Aber auch, wenn wir einem Eichhörnchen zuschauen, wie es behände eine Nuss vom Boden aufliest, sie in beide Vorderpfötchen nimmt und beschnuppert, dann mit zwei, drei Sprüngen, welche es mit seinen typischen Schwanzbewegungen steuert, einen Baumstrunk aufsucht und sich dort wieder setzt und seinen Fund durch zerbeissen der harten Schale aufzuschliessen beginnt – dabei stets beobachtend, ob sich nichts Verdächtiges regt, oder gar Gefährliches naht –, so haben wir dabei weder Farbe noch Licht und Schatten gesehen (obwohl ja nur diese drei unser Erkennen überhaupt ermöglicht haben), sondern wir sahen die Bewegungen in und ausserhalb des Tierchens. Ausserhalb in seinen äussern Bewegungen und innerhalb des Tierchens in seiner Wachsamkeit, trotz der Freude an dem Funde und der vor ihm stehenden Mahlzeit. (Wir können uns das Geschilderte aber bei der Betrachtung eines Fotos nicht so leicht vergegenwärtigen, weil wir uns dort die Bewegung zuerst wieder vorstellen müssen und sie nicht einfach nur verfolgen können, jedoch dadurch auch nicht abgelenkt werden können. Wir sehen auf einem solchen Foto also wieder nur das Bild der Natur und darin das Eichhörnchen als ein Wesen der Mitte.)
Wenn wir in einem dritten Beispiel ein Taubenschwänzchen betrachten – ein Schmetterling, der wie ein Kolibri stets mit unglaublich schnellem Flügelschlag von Blüte zu Blüte fliegt und im Schwirrflug nur kurz bei einer jeden verweilt, um mit seinem langen, äusserst feinen Rüsselchen schnell ein Tröpfchen Nektar erhaschen zu können – so fasziniert uns die Unermüdlichkeit seines schnellen Flügelschlages, welcher uns das Flügelpaar nur als Dunstwölkchen erkennen lässt, und wir staunen über die Schnelligkeit und Präzision seines Fluges und über die ungemein vorsichtige und sachte Behutsamkeit, mit welcher das Tierchen sich jeder Blüte nähert, und bald darauf schon wieder äusserst flink und behände weiterfliegt, um bei einer nächsten Blüte fliegend wieder einen winzigen Augenblick zu verweilen. Bei all dem muntern Treiben solch eines unermüdlichen Taubenschwänzchens erleben wir nur sein Wesen, welches sich in seinen Bewegungen kundgibt, und wir achten kaum der Farben der Blüten, sofern sie nicht heftig sind. Sind es jedoch leuchtende Farben, so empfinden wir sie eher als störend, weil so gar nicht zu der uns beschäftigenden Munterkeit der Bewegungen des beobachteten Tierchens passend.
Also liegt die Bewegung in jedem Falle in einer andern Ebene, als das Bild der Natur. Es ist die seelische Ebene. Das Bild der Natur ist wieder vergleichbar der Maserung des Brettes eines Zaunes, und die Bewegung ist dann vergleichbar der Teilung, also den Zwischenräumen – um das erste Bild nochmals in Erinnerung zu rufen. In der Musik entspricht die Art dieser Bewegung dem innern Wesen des Komponisten – des Tondichters. Wenngleich sie auch mit Tönen dargestellt wird – wie die äussere Bewegung durch Licht und Schatten erst ersichtlich wird –, so lässt sie dennoch nicht den Ton an sich erkennen, sondern eben nur die Bewegung. Das also gilt für die kurzen Töne und vor allem auch für die deutlichen und betonten Tonübergänge (staccato).
Mag ein Tondichter eher das Licht einer hohen Bergspitze (mit vorwiegend hohen Tönen) beschreiben, oder eher das Dunkel und Einhüllende eines Tales oder Waldes (mit tiefen Tönen), so entspringt diese Auswahl zwar ebenfalls seinem Wesen – zumindest aber seiner momentanen Stimmung –, seine wirkliche Eigenheit jedoch verrät er in der Art seiner Bewegungen, welche er in diesem Landschaftsbilde dann ausführt. Hat er oder sein Stück viel Bewegung, und somit wenig Ruhe und Beschaulichkeit, so wirkt es auch auf den Hörer zur Bewegung treibend, wie etwa der Tanz oder der Marsch; hat er oder sein Stück wenig davon, so wirkt es beschaulich, wie zumeist der zweite Satz eines Konzertes. Ist ein Werk durchzogen von beidem, nun, so ist es in einem bestimmten wohltuenden Gleichgewicht zwischen seelischem Erleben und geistiger Kraft. Der Tondichter erzählt zwar dabei in seiner ihm eigenen Art, lässt aber daneben auch alles bereits Seiende zur Geltung kommen.
Eine kleine Frage bleibt dem Forschenden bei dieser Betrachtungsweise noch offen, jene nämlich, weshalb wir die Bewegung (ein Teil der Melodie also) als zum seelischen Bereich gehörend betrachten müssen, während die Töne selbst als zum geistigen Bereiche gehörend. Dazu wollen wir also noch eine Erklärung finden. Wir brauchen dabei an erster Stelle die Feststellung, dass auch im einzelnen Tone sich eine Bewegung findet – eben sein Schwingen. Aber dieses ist im einzelnen Tone für alle Zeiten geordnet, ebenso wie das Verhältnis verschieden hoher Töne zueinander – es bleibt sich ständig gleich. Dasselbe trifft ja auch im visuellen Bereiche zu! Was anderes als verschiedene Lichtschwingungen sind denn die Farben? Also sind auch sie nichts anderes als Bewegung, und dennoch ist diese in ihrer steten gesetzmässigen Gleichheit so geordnet, dass wir sie nicht als Bewegung empfinden. Ebenso sind die gefestigten geistigen Verhältnisse nur Voraussetzungen und Bedingungen zur Erlangung einer völligen Harmonie aller Wesen untereinander. Sie sind nichts anderes als eine sich stets gleich bleibende Möglichkeit, zwischen all dem vielen Vorhandenen so zu wählen und es so zu gebrauchen, dass es allen dient. Die richtige Erkenntnis und Anwendung dieser vielen Möglichkeiten ist zwar in sich nichts anderes als ein Schliessen aus dem vorhandenen Seienden und als solches auch eine Bewegung von einer Erkenntnisstufe zur nächsten. Die Wirkungen aller Komponenten zueinander sind also ebenfalls wechselseitig und kraftvoll, bleiben in sich selber hingegen stetig gleich, so wie sich die Lichtschwingungen der Farben und die akustischen Schwingungen der Töne immer gleich bleiben, ob sie wahrgenommen werden oder nicht. Sie gleichen den Formeln bei Rechnungen, um es einmal modern, d.h. dem Verstande zugänglich, zu sagen. Auch sie bleiben sich stetig gleich, ganz gleichgültig mit welchen Zahlen nach ihnen gerechnet wird. Manche Zahleneinheit mag dabei gewichtig erscheinen, manche völlig andersartig zusammengesetzt sein als eine andere, aber am Ende müssen sie alle gleich miteinander verbunden werden, um das letzte Resultat völlig richtig zu erhalten, gleichgültig, nach welcher Methode gerechnet wird. Die Möglichkeiten sind also wohl verschieden aber in sich selber unveränderlich. Darum spielt es auch keine Rolle, nach welcher und ob überhaupt gerechnet wird. Denn das entspricht alles den Gegebenheiten unseres Erkennens, gehört also zum Bild des Geistigen. Die Art und Weise jedoch, wie wir es tun, entspricht ganz unserem seelischen Wesen und seinen Möglichkeiten. Wir können sie zwar nach unserer Vollendung immer wieder erneut ausführend nachvollziehen, um einem Schüler diese Erkenntnis beispielgebend beizubringen. Wir selber aber brauchen diese Bewegung nicht mehr, und haben dennoch das Resultat, die Operation, sowie die Grundbegriffe stets inne. Es weiss – um auf ein praktisches Beispiel zu kommen – auch jeder Mensch im Grunde genau, dass seine Seligkeit nur vollkommen sein kann, wenn auch alle andern selig sind, weil die Unseligen so lange unruhig und die Seligen durch ihre Bewegung störend sind, bis auch sie selig geworden sind. Dieses Erkennen bewirkt der Geist im Menschen! Noch viel gediegener weiss und kennt das der grosse Urgeist, den wir "Gott" oder noch besser "Vater" nennen, ansonst er uns nicht die Gebote der Liebe gegeben hätte. Aber der unreifen Seele kommt es, trotz des eigentlichen Wissens darum, oft nicht so vor. Sie denkt und empfindet im Handlungsmomente anders, weil sie noch nicht alle geistigen Wahrheiten in sich für bleibend erschlossen hat und ihr Erkennen deshalb lückenhaft ist. Sie ist es, welche die Bewegung braucht, um durch sie in den Zustand des Lichtes zu kommen, in welchem alle Resultate ebenso offen liegen, wie die Zahlen und die Rechnungsmöglichkeiten eines vollendeten Rechners.
Dabei ist es gleichgültig, ob die – natürlich im Innern notwendige – Bewegung aktiv oder passiv zustande kommt. Eine hartnäckige Seele braucht einen aktiven ihn selber treffenden innern Bewegungsreiz, den wir Empfindung nennen können; eine eher sanfte Seele braucht bloss einen passiven, Anteil nehmenden innern Bewegungsreiz. Also muss der Hartnäckige unter Umständen an seinem eigenen Leibe erfahren, was Not und Entbehrung ist, und dabei erkennen, dass doch nicht alles in Ordnung sein kann, wenn auch nur ein Einziger – nämlich er selbst – Not leidet, während die sanftere Seele schon dadurch geweckt oder bewegt werden kann, dass sie die Not der andern sieht und empfindet, und sich dadurch bewegen lässt zu einer Tat, welche sie dem geistigen Gesetze des Ausgleichs genügen lässt. Anstoss und darauf folgende Bewegung hat aber jede Seele nötig, um vollends geistig und damit ebenso unvergänglich zu werden wie die Wahrheit, die in allem ruht – wie der Ton, der sich Ewigkeiten hindurch gleich bleibt, ob er im Moment ertönt, oder nicht.
Wenn ein in seinem Erkennen sonst starrer Mensch nach einem Klopfen an der Haustüre dieselbe öffnet und vor sich, in der Kälte der Nacht, zwei weinende Kinder sieht, welche ihn um ein Almosen bitten, so wäre das eigentlich Anstoss genug, sich bewegen zu lassen. Weil aber der Hausherr in unserem angenommenen Falle sehr starr ist, spricht er nicht einmal ein Wort, sondern schlägt die Bitte der Kinder nur mit einer verneinenden Kopfbewegung ab. Er sieht die Enttäuschung in den Gesichtern der beiden Kinder nicht, aber er sieht, zu seiner Befriedigung, die beiden Ruhestörer sich wieder entfernen. Wie sie aber so unbeholfen, vor Schwachheit, grosser Kälte und Hunger zitternd, die Treppe hinab gehen, kommt ein gewaltiger Windstoss und lässt die Lumpen um den Leib der beiden Kinder flattern, sodass das kleinere aufzuschreien und zu weinen beginnt, sodass ihm das ältere sein Schürzchen schützend vor sein Gesichtchen halten will. Bei diesem fürsorglichen Bemühen aber gab der ohnehin knappe Lumpen ein Stück des Leibes seiner Trägerin frei und setzte es so dem kalten Winde aus. Das Kind jedoch achtete dessen nicht in seiner Sorge um sein Geschwisterchen, dem es seine ganze Aufmerksamkeit widmete. Das aber war nun doch ein stark bewegendes Bild für den starren, sonst bloss auf sein eigenes Wohl bedachten Hausherrn, und er sah nun plötzlich besser, als das leidende Kindlein, dass ein einziger Lappen denn doch nicht für zwei Kinder zusammen taugen kann, und er rief die Kinder zu sich zurück, liess sie dann zwar nur gerade in der Hausflur stehen, holte ihnen aber etwas zu Essen und einige alte Kleider, und gab ihnen sogar noch ein Geldstück mit auf ihren beschwerlichen Weg und entliess sie wieder. Der dankbare, liebevolle Blick des ältern der beiden Kinder beim Empfange der Gaben aber traf und bewegte ihn nochmals so stark, dass er nach dem Schliessen der Haustüre einen Moment lang gewünscht hätte, er hätte die Kinder sich erwärmen lassen in seiner warmen Stube.
Die Bewegung in der Musik entspricht also vor allem dem seelischen Bereiche, obgleich die allermeisten seelischen Bewegungen dann auch eine natürliche nach sich ziehen, wie sich in diesem Beispiel leicht erkennen lässt. Das Spüren dieser Erkenntnisse ist die Ahnung, welche die Musik in uns erweckt, und das hier Gesagte nur eine Erklärung dazu, welche das Grosse dieser Ahnung kaum erfasst, aber dennoch darauf hinzuweisen vermag.
19.2.89 und 2.1o.89
nach oben
DER VIELKLANG UND SEINE HARMONIE
l. Teil
DAS WESEN DES VIELKLANGES  Wenn wir einen Vielklang hören, dessen Harmonie uns anspricht, so lauschen wir ihm hingebungsvoll und erkennen darin nicht nur die einzelnen Töne, sondern ebenso auch ihr Ineinanderschwingen, ihr gegenseitiges Durchdringen und wieder Tangieren, welches dem ganzen Klang eine eigene, lebendige innere Rhythmik gibt, in welcher wir, wenn wir wollen, schon beinahe eine Melodie entdecken – jedenfalls eine Bewegung zwischen den einzelnen Tönen, wenn wir diese feine und durchsichtige Bewegung nicht gerade "Melodie" im eigentlichen Sinne nennen wollen.
Beim langen Aushalten eines Vielklanges werden wir bemerken, dass diese Bewegung eines Teiles schnell und periodisch wechselnd vor sich geht, wie ein Hin-und-Herschwingen sich äussernd, dass aber dann andern Teiles nach einer gewissen Anzahl Schwingungen auch eine grössere Überschneidung der Einzelschwingungen stattfindet, die den klanglichen Raum in seinem Wesen auf kurze Augenblicke verändert.
Beim andächtigen Lauschen eines solchen Vielklanges verspüren wir stets mehr und mehr, dass schon der einzelne Ton kein totes Ganzes ist, sondern in seinem Schwingen vielmehr Ähnlichkeiten mit dem menschlichen Gemüte hat, welches in ein und derselben Sache auch stets mehr oder weniger hin und her schwingt in der Beurteilung der Empfindung; gleichsam also, als würden wir an einem uns offenbaren Begebnis einmal mehr annehmend und dann wieder ablehnend teilnehmen. Je mehr wir in der Beurteilung schwanken, desto hörbarer werden unsere innern Schwingungen und desto zerrissener wirkt der entsprechende Ton. Je langsamer und fliessender wir schwanken in der Beurteilung und je weniger entschieden die Ablehnung oder die Annahme ausfallen, desto weniger vernehmen wir in der Entsprechung der Töne ihre Schwingungen, desto ruhiger und reiner wirkt der Ton, aber desto bewegender sein Klang.
Sähe beispielsweise jemand ein junges Paar, wie es so innig aneinander Anteil nehmend in den Frühling schreitet, und bemerkte dabei, wie der Mann seinen Arm um die Seite seiner Liebsten legt, so empfindet er, sofern er will, mit ihm, oder je nachdem mit ihr während der Zeit seiner Betrachtung. Und es erhebt sich im Betrachtenden die Frage, ob der Mann es nur darum tut, um so recht viele Berührung mit der Zartheit seines geliebten Weibchens zu haben, oder ob er – ganz anders – die Zartheit wohl erkennend, sein Liebstes nur schützend umfassen will. Und wenn allenfalls das sicher höhere Zweite, ob er dabei – das Erstere erkennend – nicht wankt in seiner ursprünglichen Absicht und in seiner Empfindung. Bleibt es also ein Geben, oder wird es – wenigstens teilweise – ein Nehmen. Dieselbe Frage stellt sich natürlich in noch viel direkterem Masse auch dem Manne selbst, wie es anderseits auch die Frau beschäftigen könnte, ja sollte, ob ihr Geliebter mit dieser Handlung gibt oder nimmt. Gibt er, so will sie ihm sicher auch geben, nimmt er aber, so könnte das auch ihre Liebe trüben – sie also mehr auf sich selbst bezogen machen.
So liegt jeder Handlung eine Absicht zu Grunde und löst eine Wirkung aus, und es fragt sich, wie der Handelnde reagiert, wenn er eine nicht berechnete Wirkung seiner Handlung zu spüren beginnt. Bleibt er bei seinem Handeln in der ursprünglichen Absicht, oder wechselt während der Handlung sein Handlungsgrund? Da die Seele zwischen Materie und Geist gestellt ist, bleibt dieses Schwingen im natürlichen Lebenszustande bei allen äusseren Handlungen stets bestehen. Und der Charakter einer Seele oder die Ordnung ihres Sinnes und dessen Festigkeit bewirkt dann eine mehr oder minder grosse Konstanz oder Reinheit. Je tiefer die Kenntnisse über alle die möglichen Folgen oder Wirkungen einer Handlung sind, und je genauer der Grund dazu erkannt wird, desto reiner auch ist die Durchführung, weil alle andern eventuell mitwirkenden Nebengründe, aber auch Nebenwirkungen und deren Rückwirkungen erkannt und separat beurteilt werden, und nur dem einen, zuerst erfassten Gedanken dienend, immer wieder neu geordnet werden – wenn das oftmals auch nur intuitiv und nicht unbedingt bis ins Letzte bewusst erfolget. Das entspricht dann dem freien Klang eines Tones – also reinen Schwingungen.
Beim Vielklang jedoch schwingen ja eben die Schwingungen jedes einzelnen Tones mit den Schwingungen der übrigen Töne durcheinander, was das bewegte, und auch periodisch wechselnde Klangbild erzeugt. Das soll an einem weitern Beispiel veranschaulicht werden: Wir betrachten dabei eine Szene, in welcher ein kleiner Knabe, am obern Ende einer Laubentreppe stehend, seinen spielenden Kameraden auf der Strasse zuschaut, und wir hören, wie diese ihn einladen, hinunter zu kommen und mitzuspielen. Auch wissen wir, dass er von seinem Vater ein genau begründetes Verbot hatte, auf die Strasse zu gehen. Und nun sehen wir, wie der Knabe einen nur kleinsten Moment überlegt und dann, seinen Kopf schüttelnd, die Einladung seiner Kameraden verneint. – Wenn wir diesen Kleinen in unserer Vorstellung so betrachten, wie bei seiner Antwort alles und jedes in seinem Wesen sich verneinend ausdrückt, so müssen wir bekennen, dass bei uns Erwachsenen in entscheidenden Fragen eine solche Entschiedenheit und damit auch eine solche Klarheit zumeist fehlen. Wenn wir nun versuchen, die Entscheidung dieses Kindes zu verstehen, so müssen wir erkennen, dass es dabei keine kleine Leistung vollbrachte, indem es besonders viele Fragen oder Handlungsgründe abklären und gegeneinander abwägen musste, oder mit andern Worten: einen bedeutenden Vielklang harmonisieren musste. Als erstes stand das Verbot des Vaters und damit das Erkennen, ob es sich seinem Gebote fügen solle oder nicht. Fügte es sich offenbar, so stand die Frage, ob es wollte, oder musste. War es Angst vor der Strafe oder Liebe zum wohlbegründeten väterlichen Verbot, die sich nur aus einer grundsätzlich schon vorhandenen Liebe zum Vater ergeben kann; oder war es bloss nur Liebe zur Ordnung? Diesem Verbot gegenüber stand auf der andern Seite die Verlockung, die eines Teiles in seiner Lust zum vorgeschlagenen Spiele bestand und andernteils auch in der Liebe zu seinen Kameraden. Der Kleine musste also Vieles auf einmal abwägen! Hätte er beispielsweise nur aus Angst vor Strafe seine Liebe zu Spiel und Kameraden zurückgestellt, so wäre seine Antwort bestimmt nicht so entschieden ausgefallen und hätte sich nicht in seinem ganzen Wesen und all seiner Gestik so frei offenbart, denn es wäre dabei Vernunft gegen Liebe in seiner Abwägung gestanden. Bei ihm aber stand Liebe zum Vater gegen Liebe zum Spiel, oder Liebe zum Höheren, im Geiste begründeten gegen Liebe zum Natürlichen. – Und da die Liebe unteilbar ist, wird sie stets zu einer reinen Entscheidung finden, indem man nicht zwei sich Anfeindende zugleich lieben kann.
Es müsste also diese Darstellung der Ereignisse, oder vielmehr die Darstellung des Zustandekommens der Entscheidung und die ihr folgende Handlungsweise dieses Kindes in der Musik mit einem harmonischen Vielklang erfolgen, da der Entschluss oder Handlungsgrund alleine in der abgewogenen und dadurch bereinigten Liebe liegt. Wäre jedoch für das Kind die Furcht vor Strafe zum Kriterium geworden, so hätte dabei die Furcht gegen die Liebe zu Spiel und Kameraden gestritten; und dabei wäre keine harmonische Lösung möglich, indem die Liebe sich gegenüber der Furcht nicht frei entfalten kann. Wäre die Entscheidung negativ oder positiv ausgefallen, so wäre in beiden Fällen doch die beengende Furcht gegenüber freier Liebe aufgetreten, und wir müssten diese Situation in einem Vielklang wiedergeben, der entweder in seiner Mehrheit oder Minderheit Dissonanzen aufweist, je nachdem, ob Furcht oder Liebe das Resultat mehr beeinflusst haben.
Nun müssten wir eigentlich aber noch genauer wissen, wie die Dissonanzen zustande kommen, und wie die Harmonien – nicht nur in der Musik, sondern auch zuinnerst in unserm Gemüt, und zwar auch, wenn wir nicht vor Entscheidungen gestellt sind. Diese Frage bis in die Einzelheiten zu erklären, würde zu weit führen. Weil wir aber hier die Ahnungen, welche die Musik in uns erweckt, zu beleuchten und zu begründen suchen, so wollen wir doch auf die Grundzüge des Harmoniegesetzes eingehen, das sowohl in der Musik, wie im Leben eines und dasselbe ist. Denn nur der Umstand dieser Einheit ist es, der die Tiefe der Wirkung der Musik auf unser Gemüt erklärt und auch derart eindeutig bestimmt, dass wir mit ihr leichter mehr sagen können, als durch die noch so weise gebrauchte Sprache. Denn das Wesen des Tones ist dem menschlichen Geiste direkt verwandt, und darum wie dieser fähig, der Seele durch das Gefühl, welches er in ihr erzeugt, Verhältnisse ahnungsweise aufzuzeigen, die dann, wenn sie einmal wahrgenommen worden sind, umgekehrt auch in einem ihnen entsprechenden Ton oder Vielklang wieder als geistige Impulse erkannt werden. Je mehr wir in uns auf solche Ahnungen achten, desto klarer wird mit der Zeit auch unser Verständnis für sie im täglichen Leben und – als Folge – auch für den Aussagewert der Töne. Die Sprache hingegen zergliedert das Gefühl in einzelne Worte, und bringt diese nur nacheinander zum Ausdruck, wonach sie der Hörer nach seiner Aufnahme wieder zusammenfügen muss, wobei er dann das in der ihm eigenen Weise tut – möglicherweise also anders als vom Redenden beabsichtigt. Der im Beispiel anschaulich gezeigte Vielklang sagt alles das aus, was die vielen Worte zu fassen versuchen. Er sagt aber noch weit mehr aus, was jedoch nur ein anderer Hörer vernimmt, der auf seine Art die Töne und ihr Zusammenwirken erfasst, weil sie ihm in ihrer Entsprechung anders gegenüberstehen. Denn sein Geist hat ihm, zufolge seiner seelischen Neigungen, anderes ahnungsweise näher gebracht. Nur wird man beim Vergleich aller möglichen Aussagen finden, dass sie sich decken, wenn man die Eigenart des beurteilenden Empfängers des Vielklanges in Beziehung, sowohl zum Vielklang als auch zum ersten Beurteiler ein und desselben Vielklanges setzt. Hätte ein Kind, in derselben Lage sich befindend, grosse Freude daran, mit seinem Ballspiel vor den andern glänzen zu können, so hätte es in seiner leidenschaftlichen Liebe zum eigenen Glanz ein derart heftiges Entscheidungsmoment, welches nicht so leicht mit Liebe zu einem wohlgemeinten Verbot überwunden werden könnte. Vielmehr bräuchte ein Kind in solcher Lage auch eine ebenso stark wirkende Gegenseite, wenn möglich wieder die Möglichkeit, zu glänzen – vielleicht vor seinem Vater, dem es mit der Verneinung des Spieles sein Pflichtbewusstsein vorzeigen kann –, vielleicht in Erwartung eines anerkennenden Lobes oder gar einer Belohnung. Ein solches Kind würde auch später, als Erwachsener, den auf die im ersten Beispiel zustande gekommene Art von Vielklang als zu unbestimmt oder gar zu süss empfinden, würde ihn auch einer gewissen Fadheit bezichtigen, die bei einer solchen Wesensart für ihn auch tatsächlich bestünde. Er bräuchte eine stärkere Tonintensität und weiter auseinander stehende Beziehungen der verschiedenen Töne, um einen solchen Vielklang mit sich selbst als in einem harmonischen Verhältnis zu empfinden. Der dem Entscheid des ersten Kindes entsprechende Vielklang wäre für ihn ebenso untragbar wie die Entscheidungsgrundlage des ersten Kindes. Denn je mehr auf Äusseres bezogene Urteile und Entscheidungen gefällt werden, desto unbestimmter werden die in der Tiefe des Gemütes empfangenen geistigen Impulse empfunden, sodass sie für die sie empfangende Seele schal wirken, weil sie immer mehr nach stärker wirkendem (Äussern) ein Verlangen hat. Die Reichhaltigkeit inneren Erlebens geht dabei verloren und wird darum auch in der Musik nicht mehr empfunden und erkannt. Wir ersehen daraus, dass in einer einzigen Entscheidung soviel an seelischer Arbeit verborgen liegt, dass sie mit Worten nie erschöpfend und die Gefühle klar und eindeutig berührend dargestellt werden kann. Nur Töne und ihr Zusammenklang vermögen darüber ein richtiges Bild zu geben. Betrachten wir zum Beispiel nur die folgende im Gefühl gut und deutlich wahrnehmbare unterschiedliche Empfindung bei zwei nebeneinander liegenden Tönen, je nachdem, ob wir sie nacheinander oder miteinander, als Zweiklang, hören:
Während wir beim Spielen der Tonleiter stets einen Tonschritt um den andern höher oder tiefer gleiten und daran einen Gefallen finden, so ertragen wir zwei Töne, die nebeneinander liegen – also auf der als schön empfundenen Tonleiter einander folgen – nur schlecht, wenn sie zusammen erklingen, wie wir bereits im Kapitel über die Tonhöhen festgestellt haben. Diese Erscheinung wird den unvoreingenommenen Betrachter dieser Tatsache doch überraschen! Denn: was würde man eher vermuten, als dass zwei beieinander seiende Töne, die wir während des Steigens oder Fallens auf der Tonleiter überdies als harmonisch zueinander empfinden, sich auch gut zu einem Paar zusammenfügen lassen müssten? Der Musiker weiss natürlich schon so lange um dieses Gesetz, dass er darüber weder Fragen mehr hat, noch Anstoss daran nimmt. Aber weil es nur eine Gewohnheit ist, welche ihn die mögliche seinerzeitige eigene Überraschung vergessen lässt, so hat er zumeist keine Erklärung dafür, und noch weniger findet er dasselbe Gesetz im Leben selbst wieder, weil ja jede Gewohnheit keine Erkenntnis, sondern eben nur ein Erdulden nicht beeinflussbarer Zustände oder Umstände – also ein gewisses Blindwerden ist. Beeinflussbar würden entweder die Umstände, oder das Gemüt, das sich an sie gewöhnen musste, durch die Erkenntnis des Grundes eines Umstandes. Eine solche Erkenntnis also bereichert uns, während uns die Gewohnheit verarmen lässt. Wenden wir uns also schnell dem Erkennen des Grundes für diesen Umstand zu, ehe auch wir mit der Angewöhnung einen Denkanstoss zu neuer Erkenntnis für uns verloren lassen gehen, und suchen wir in den mannigfachen Erscheinungen unserer innern Natur ähnliche Verhältnisse, welche uns die Empfindungen und Gefühle in der Musik erklären und begreifen helfen.
Was läge beispielsweise für die geistige Natur der Seele näher beieinander, als Geben und Nehmen? Denn alle Entwicklung und Ausbildung, jeder innere und äussere Fortschritt hängt von frühester Kindheit an vom Geben und Nehmen ab. Ohne einen, der entgegennimmt kann aber nichts gegeben werden, da jede Gabe ohne Empfänger so gut wie einem Fortwerfen gleich käme. Bestimmt also bilden die beiden Tätigkeiten ein einziges Paar und liegen unmittelbar beieinander. Aber sie bedingen dennoch zwei Personen, von denen eine jede bei der Handlung ein ganz anderes Gefühl hat. Diese beiden Gefühle lassen sich nicht vereinen, ja sie stehen einander diametral gegenüber, wie etwa Ruhe und Bewegung. Der passiv Nehmende oder Empfangende erhält das aus seiner Not heraus Notwendige und kommt dabei in diesem Augenblicke ins Gleichgewicht der Ruhe und Ausgeglichenheit (natürlich nur auf so lange, bis er wieder erneut ein Bedürfnis hat). Der Gebende aber, als der Aktive, erfüllt dabei sein Bedürfnis, seine Überfülle los zu werden, und damit Frucht zu tragen im Herzen seines Nächsten. (Selbstverständlich ist hier nur vom freiwilligen und herzlichen Geben und Nehmen die Rede.)
Nun kann aber in ein und demselben Menschen eine Überfülle und die Not eines Mangels in ein und derselben Sache nicht gut gedacht werden, weil die beiden einen Widerspruch beinhalten. Wo aber die Gefühle dennoch so widersprüchlich sind, da ist die grösste Dissonanz, die grösste Unruhe auch und die grösste Beklemmung oder Bedrängung. Es könnte dieser Zustand beispielsweise dann eintreten, wenn jemand voll Liebe seinem Nächsten etwas geben wollte, der Nächste aber würde das Gegebene nicht nur ablehnen, sondern noch ärgerlich werden und dem Geber etwas antun wollen. In diesem Falle streitet im Geber unter Umständen die Liebe mit der Eigenliebe, das heisst, er fragt sich: Soll ich zu der grossen Gabe noch soviel hinzugeben (an Verständnis und Geduld dem Nächsten gegenüber – oder auch an weitern Gaben), bis sich der Unmut des Beschenkten legt – oder soll ich mir für die Unverschämtheit des Empfängers eine Rache nehmen, beispielsweise dadurch, dass ich ihm das Gegebene wieder entziehe, oder ihm durch Beleidigungen seine Ruhe nehme, sodass auch er in Ärger käme, wenn er denn schon auch mich unbegründetermassen geärgert hat? In einem solchen Doppelzustand der Gefühle ist es kaum auszuhalten – in dieser Dissonanz, die unbedingt zu einer Entscheidung drängt. Es kann also der noch so schöne Schritt vom Geben zum Nehmen im Gefühl ein und derselben Person nicht gleichzeitig als Paar harmonisch anklingen. Deshalb empfinden wir auch in den mittleren Tonbereichen einen Sekund-akkord (zwei nebeneinander liegende und zusammen gespielte Töne) als äusserst dissonant, wie sehr uns anderseits der Schritt von einem Ton der Tonleiter zu seinem nächsten gefällt. Nun erinnern wir uns aber, dass im Kapitel über die Tonhöhen gesagt wurde, dass sowohl im tiefen Tonbereich, welcher am meisten der Liebe und der Wärme entspricht, als auch im höchsten Tonbereich, welcher dem kühlen Lichte der Weisheit entspricht, ein Sekundakkord keine hörbare Dissonanz mehr hat. Und diese Behauptung muss sich nun auch an diesem Beispiel erwahren. Dazu muss nochmals vorausschickend in Erinnerung gerufen werden, dass die Liebe als Kraft zweifach in Erscheinung treten kann: Positiv, als hingebende Liebe, im Sinne des Evangeliums, und negativ, als Eigenliebe. Besehen wir uns zuerst den äusserst Liebevollen im positiven Sinne (bei grösstmöglicher Vollendung – also entsprechend tiefster Tontiefe): All seine Gedanken sind Hingabe und Dienen. Nichts will er für sich, alles nur für die andern, weil nur das Glück der andern ihn glücklich macht. Erhält der so gestaltete Mensch etwas von einem andern, so kann er es nur annehmen, wenn er es in sich als sicher und fest verspürt, dass der Geber sich durch die Gabe unbedingt Luft und Ruhe seines liebeerregten Gemütes verschaffen muss. Die Gabe selbst zählt einem solchen Liebenden nichts, nur der Umstand, dass er durch die Annahme dem Geber eine Glückseligkeit verschaffen konnte, welche bei einer Verweigerung der Annahme leicht in Enttäuschung oder gar Trauer umgeschlagen hätte. Ein solcher Empfänger (wie man ihn zugegebenermassen auf dieser Erde nur selten trifft) gibt, selbst dann, wenn er nimmt. Bei ihm ist Geben und Nehmen ein und dasselbe – nämlich Geben, weil er nur auf das Geben achtet und ihn auch nur das Geben erfüllt und erfreut. Das Nehmen war dabei nur die unvermeidliche Voraussetzung für das Geben-Können. (Wenn das auf dieser Erde auch nur selten geschieht, so ist es dennoch leicht denkbar – obwohl nur sehr schwer ausführbar. Und dennoch ist der Christenheit der Himmel als durch ihre eigene Handlungsweise zugänglich – aber nicht verdienbar – versprochen. Er ist ja, als im Menschenherzen bleibend bestehend, auch nur unter diesen Bedingungen denkbar, denn als extrem glücklicher Zustand muss ja der Himmel auch die extremste Forderung der Liebe, Geduld und Demut erfüllen, wenn er Wirklichkeit im Menschenherzen werden will.)
Umgekehrt ist in der absoluten Hölle, wo der Eigennutz zur höchsten Maxime erhoben ist, das Geben stets ein Nehmen! Da jeder an ein Geben überhaupt nicht denkt, es sei denn, als Vorbedingung zu nachherigem umso grosszügigeren und unverschämteren Nehmens, herrscht dort – wie auf drei Vierteln der Erde auch – nur Not, Elend und Drangsal, nebst der daraus sich ergebenden innern Wut und Rachegier. Also gibt es auch in der negativen Form der Liebe – der Eigenliebe – keine Dissonanz zwischen Geben und Nehmen, weil dort beide nur ein Nehmen sind. Das unbestimmt abgegrenzte Beben und Schwingen dieser negativen Form der Liebe ist dort zwar ebenso heftig und die eigene Grenze überschreitend, aber eben nicht zum Geben, sondern nur zum weitmöglichsten Nehmen. Dumpfe tiefe Töne, die schnell verhallen, geben uns ein Vorgefühl für solche Zustände während wir das alles vergebende und ausgleichende Streichen von Bassgeigenseiten als ein Vorgefühl für himmlische Vergebung empfinden mögen.
Wie aber verhält es sich nun im höchsten, aber kühlsten Weisheitslichte? Da wird erkannt, dass nur der bewegende Austausch Leben ist. Also sind Geben und Nehmen nur die Pole des Lebens, und sind sich somit absolut gleich. Würde beispielsweise das Herz das Blut nicht weitergeben, welches es vom Venensystem empfängt, so erlöschete jedes physische Leben sofort. Würde das Blut den in der Lunge empfangenen Sauerstoff nicht weitergeben, und dafür die Kohlensäure zurücknehmen und wieder zur Lunge transportieren, so erlöschete das Leben ebenfalls sofort. Würde der Magen die empfangene Nahrung nicht weitergeben, er würde zugrunde gehen, weil er nicht zur Aufbewahrung und Hortung von Nahrung erschaffen wurde, sondern zur Sondierung, Auflösung und Weitergabe derselben, sodass vom Leben und der Arbeit des Magens auch der ganze übrige Mensch lebt, inklusive dem Herzen, welches das gesättigte Blut wieder weiterbefördert, welches es zuvor empfangen hatte.
Würde die Sonne, als das Herz und der grosse Magen der Planeten zugleich, ihre Kraft des Lichtes nicht an diese weitergeben, so würde sie zerstört in der Masse ihrer Überfülle und alles im unendlichen Raum erstürbe in gänzlicher Wärmelosigkeit. Und solcher Beispiele gäbe es unzählige mehr. Selbst die Pole eines Magneten sind auf Geben und Nehmen angewiesen. Würde ausserhalb des Eisenstabes nicht vom Nordpol zum Südpol eine Kraft fliessen, wie könnte sie innerhalb des Stabes wieder vom Süd- zum Nordpol zurückfliessen? Und würde sie es nicht, wo wäre dann die magnetische Kraft, welche, stets überströmend, das ihr verwandte Eisen ergreifen kann? Also sind in der Weisheit Geben und Nehmen eins, und nicht zwei. Es sind die Pole, und sind – wie die Erdpole – ein Ganzes, ja eine einzige Grundachse, um welche sich eine ganze Welt mit all ihrem undenkbar vielgestaltigen Leben ständig drehen kann. Zur Weisheit aber kann es die negative Form der Liebe, die Eigenliebe, nicht bringen, sie ist in diesen Höhen nicht vertreten, wo alles licht und klar durchschaut werden kann. Denn sie kennt nur einen dieser beiden Pole: das Nehmen. Auch ihre Wärme wird zwar zur Flamme, die sich aber so sehr auf sich selbst konzentriert, dass sie damit alle ausser ihr liegenden Möglichkeiten verliert und in unerträglicher Erkenntnishitze über ihre Isoliertheit alle Freiheit verliert. Soviel über die Harmonie und Disharmonie vom Nachbarpaar "Geben und Nehmen" in den verschieden hohen Tonbereichen!
Weil aber die Tonleiter – als Leiter – Stufen oder Tritte hat, so können wir das Verständnis der Disharmonie oder Dissonanz des Sekundakkordes auch beim Fortschritt oder Fortschreiten erkennen. Und so wollen wir diesen Fortschritt, den Ablauf des Fortschreitens zergliedernd, zur Grundlage eines zweiten Beispieles nehmen, welches uns den Grund der Dissonanz eines Sekundakkordes noch mehr verdeutlichen soll: Wenn wir das Schreiten an und für sich beschaulich in uns betrachten, so erkennen wir, dass es in der Aufgabe des Gleichgewichtes, (Geben – Hingabe des Gleichgewichtes an die Möglichkeit des Fortschritts) also dem Fallen (nach vorn) und der Annahme (Nehmen) eines neuen Gleichgewichtes, also dem Hemmen eines zu grossen Falles nach vorne, besteht. Geistig verhält es sich ebenso! Wer im Gleichgewicht seiner Erkenntnisse steht, kann zwar gewiss glücklich sein, wenn seine Erkenntnisse gut und wahr sind, aber Fortschritt ist in diesem Zustande nicht möglich. Erst wenn der sich im Gleichgewicht Befindliche von neuen Erscheinungen in seinem "Ruheschläfchen" geweckt wird, und vom Platze seines Gleichgewichtes durch eben diese Erscheinungen gedrängt wird, also aus dem Gleichgewicht zu fallen beginnt, wird er die Chance zu einem neuen Schritt (einem Fortschritt) erhalten, den er dadurch vollzieht, dass er die Gründe und Bedingungen dieser neuen Erscheinung erkennt, sodass er dieser gegenüber durch die Beherrschung ihrer Gründe wieder ins Gleichgewicht kommt, jedoch nun in fortgeschrittener Stellung – nämlich um eine Erfahrung reicher. Die Liebe zum Licht, und damit zu neuer Erkenntnis, neigt den Liebenden aber oft von selbst in Richtung zum angestrebten Licht, und dieser lässt sich dann freiwillig fallen gegen seinen geliebten Erkenntnisgegenstand zu, wobei die gewonnene Erkenntnis ihn dann wieder in ein neues Gleichgewicht versetzt, wenn er ihr ganz habhaft werden konnte.
Wer das gewohnt ist, empfindet das Gehen als etwas ganz Natürliches, und nicht als ein Fallen und Aufheben des Falles; aber in sich selbst bleibt es dennoch so – im natürlichen, wie im geistigen Bereiche. Dafür ein Beispiel:
Ein Junge, der sich nicht gerne waschen lässt, kommt auf einer Wanderung mit seinen Eltern auf heisser, staubiger Strasse endlich an einen Brunnen und erkennt sofort den Wert des Wassers, den er vorher nie so recht zu schätzen wusste, weil er stets bessere Getränke von seinen Eltern erhielt und das Wasser nur vom Gewaschenwerden her kannte. Gierig trinkt er aus der Brunnenröhre und erkennt dabei die Vorzüglichkeit und Nützlichkeit des Wassers. In seiner Gier aber verliert er sein Gleichgewicht und fällt in den Brunnen, woraus ihn die Eltern retten müssen, weil der Brunnen tief war und der Knabe für einen Moment die Besinnung verlor. Nun war seine erste (angenehme) Erkenntnis (der erste Schritt auf seiner Erkenntnisleiter), dass das Wasser gut sei, beschränkt worden durch eine zweite, äusserst unangenehme Erkenntnis (den zweiten Schritt der Erkenntnisleiter), dass das Wasser doch nicht nur gut, sondern auch gefährlich sei, oder dann nur im richtigen Masse gut sei – im Übermasse aber den Tod bringe. Daraus ergibt sich eine neue, volle und ganze Erkenntnis, ein Gleichgewicht auf höherem Stand (der dritten Stufe, nach den passierten Stufen l und 2 auf der Erkenntnisstufenleiter) – in welchem Masse nämlich und bei welchen Gelegenheiten das Gute gut ist. Die beiden Erkenntnisstufen auf einmal empfunden, sind verwirrend, dissonant – nach Klärung verlangend, aber die Vollerkenntnis verhält sich dann zum ersten Standpunkt wieder harmonisch. Jeder Erkenntnisinhalt aber wird begrenzt durch die ihn bedingenden Umstände, also ist Inhalt und die Bedingung, die Begrenzung oder äussere Form des Inhaltes stets ein Ganzes, aber sich auch Widerstreitendes, denn die Grenze beengt ja den Inhalt. "Gut" als solches ist also nichts – sondern gut wird es nur durch seine Begrenzung auf das richtige Mass. Das ist bei der Nahrung, bei der Sonne, beim Regen, beim Wind und gar bei der Liebe so, wie es selbst bei der Medizin so ist, dass sie nur in ihrer Begrenzung gut ist, während sie ohne diese verheerend wirkt. Wer das Gute eines Dinges erkannt hat, aber seine Begrenzung noch nicht kennt, der kennt nur die Hälfte. Beide Hälften aber streiten miteinander, erst die Gesamterkenntnis, welche eine Erkenntnis aus den vorigen beiden Teilerkenntnissen ist, hat die harmonische Ruhe wieder in sich. In der Musik heisst dieser Schritt "Terz", ein 3-Schritt also, und ist in allen möglichen Höhenlagen als Akkord (Vielklang) schön und harmonisch zu vernehmen, sodass man die Tonleiter gut in Terzakkorden hinauf- und hinunterklettern kann. Es ist also, im Gegensatz zum Sekundakkord, welcher die kleinste Dissonanz ist, der Terzakkord der kleinste harmonische Vielklang (oder besser: Zweiklang).
Es würde zwar zu weit führen, wenn wir alle Harmonien und Dissonanzen hier in der geistigen Entsprechung begründen oder ergründen wollten, aber diese beiden kleinsten und unkompliziertesten Einheiten waren zu erklären notwendig, damit wir die grösseren und komplizierteren besser zu erahnen imstande sind. Für die Harmonie des Dreiklanges 1 - 3 - 5, welcher in sich die Terz (1 - 3) fasst, und über einen weitern Zwischenton (bei der Dur-Tonleiter in halber Höhe) zu 5 kommt, können wir die Erklärung benutzen, dass zu einem vollen Erkenntnisbegriff (1 - 3) eine kleine Teilerkenntnis hinzuaddiert, und so zu einer erweiterten Erkenntnis gestaltet, diese neue "Gross-Erkenntnis" immer noch eine harmonische ist, falls die durch die Halbtonschritte der Tonleiter bedingte kleine Terz auf der hohen, und die volle, grosse Terz (oder Erkenntnis) auf der tiefen (Liebes-) Seite der Tonskala liegt. Das ist auf der Dur-Tonleiter nur auf den Stufen l, 4 und 5 beginnend möglich.
Es entspricht eine solche erweiterte Erkenntnis zum Beispiel der Erkenntnis des Wassertrinkers, dass das gesunde Wasser nicht nur in der rechten Menge (keine Übermenge) vorhanden sein muss, sondern überdies auch sein Wärmezustand (nicht zu kalt und nicht zu heiss) wichtig ist für das Wohlbefinden des Wasseranwenders. Soweit ist das jedem klar, der Wasser trinkt.
Nun könnte er aber in einem stillen und beschaulichen Augenblick der Dankbarkeit – wenn er etwa bei trockenem, heissen Wetter etwas Wasser zu sich genommen hat, und seine Erfrischung dankbar zu verspüren beginnt – über das Wasser folgendermassen nachzudenken beginnen: "Wie herrlich ist es doch, dass sich auch in der heissesten Jahreszeit noch stets ein kühles, erfrischendes Wasser vorfindet, das mich nicht nur durch seine Kühle erlabt, sondern auch durch seine benetzende Wirkung meine Säfte erneuern hilft, sodass ich dadurch gestärkt werde." In der Musik könnten wir diesen Gedankengang oder dieses dankbare Fühlen mit dem Vielklang 1-3-5 oder auch 1-5 und anschliessend 1-3 wiedergeben. In der erregten Liebe zum Guten des Wassers kommt dem Dankbaren aber dennoch wieder – vielleicht, weil er sich eine grosse Menge des ihm wohltuenden Wassers vorzustellen beginnt – die Erfahrung in Erinnerung, dass grosse Wassermassen äusserst gefährlich sein können. Diese in Erinnerung gerufene Erkenntnis liesse ihn leicht erschauern, und er würde trotz seiner Dankbarkeit dem wohltuenden Wasser gegenüber die Dissonanz seiner Gefühle im Sekundakkord 1-2 ausdrücken müssen, oder diesen Zweiklang als seinem Gefühle entsprechend empfinden, solange er daran denkt, wie nahe Gut und Böse im Wasser beieinander sind. Nun hat aber unser dankbarer, Wasser trinkende Wanderer aus grosser Liebe und Dankbarkeit über das Wasser nachzusinnen begonnen – hatte also dem Zuge der Liebe folgend seine Erkenntnisse von der Weisheit her auf seine ursprüngliche Liebe zum Wasser zu konzentrieren begonnen, bis er schliesslich zu der Dissonanz kam. Was also läge in diesem Falle näher, als dass er aus eben dieser Liebe heraus, ihrem Zuge folgend, sich selbst in ein anderes Verhältnis zum Wasser setzt, anstatt das Wasser in ein Verhältnis zu ihm? Wenn er also demütig weiter philosophieren würde, dass es ja gut sei, wenn von diesem allerwichtigsten und lebens-notwendigsten Stoffe auf der Welt möglichst viel vorhanden sei, dass er selbst dafür aber einen demütigen Respektsabstand von dem Wasser einhalten kann, sodass ihm des Wassers noch so grosse Masse nie gefährlich werden kann, so hat er das rechte Mass nicht in die Begrenzung des Wassers gesetzt, sondern in sein eigenes Wesen. Ein solcher Wesenszug nennen wir Demut, welche der wahren, reinen Liebe immer eigen ist. Der Wanderer auf dieser Erde ist damit wieder zu einer neuen und vollen Erkenntnis in der Richtung zur Liebe hin gekommen – hat also die Sekunde nach unten, nach der Wärme oder Liebe hin, um eine Teilerkenntnis zu einer harmonischen Terz oder Vollerkenntnis ausgeweitet.
In dieser Ausweitung liegt – und das müsste man jetzt hören können – eine herrliche Erlösung, ein Heimkehren zur Ruhe, und in dieser Ruhe spiegelt sich das Licht der Innewerdung wieder, dass er dadurch um eine Vollerkenntnis reicher geworden ist. Im Moment dieser Innewerdung aber hat er – trotz dem Zuge zur Liebe hin – einen Schritt in die Richtung vermehrten Lichtes (vermehrter Erkenntnis) gemacht. Leider lässt sich das in Worten nicht deutlicher geben, aber man müsste einmal diese einfache musikalische Bewegung anhören und ihr nachempfinden, wenn sie von der weiten Quinte (l - 5) sich verengt über die Terz, und konzentriert bis zur dissonanten Sekunde, welche sich dann in die Tiefe erweitert zu einer neuen Terz (einer neuen Heimat oder Erkenntnis), welche nachwirkend alle durchdachten Momente ins richtige Licht rücken lässt, sodass wir wieder im bescheidenen Gleichgewicht der Anfangserkenntnis stehen, aber bereichert durch eine tiefe Erfahrung – ähnlich der im Kapitel "Tonhöhe" geschilderten Entwicklung Hiobs, nur mit dem Unterschied der Freiwilligkeit der Erfahrung. Es sei deshalb der ganze Vorgang nachfolgend auch in Noten angegeben:

Das ist wirklich ein allereinfachstes musikalisches Erlebnis. Wer sich aber Zeit nimmt, es am Klavier zu erleben, der kann leicht begreifen, was die Töne uns zu sagen haben, und kann sich gut vorstellen, welch ein Reichtum erst ein grösserer, mehrere Töne umfassender Vielklang enthält. Niemand vermag das jedoch voll zu erfassen. Aber jedermann spürt, dass in der Musik der Weg zu stets grösserem Reichtum offen liegt, und erlebt ein ganz klein wenig den Himmel im Voraus. Denn jene Gefühle, welche sich uns beim Hören reiner Harmonien bemächtigen, sind im Prinzip die nämlichen, welche unser Gemüt erheben, wenn wir in der von der Liebe zum Ganzen geforderten Art und Weise tätig werden – zuerst gedanklich und nachher auch tatsächlich, weil ja erst die Tat im Verein mit unsern Gedanken unser Gemüt voll empfindungsfähig macht.
Es würde aber unsere Seligkeit mindern, würden wir alle diese Seligkeiten mit dem Verstande zergliedern wollen, und wir wären bei einer solchen Zergliederung in Einzelerkenntnisse dem Neuen nicht mehr so lebendig und empfindungsreich genug offen, als wenn wir nur ahnungsweise erfassen, was uns die empfundenen Seligkeiten der Harmonie alles zu sagen und zu bedeuten haben. Denn es gehört ja zur Seligkeit, dass sie bei allem Glück, das sie empfindet, auch stets verspürt, dass sie nie an eine endgültige Grenze stossen kann, die ja ihr Ende bedeuten müsste. Darum wollen wir die Betrachtungen über den weitläufigsten aller Aspekte der Musik schon an dieser Stelle vorläufig abschliessen, insbesondere auch, weil die Harmonie des Zusammenklingens verschiedener Töne für Nicht-Musizierende schwieriger zu erkennen und zu begreifen ist, als die Beurteilung der einzelnen Töne an sich, in Bezug auf ihre Höhenlage, Lautstärke und Länge. Und dennoch blieben dabei wichtige und fundamentale Entsprechungserkenntnisse unaufgedeckt, sodass es schade wäre, diese dem Interessierten nicht zu enthüllen. Darum soll hier ein zweiter Teil dieses Kapitels für den Interessierten angegliedert sein, welcher aber nicht die übliche Harmonielehre aufzeigen oder erklären soll, sondern die Harmonie nur in der geistigen Entsprechung der Töne begründen soll, sodass wir den Grund der Tiefe unserer Gefühle besser erahnen können.
nach oben
2. Teil
DIE HARMONIE  So himmlisch rein wie Töne, so differenziert das Gefühl ansprechend und so harmonisch voll und ganz wie die Musik (die gute Musik selbstverständlich nur), ist sonst nur der Himmel selbst, oder der reine Geist; und es ist deshalb schwer, mit Worten das wiederzugeben, was darin liegt. Dabei müssen die Worte und Begriffe schon sehr fein abgewogen sein – eben mit der Subtilität des Himmels, in welchem es keine Resten und keine Härten gibt, ansonst es nicht der Himmel wäre. Zudem müssen wir erkennen, dass der Himmel und seine Sprache, die Musik, als ein Inwendigstes in stetem Gegensatz zum Äussern stehen. So ist schon eine ausgesprochene, vorher noch so tief gefühlte und empfundene Wahrheit, als ein Geäussertes, keine Wahrheit mehr, weil sie aus all den Zusammenhängen und tief empfundenen Bedingungen herausgerissen wurde, um sie nach aussen hinstellen zu können. Wenn aber der Vernehmende dieser Wahrheit nicht alle Bedingungen kennt, die zur ausgesprochenen Wahrheit gehören, so kann er diese nicht richtig verwenden – und falsch angewendet wird die beste Wahrheit zur Lüge. Dafür ein Beispiel:
Es stirbt ein guter Vater in relativ jungen Jahren dahin. Ein guter Bekannter von ihm, der schon einige Zeit in der Fremde weilte, kommt zum Begräbnis und erkundigt sich nacheinander bei der Gattin, den Kindern, dem Arzt und zuletzt noch bei einem guten Freunde des Verstorbenen, wieso denn der ihm so teure Freund so früh gestorben sei. Da berichtet ihm die Frau, dass ihn der Arzt aus einer Gleichgültigkeit heraus falsch behandelt habe und deshalb ein vorerst kleines Geschwür habe auswachsen können, das seine Kräfte mit der Zeit voll aufzuzehren vermochte. Die Kinder jedoch sagten aus, der Vater habe eine Nebenfrau gehabt, und diese hätte ihn angesteckt. Und der Arzt meinte schliesslich, seine Arznei wäre schon recht gewesen, da sie solche Krankheiten noch stets geheilt habe, nur habe der Patient sie nicht wie vorgeschrieben angewendet und sei überhaupt eher nachlässig seiner Gesundheit gegenüber gewesen. Und der gute Freund endlich sagte aus, dass die Familie den Vater zu sehr enttäuscht habe, dass tiefer Kummer ihn so früh habe von dieser Welt scheiden lassen; denn seine Kinder wollten sich nicht eine gute Richtung geben lassen und seine Frau hätte ihn bei seinen Bestrebungen in der Erziehung nicht unterstützt und ihn auch nie verstanden, was das innere, geistige Leben und seine Entwicklung anbelangte, wiewohl sie ihm äusserlich eine untadelige Gattin war.
Wo liegt hier denn die Wahrheit? Nehmen wir an, der Freund, der diesen Vater ja gut kennen musste, weil er kein Muss-Verhältnis zu ihm hatte, habe recht gehabt. Hat er damit auch bereits die volle Wahrheit gesagt? Der gute Vater hatte zwar wohl eine Beziehung zu einer andern Frau, welche seinen innern Reichtum besser einschätzte als seine Familie, aber er hatte kein Verhältnis mit ihr und konnte sich deshalb dort auch nicht anstecken lassen. Aber vorher einmal, nach einem schweren Streitfall in der Familie, verliess er noch des Abends das Haus und kehrte erst anderntags wieder heim. Damals hatte ihn eine Wohlfeile angesprochen und ihm schöngetan, sodass sein verwundetes Herz in der Verzweiflung darauf einging, und dabei das Äussere für das Innere, also für echt, hielt; und dort hatte er sich damals auch angesteckt. Der Arzt, den er aufsuchte, mass dem Ganzen keine grosse Bedeutung bei, weil es nicht eine der grossen Geschlechtskrankheiten war. Insbesondere ging er aber nicht auf den Gemütszustand, und damit auf den übrigen Gesundheitszustand ein, zum ersten, weil er nur wenig Zeit hatte, und zum zweiten aber auch, weil er sich nicht unnötig weitere Sorgen und Arbeit machen wollte für ein und dasselbe Honorar. Sonst hätte er ihm wohl einen längeren Kuraufenthalt empfohlen, welcher ihn auf eine gewisse Zeit der Last des Familienalltages entbunden hätte. Der täglich aufbrauchende Verkehr mit seiner Familie aber liess eine volle Genesung nicht so leicht zu, sodass die Krankheit, den Patienten schwächend, chronisch wurde und seine Lebenskräfte schlussendlich ganz aufzehrte, bis er dann starb. Die Grundwahrheit also erkannte noch am ehesten der Freund. Alle andern Nebenumstände oder -wahrheiten aber waren massgeblich am schlussendlichen Tode beteiligt, wären aber dennoch nie zum Tragen gekommen, hätte nicht die schwere Belastung bestanden, welche den Mann zeitweilig ausser Hauses getrieben hatten. Es war wohl ein innerer Grund für den frühen Tod vorhanden, aber die Ursache war eine äussere. Dieser Grund war aber wiederum nicht einfach die Familie, sondern ebenso seine Schwäche, mit diesem Umstand nicht fertig werden zu können. Dabei lässt sich aus der Geschichte nicht entscheiden, ob der Mann relativ schwach war, oder die Familie relativ schlecht. Also liegt der letztendliche Grund des frühen Todes im Missverhältnis der Kraft dieses Mannes zur Familie – oder dann in der zu grossen Aufgabe, welche sich der Mann dadurch aufgebürdet hatte, dass er das Natürliche der Familie mehr als vorderhand möglich vergeistigen wollte.
Es zeigen die Verhältnisse des sicher nicht allzu komplizierten Falles, dass erstens die ganze Wahrheit mit Worten zu bezeichnen ein äusserst schwieriges Unterfangen ist, welches mit Tönen viel besser, vollständiger und gerundeter wiedergegeben werden könnte; und es zeigt sich zweitens, dass die aus den Bedingungen herausgenommene Wahrheit, als Teilwahrheit, nichts anderes als Lüge ist. Ob sie die Frau, der Arzt oder die Kinder aussprechen.
Es zeigt aber auch, dass das Natürliche (die Ansteckung) hier einen gar grosswichtigen Teil einnimmt, obwohl doch nur das geistig-seelische Verhältnis Grund und Ursache sein konnte. Denn die angesteckte Krankheit war ja keine tödliche, und hatte dennoch den Tod gebracht, aber nur, weil die seelisch-geistigen Verhältnisse sie zuerst ermöglicht, und nachher erst noch eine sehr wohl möglich gewesene Heilung verhindert hatten.
Also ist das scheinbar gross wirkende Natürliche im Geiste der Wahrheit betrachtet unendlich klein, und umgekehrt, das dem Naturverstande äusserst gering vorkommende seelisch-geistige Verhältnis verheerend mächtig. Und damit sind wir beim Kern der Sache! Das Geistige streitet stets gegen das Natürliche und umgekehrt, das Natürliche gegen das Geistige. Deshalb auch der Ausspruch in der Bibel, dass das, was vor der Welt (dem Natürlichen, dem Menschen) gross ist, vor Gott (dem Geiste) ein Gräuel sei. Wieso das? Das müssen wir zuerst begreifen, wenn wir die Harmoniegesetze voll verstehen wollen!
Betrachten wir einen reichen Menschen, der in seinem Reichtume sich alles leisten kann, was die Welt (das Natürliche) ihm nur bieten kann. Er schwelgt in den tausend Möglichkeiten, die er hat, und geniesst. Er braucht und verbraucht alles. Nichts muss er tun, alles wird ihm auf seinen Wunsch hin getan – von Menschen, Maschinen oder Einrichtungen. Einmal aber kommt der Punkt, wo er wirklich alles bis zur Genüge, ja bis zur Übergenüge genossen hat. Dann wird er einsam und verlassen sein! Wohl dienen ihm noch dieselben Menschen und Maschinen, aber er ist ihres Dienstes überdrüssig und will ihn nicht mehr. Selber etwas zu tun hat er aber verlernt, sodass er ständig auf dasjenige angewiesen ist, dessen er überdrüssig geworden ist, was ihm die Ruhe, und damit allen Reichtum des Erlebens nimmt. Denn: was einem Überdruss bereitet, kann man nicht mehr als Reichtum bezeichnen. Wer also kann diesem Reichen helfen? Die andern vermögen es seines Überdrusses wegen nicht, und er selbst vermag es seiner erworbenen geistigen (Willens-) Schwäche wegen nicht. Kann er geistig noch ärmer sein?
Nun betrachten wir dagegen einen Armen, der nichts vorrätig hat und froh sein muss, wenn er stets das zum Leben Notwendigste erhält. Er ist darüber – seiner frohen Natur wegen – nicht verbittert, hilft gerne jedermann, weil er ja Zeit hat, und ist erst noch dankbar, wenn er für irgendeinen Dienst eine Kleinigkeit erhält, weil er ja nie um einer Gegengabe willen geholfen hat. Er kommt auch durch einen Zufall zu dem früher geschilderten Reichen, weil er einmal eines morgens am Rande seines etwas abseits gelegenen, grossen Parks – ganz hingerissen von der herrlichen Morgenstimmung – mit seiner klangvoll reinen Stimme sang, als gerade der Reiche, der nicht gut geschlafen hatte, einen frühen Morgenspaziergang machte. Als der Reiche, dem erbauenden Gesange nachgehend, dann einen ärmlich gekleideten Mann am Rande seines Parks andächtig singen sah, konnte er es, seine Standesgewohnheit verleugnend, nicht bleiben lassen, den so hingebungsvollen Sänger, der ihn nicht hatte kommen sehen, anzusprechen. "Was für eine Freude habt Ihr denn erlebt, dass Ihr so laut und herrlich singet zu dieser frühen Stunde?" unterbrach er den Gesang mit seiner Frage. – "Oh, Verzeihung! – Ich wollte nicht stören. Ich habe mich ein wenig selbst vergessen und nicht daran gedacht, dass hier jemand sein könnte", entschuldigte sich sofort und beinahe unterwürfig der Arme und wollte gehen, aber der Reiche hielt ihn mit dem Beharren auf seiner Frage zurück und wollte wissen, was für eine Freude er erlebt habe. Denn sein Singen müsse doch einen Grund haben. Da meinte bescheiden der Arme, dass eben heute die Luft so heiter und frisch sei, und der Aufgang der Sonne so herrlich zu betrachten war, aus dieser wohnlichen Gruppierung von Bäumen heraus gesehen, sodass er sich wie zu Hause gefühlt habe, wohlbehütet von einem gütigen Vater. Und diesem habe er eigentlich entgegen gesungen. "Habt Ihr denn schon etwas zu Morgen gegessen?" erkundigte sich, das Ganze zwar nicht verstehend und dennoch etwas wie von ferner Jugendzeit her ahnend, der Reiche – jedoch ohne innere Anteilnahme. Diese Frage verneinte der Arme, indem er darauf hinwies, dass er in einer Wallung von Dankbarkeit den Hunger ganz vergessen könne, und dass er bestimmt noch irgendetwas zu essen bekomme. Da übergab ihm der Reiche aus einer guten Laune über die willkommene Unterbrechung seines eintönigen Tagesablaufes heraus mit einer grosszügigen Geste einen grösseren Geldschein mit dem Bedeuten, dass er damit etwas zu Essen kaufen könne. Dabei wurde das Gesicht des Armen ernster und seine Augen wurden feucht, und es verstrich eine kleine Weile, ehe er sich seiner Stimme so weit bemächtigen konnte, um sich bedanken zu können. Das fiel dem Reichen auf, und er fragte den Armen verwundert, was ihn denn nun so bewegt habe. Und der Arme erwiderte: "Guter Mann, Ihr habt mich nun so reichlich beschenkt – nun, da ich gerade so reich und glücklich war, mit Euch zusammen, gleich einem Bruderpaare, in der segnenden Wärme der vor uns allen aufgehenden Sonne zu stehen – und nun sollen uns unsere verschiedenen Wege wieder trennen. Ich selber dabei voller Reichtum, zu welchem Ihr mir noch eine materielle Gabe hinzugefügt habt, und Ihr so leeren Herzens, dem ich doch so gerne etwas hätte geben mögen und dennoch spüren muss, dass sich das, was ich besitze, nicht geben lässt. Wie schön wäre es doch, wir könnten beide als Reiche auseinander gehen, wohl verspürend, dass wir uns einmal, wenn die Sonne unseres irdischen Lebens sich endgültig unserem natürlichen Horizont zu nähern beginnt, wiedersehen könnten und wir gemeinsam eingehen könnten ins ewige Licht, dessen Milde wir heute früh in so herrlich schöner Entsprechung gemeinsam erfahren durften. – Was gäbe ich nun alles her, damit Ihr teilhaben könntet – –, habt aber wenigstens meinen innigsten Dank und eine schöne, eine allerschönste Erinnerung an diese Begegnung." Da erkannte der Reiche den unermesslichen, unfassbaren Reichtum des Armen, und er stahl sich betroffen, aber nicht ohne eine dankbare Rührung davon. Denn nun hatte er einmal ein (geistiges) Morgenmahl eines wirklich Reichen erlebt, und das stärkte ihn den ganzen Tag über, während der Arme einen Blick in die Armut – die fast unheilbare Armut – getan hatte. Und erkannte dabei, dass Reichtum in der Welt Reichtum im Geiste ausschliesse, und – wie er an sich selber erfuhr – Reichtum des Geistes auch Reichtum der Welt ausschliesse. Er erkannte, dass ein Fortschritt in der Welt stets ein Rückschritt im Geiste nach sich ziehe. Kurz, er erkannte den Widerspruch des Geistigen zum Natürlichen, und dass man deshalb nicht beiden zugleich dienen kann.
Bevor wir nach dieser für irdische Begriffe fast allzu schönen Geschichte wieder zur Musik zurückkehren, um die Aussage ihrer Töne und Tonkombinationen anhand dieser gleichnishaften Episode noch besser zu begreifen, ist es nicht verfehlt, darauf hinzuweisen, dass es im wirklichen so genannt alltäglichen Leben solche Episoden immer wieder gibt. Weil sie sich dort aber oft über einen längeren Zeitraum erstrecken und viele Gedanken dazu dort nicht ausgesprochen werden, erkennen wir sie nicht so leicht wieder. Aber gerade in der Geschichte der Musik und in den Lebensschicksalen der Musiker geschehen sie mit frappanter Ähnlichkeit immer wieder. Was anderes als das Paar dieses Armen und Reichen sind doch oft die Komponisten in ihrem Verhältnis zu Theaterdirektoren oder Verlegern. Die einen geben ihren innersten Reichtum – und damit alles –, um ihre Nächsten zu beglücken und die andern kassieren das Geld für sich, das den irdisch Armen und nur geistig Reichen so nötig wäre und ihnen auf Grund ihrer Leistung auch zustehen würde.
Wie erging es zum Beispiel doch Albert Lortzing, dessen gemütreiche Opern – besonders "Zar und Zimmermann" – von unzähligen Theatern in vielen Ländern aufgeführt wurden, ohne dass ihm dafür die ihm zustehenden Urheberrechte abgegolten worden wären. Dabei getraute er sich oft nicht einmal so recht, seinen innersten Reichtum so ganz frei heraus preiszugeben, wenn er zum Beispiel zögerte, die herrliche Arie des Zaren in "Zar und Zimmermann": "Sonst spielt' ich mit Szepter, mit Krone und Stern" in sie hinein zu nehmen und sich erst dazu entschliessen konnte, als er sah, wie gut seine Oper aufgenommen wurde. Er wusste um die Unbekümmertheit der Massen und um die gesellschaftlichen Gepflogenheiten der damaligen Menschen, welche himmlisch Schönes nicht gerne offen gezeigt haben wollten, weil es sie in ihrer äussern, weltlichen Rolle zu sehr hätte beschämen müssen. Der Zar erinnert sich in dieser Arie an die trauten Stunden mit seinem Vater und preist die Seligkeit, ein Kind zu sein, beklagt die Einsamkeit in seiner jetzigen Würde und freut sich auf ein jenseitiges wieder Kindsein bei seinem ewigen Vater im Himmel. Die letzte Strophe lautet:
Und endet dies Streben, und endet die Pein,
So setzt man dem Kaiser ein Denkmal von Stein.
Ein Denkmal im Herzen erwirbt er sich kaum,
Denn irdische Grösse erlischt wie ein Traum.
Doch rufst du, Allgüt'ger: "In Frieden geh' ein!"
So werd' ich beseligt dein Kind wieder sein.
Auch Lortzing war in sich selber, in seiner Seele durch ihren Geist der Liebe und der Mitteilung gesättigt. Wie sonst wäre er dazu gekommen, das Libretto seiner Opern gleich selber zu schreiben – wenn meistens auch nur verändernd aus bereits Vorhandenem –, wenn nicht aus seiner eigenen Fülle heraus. Aber im Irdischen war ihm eine solche Begegnung mit einem Reichen nur selten gegönnt. Er starb denn auch völlig verarmt mit nicht einmal ganzen 50 Jahren, sodass seine Lebensgeschichte ähnlich kurz ausfiel wie die eben abgeschlossene Gleichnisgeschichte, aus der wir nun die notwendigen Erkenntnisse zum Verständnis unserer Gefühle beim Hören der Musik ziehen wollen.
Wir haben im ersten Teil dieses Kapitels festgestellt, dass der Fortschritt oder das Schreiten ganz allgemein in einem sich Fallenlassen in der gewünschten Richtung beginnt und sich durch ein neues "Gleichgewicht-Schaffen" zu einem ersten Schritt vervollständigt, und uns so einen neuen Standpunkt erreichen lässt, von welchem man sich erneut (den zweiten Schritt beginnend) fallen lassen kann.
Nun haben wir aber im vorigen Beispiel gesehen, dass ein Zunehmen des Materiellen stets eine Verminderung des Geistes mit sich bringt. Also ist das Fallenlassen in Richtung Materiellem – mit andern Worten: der erste Teil des Schrittes – für den geistig Wachen schon in sich selbst eine wider den Geist streitende Handlung, also eine Dissonanz, und dieser Vorgang müsste folglich für ihn in der Musik als Sekundakkord dargestellt sein. Anderseits wäre das neue "Gleichgewicht-Herstellen" vorerst einmal eine Hemmung des Weiterschreitens (denn nach einem jeden ganzen Schritt ist das Stehen bleiben möglich). Eine Hemmung des Fortschrittes in materieller Hinsicht aber ist stets eine Fortschrittsmöglichkeit für den Geist. Also enthält auch der zweite Teil des Schrittes für den geistig Wachen einen Widerspruch in sich, und er empfindet auch ihn als Sekundakkord. Wer es so sehen kann, der macht also beim gleichen Schritt, den wir im ersten Teil des Kapitels als Sekunde erkannten, innerlich einen solchen aus zwei in sich dissonanten Schritt-Teilen (= 4 Teile, = l Quarte), und erreicht natürlich dabei auch ein doppeltes Gleichgewicht, nämlich ein materielles und ein geistiges zugleich. Dieses Gleichgewicht müssen wir wieder mit einem Sekundakkord berechnen, weil ja auch darin das Geistige stets gegen das Natürliche streitet. Also besteht seine einfache Erkenntnis nicht aus den Tönen 1+2=3, sondern aus den Tönen (l contra 2) + (3 contra 4) = (5 contra 6), oder leichter verständlich: Waren bei jedem Teile seiner Handlung stets zwei sich widerstreitende Interessen beachtet und erwahrt, so wird auch das Resultat oder der Erfolg verdoppelt gegenüber jenem, da bei derselben Handlung nur stets ein Interesse im Auge behalten wurde. Fassen wir diese beiden verschiedenen Erkenntnisarten in ihrer äussersten Begrenzung, so entspricht die einpolige (natürliche oder materielle) einfache Erkenntnis in der Musik dem Schritt "1-3", also einer Terz, und die zweipolige (das Geistige und Natürliche berücksichtigende) einfache Erkenntnis dem Schritt "1-6", also eine Sexte.
Beides sind harmonische Intervalle, welche als Akkord auf jeder beliebigen Stufe der Tonleiter beginnend, harmonisch klingen. Die zeitweilige Dissonanz der beiden Schritt-Teile (Sich-Fallen-Lassen und ein neues Gleichgewicht finden) hebt sich bei einer zweipoligen Erkenntnis einigermassen auf, weil jeder Teil in sich selber schon in zwei Teile gespalten ist, sodass wir die beiden Schritt-Teile zusammen als vierteilig, also als Quarte – auf vielen Stufen der Tonleiter beginnend – im vollen Erkenntnisklang der Sexte mit ertönen lassen können (Quart-Sext-Akkord) und dadurch einen ungemein gerundeten Klang erzielen, welcher auf keiner Stufe der Tonleiter wirklich dissonant tönt, sofern wir diesen Doppelschritt einmal von der hohen (Weisheits-) Seite und ein anderes Mal von der tiefen (Liebes-) Seite der Töne her vollziehen.

Dieser volle, reife Klang (1-4-6), der durchsichtiger und geklärter wirkt als der Dreiklang. (1-3-5), stellt also eine bloss einfache Erkenntnis dar – einfach, jedoch unter der Berücksichtigung beider Pole des Lebens – des geistigen, wie des materiellen –, während der übliche Dreiklang (1-3-5) eigentlich keine einfache, sondern bereits eine erweiterte oder zusammengesetzte Erkenntnis darstellt, jedoch nur den einen Pol – den materiellen – berücksichtigend. So schön und harmonisch dieser auch klingen mag (er klingt auf der ersten Stufe der Dur-Tonleiter noch voller, aber auch geschlossener, als der Quartsextakkord), so ist er dennoch nur auf ganz bestimmten, wenigen Stufen der Dur-Tonleiter (oder des Lebens) beginnend harmonisch. Nämlich auf der Stufe l, 4 und 5; auf allen andern aber dissonant. Das verdeutlicht aber nur wieder die Beschränktheit (deshalb der geschlossene Klang) eines bloss einseitigen Fortschrittes (in materieller Richtung), welcher nur in wenigen Lebensphasen, (oder Stufen der Tonleiter) harmonisch verlaufen kann. Diese Lebensphasen sind: l. Säuglings- und Kleinkinderalter, 2. Kindesalter, 3. Jünglings- und Ausbildungsalter, 4. Verliebt sein und Eheschliessung, 5. Erziehung der Kinder, 6. Alter und 7. Tod, gemäss den 7 Stufen der Tonleiter. Die 8. Stufe ist wieder die erste der nächsten Oktave, entspricht also dem Eintritt in die andere, die geistige Welt.
Am eindrücklichsten erscheint die Harmonie dieses natürlichen Dreiklanges auf der ersten Stufe einer Dur-Tonleiter, und das hat seinen tief geistigen Grund oder eine tiefe Entsprechung: Der Mensch, wenn er auf diese Erde kommt, ist naturmässig und erkenntnismässig völlig nackt, das heisst, er muss sich alles zum irdischen Leben Notwendige erst mühsam erarbeiten. Zuerst durch einfache Erkenntnisbegriffe wie: "Mama" und "Papa". Dieser einfache Begriff ist dann auch gleich gewertet: Mama und Papa ist verstanden als "gut". Nachher kommt der zweite Schritt-Teil der neuen Erkenntnis, dass "Mama" und "Papa" nur bedingt "gut" sind, nämlich dann, wenn sich der Säugling nach ihnen richtet – ihrem Willen entspricht. Das wäre der einfache Begriff (die Terz, denn ein Kleinkind kann nicht geistig denken, sondern eben erst materiell). Später erkennt es, dass die Gemütslage von Mama und Papa (vergleichbar der Temperatur beim Wasser (um auf ein anderes Beispiel dieses Kapitels zurückzukommen) ebenfalls richtig sein muss, und wann sie das ist - was die erweiterte Erkenntnis, also den Dreiklang (1-3-5) darstellt. Alle diese seine Erkenntnisse oder Begriffe kommen noch aus der Empfindung seiner Liebe heraus und sind nicht verstandesmässig klar erfasste Begriffe. Deshalb auch die Wärme, welche in diesen Kleinkind-Erkenntnissen noch ruhend vorhanden ist, und eben deshalb der so anheimelnde, wohlig warme Klang des entsprechenden Dreiklanges auf der l. Stufe, weil eben durch die Liebe (Gott ist Liebe) das Geistige noch mitschwingt – wenn auch nicht erkannt – und dadurch das Kind vor dem Materiell-Werden seiner Seele hütet. Bei gereinigteren Erkenntnisbegriffen der Lebensphasen 2 und 3 ist diese Liebe vom Begriff schon getrennt und ein materiell werden sicher möglich, sofern nicht bewusst auch das Geistige in die Erkenntnis und Begriffsgestaltung mit einbezogen wird. Deshalb auch die Dissonanz des Dreiklanges auf der Stufe 2 und 3, weil er durch seine Einpoligkeit dem Tod oder dem Absterben der Liebe oder des Geistes entspricht. Erst auf der 4. Stufe, beim Verliebtwerden und Ehelichen, ist wieder eine Harmonie bei nur materiellen, also einpoligen, erweiterten Erkenntnissen möglich, weil dort wieder, wie in Kindesjahren, die Liebe bei allen neuen Erkenntnissen mitschwingt. (Subdominante nennt der Musiker den Dreiklang dieser Stufe.) Und noch einmal, aber schon etwas härter, ist der Dreiklang auf der nächsten Stufe oder in der nächsten Lebensphase, der Stufe 5, möglich, weil dort die Liebe zu den Kindern zwar mitschwingt. Diese Liebe aber ist denn doch zu einem grösseren Teil bloss Eigenliebe und Selbstbestätigung, Selbstzufriedenheit und dynastisches Denken oder Empfinden, sodass dort nicht mehr an einen völlig harmonischen Dreiklang gedacht werden kann. (Dominante nennt die Harmonielehre den Dreiklang auf dieser Stufe – leider absolut richtig. Wäre doch die noch unschuldige Liebe der Kinder dominant geblieben, anstatt diese mit Selbstbewusstsein und Eigenliebe durchmengten Erkenntnisse der 5. Stufe.) Nur wer das Geistige liebt, welches dem Natürlichen widerspricht, bewahrt sich vor dieser "Natürlichkeit" des egozentrischen menschlichen Gemütes. Er geht über Quartsext-akkorde die Tonleiter hinauf, braucht aber auf den Dreiklang des Grundtones (also der I. Stufe) dennoch nicht zu verzichten, sondern kann ihn einbeziehen und behält ihn so bei, als warme, bereichernde Erinnerung an seine Kindheit, weil dieser ja von unschuldiger Kinderliebe durchtränkt ist.
Die Moll-Tonleiter beginnt auf der sechsten Stufe der ihr entsprechenden Dur-Tonleiter, also in beträchtlicher (Weisheits-) Höhe (oder Entfernung von der Liebe). Ihre Kraft ist denn auch so schwach, dass sie die Halbtonschritte vorzeitig bei den Stufen 2 – 3 und 5 – 6 (statt 3 – 4, und 7 – 8) vollzieht, was ihr selbst sowie ihren Akkorden den gedrückten, melancholischen Klang verleiht. Ihr Dreiklang hat denn auch die grosse Terz (im Gegensatz zu Dur) auf der hohen (also Weisheits-) Seite der Tonskala. Er entspricht der Stimmung eines sich konsolidierenden Menschen, der durch äussere Ereignisse (also zumeist durch Trauer) zu einer Erkenntnis gelangt ist. Er ist nicht frei, wirkt – alleine, in die Stille gegeben – äusserst dissonant und bei Wiederholung oder im Verband mit dem Dominant- und Subdominant-Dreiklang dieser Tonart gedrückt, und trotz der Dissonanz kraftlos, schwer, auch kühl. Auch dafür gibt es eine Entsprechung, die unser Fühlen und Ahnen beim Hören dieser Klänge erklären kann: Erkenntnisse, welche in ihrer ersten Entstehung mehr von der Weisheitsseite her kommen (die grosse, volle Terz oben, in der Weisheitssphäre der hohen Töne) und dann gegen die Liebe zu erweitert werden müssen, sind Menschen eigen, deren Liebe sich sehr frühe an das Äussere gehängt hat, sodass sie im Äussern erstarrte oder erlahmte. Dann drängt und bedräut das Äussere die schwach gewordene Liebe, anstatt umgekehrt, die erstarkte Liebe das Äussere gestaltet. Eine vom äussern Gesetz bedrängte Liebe aber ist unfrei und gerichtet. In ihr liegt nicht die Seligkeit der Freiheit, sondern die Disharmonie des Gerichtes!
Menschen, die ein "Benehmen" haben, also eine äussere Verhaltensform, welche sich aus den Gesetzen der Gesellschaft und ihren Gepflogenheiten ableitet und dem Individuum die innere Liebe und ihre Freiheit knechtet, kennen diesen Dreiklang in ihrem Herzen und verstehen ihn deshalb gut, wenn sie ihn hören, obwohl sie ihn nicht unbedingt lieben. Während andere, die sich und den Erkenntnissen aus ihrer tätigen Liebe treu geblieben sind, sich und ihrer Liebe nichts benehmen und den vollen und freien, harmonischen Dreiklang der Dur-Tonart, also mit der Begriffsentwicklung von der Liebe her (grosse Terz im untern Tonbereich) sich bewahrt haben.
Die Weisheit ist stets das Licht aus der Liebe, also ein Zweites aus einem Ersten, und ein Äusseres, aus dem Inwendigen hervorgehend; darum der Weg von der Weisheit zur Liebe stets beengend ist, im Gegensatz zum Weg aus der Liebe in die Weisheit.
Aus äusserer Gewohnheit an Moll oder aus innerer Gewohnheit des "sich Benehmens" kann also eine Beziehung zu Moll entstehen, welche dann diese Tonwesenheit als schön oder harmonisch – eben der eigenen Natur entsprechend – empfinden lässt. Ebenfalls ist diese Erscheinung bei sinnenfreudigen Menschen möglich, weil Menschen, welche sehr sinnenfreudig sind, auch gar oft und schmerzlich empfinden, dass sie einmal – bei ihrem Tode – alle diese sinnlichen Genüsse entbehren müssen, dass sie ihnen "benommen" werden. Geistige Genugtuung und Freude kennen sie aber zu wenig oder gar nicht, und so kommen sie dann zu jener innern Beziehung zur Musik, welche Moll als schön empfinden lässt, wie das etwa bei einigen östlichen Völkern der Fall ist.
Soviel über das Wesen des Dreiklanges von Dur und Moll auf den verschiedenen Lebensstufen, im Gegensatz zum Quartsextakkord, der auf allen Stufen harmonisch klingt. Wir wissen von vorher aber, dass schon die einfache, aber zweipolige Erkenntnis von derselben Kraft, wie zwar eine erweiterte, aber trotzdem nur einpolige Erkenntnis ist, weil sie durch die jedem Schritt-Teil innewohnende Dissonanz die Dissonanz des ganzen Schrittes derart aufhebt, dass zur Gesamterkenntnisgrenze (1–6) hinzu auch die Schrittgrenze (1–4) mit erklingen darf, (also; 1–4–6). Sie ist der einpolig erweiterten Erkenntnis (dem Dreiklang) überlegen, weil sie nie – auf keiner Stufe der Tonleiter oder des Lebens – schwere Dissonanzen aufweist.
Wenn nun dieser doppelpoligen einfachen Erkenntnis eine Erweiterung folgt, so wird auch diese eine doppel- oder zweipolige sein, und muss deshalb auch wieder als Sekunde dargestellt sein, wird aber dann ebenfalls wieder eine doppelpolige erweiterte Erkenntnis zur Folge haben, sodass also die einfache, doppelpolige Erkenntnis (1–6) durch den Schritt "7–8" zu einer erweiterten Erkenntnis "9–l0" führt, welche, in ihrer äussersten Grenze dargestellt, ("l–l0") als Dezime zu spielen und zu hören sein wird. Diese Dezime ist – wenn vielleicht auch selten verwendet – ein überaus wohlklingender Akkord, besonders in den mittleren bis unteren Tonleiterabschnitten (Oktaven), dessen Reinheit und warme Brillanz ebenso stark beeindruckt, wie die absolute Durchsichtigkeit (einem klaren Sternenhimmel gleich). Er ist das Gegenstück zur erweiterten, aber bloss einpoligen (natürlichen) Erkenntnis (der Quinte), ist aber als ein im Geistigen wie im Natürlichen verwurzeltes und begründetes Produkt auf allen Stufen der Tonleiter äusserst harmonisch – im Gegensatz zur Quinte, welche nur auf wenigen Stufen, der Tonleiter harmonisch klingt. Der (gewisserart) "Dreiklang" dieser doppelpoligen, erweiterten Erkenntnis ist "l–6–l0", wenn sie von der Liebe her zur Weisheit dringt, oder 1–5–10, wenn sie von der Weisheitshöhe wieder zur tiefen Liebe drängt. Also stets ein Sext-Dezime-Akkord, mit der Sexte einmal beginnend oder dann endend, der ebenfalls auf allen Stufen der Tonleiter harmonisch klingt, und auf keiner dissonant. Er ist dem Quartsextakkord klanglich nahe verwandt.
Quartsextakkord

Sextdezimakkord

Dem Musiktheoretiker fällt natürlich bei der Betrachtung dieser Akkorde sofort auf, dass sie – mit einer Ausnahme – alle aus Umkehrungen des ursprünglichen Dur-Dreiklanges auf den drei Stufen: l (Tonika), 4 (Subdominante) und 5 (Dominante) bestehen. Sobald aber diese Erkenntnis ins Bewusstsein gelangt, ist man versucht, den Dreiklang denn doch über die Quartsextakkorde und die Sextdezimakkorde zu stellen, oder diese aus dem Dreiklang sich entwickeln zu sehen. Das ist aber aus verschiedenen Gründen eine nicht ganz richtige Vorgehensweise.
Denn es besteht ja beispielsweise auch der Mensch in all seinen Lebensaltern ebenfalls aus dem Dreiklang zwischen Leib, Seele und Geist, und es geht der Erwachsene aus einem Kinde hervor. Und dennoch liesse sich nicht mit Berechtigung sagen, dass der Erwachsene nichts anderes als ein altes Kind sei, oder dass er seine Dreiheit oder Dreieinigkeit von Leib, Seele und Geist aus seiner Jugend erhalten habe. Sowohl die Reihenfolge der Wichtigkeit der drei "Klänge" Leib, Seele und Geist, als auch die Abstände, welche sie zu einander haben, sind in den verschiedenen Lebensstadien ebenso verschieden wie sie in der Musik zwischen den Klängen des echten Dreiklanges, des Quartsext- und des Sextdezimakkordes sind, sodass, obwohl jedes dasselbe enthaltend – und sogar eines aus dem andern hervorgegangen –, der Erwachsene ganz und gar ein anderer ist, als das frühere Kind – was das Leben dem aufmerksamen Beobachter tausendfältig zu belegen imstande ist. Darüber hinaus lässt sich zum Wesen eines Erwachsenen auch ein Weg finden, ohne dass wir ihn darum in seiner Jugend gekannt haben müssen, was doch die überwiegende Mehrzahl jener Ehepaare belegt, welche sich erst im Erwachsenenalter kennen gelernt haben. Ebenso lassen sich auch die Quartsext- und Sextdezimakkorde alleine aus dem Empfinden heraus genauso gut finden, wie aus den ohne weiteren Empfindungen, rein intellektuell überlegten Umkehrungen oder Abwandlungen der ursprünglichen Dreiklänge. Wichtiger ist bei dieser Erkenntnis also eher die Erklärung, wie dennoch nur die dem menschlichen Wesen konforme Entsprechung der Töne der Grund zur Harmonieempfindung sein kann, weil erst in ihr die lebendige und auch belebende Wirkung der Musik auf das menschliche Gemüt begründet ist. Daraus erlangt die Frage eine gewisse Wichtigkeit, ob und wie denn überhaupt auf der Kleinkinderstufe eine doppelpolige Erkenntnis, oder gar eine erweiterte zweipolige Erkenntnis möglich sei.
Nur der genau erkannte Sachverhalt in den menschlichen Beziehungen und Belangen kann uns dabei die Richtung weisen. Dasjenige, was eine Mutter denkt, fühlt und – innerlich oder äusserlich – erlebt, gibt sie mit der Milch ihrer Brust ihrem Kinde – wenn auch nicht sofort erkennbar – weiter. Der Mediziner aber kennt die Fälle, wo nach Schreck oder grosser, seelischer Belastung der Mutter der Säugling nicht mehr recht gedeihen will und seine Verdauung in eine oft fast lebensbedrohende Unordnung kommt. Also muss er (der Säugling) doch die innern, geistigen und seelischen Umstände ebenso oder noch exemplarischer in sich aufnehmen, als die ersichtlichen äussern, natürlichen Ereignisse und Abläufe, wenn auch vorerst noch ebenso dumpf, dunkel und seinem noch schlafenden Intellekt verhüllt. Das Gewicht aber verspürt er von beiden Polen, und die ahnungsweise Gemütserkenntnis oder -empfindung entwickelt sich – gerade in dieser Phase (der ersten Lebensstufe also) – markanter, als das intellektuelle Erkennen. Aber auch später, wenn das Kleinkind, welches überall und immer wieder den Schutz der für sein Gefühl starken Eltern sucht, kann es ganz gut zu zweipoligen Erkenntnissen gelangen. Erst wenn der Intellekt einmal die vorherrschende Kraft im Kinde geworden ist, wird es einpolig zu denken und zu schliessen anfangen. Das ist gottlob zumeist erst nach dem 3. bis 5. Lebensjahre der Fall und war früher erst etwa mit dem 7. Lebensjahre möglich. Je mehr die der Liebe verwandten Gemütskräfte eines Kindes nämlich gefördert, entwickelt und behütet werden – anstatt der oft allzu früh geweckte Intellekt –, desto stärker auch wird seine Seele durch die Kraft ihrer früh entwickelten Liebe – und spätere Gemütskrankheiten bleiben dabei aus!
Ein Kind, welches an seinen Eltern, als seinen ersten Beispielen, erfährt, dass diese bei Auftreten irgendeines Leibesübels – entweder beim Kinde oder bei den Eltern selbst – sich vermehrt ruhig verhalten und nur innerlich vollauf tätig werden, alles Äussere meidend und fahren lassend, wird dadurch zweifelsohne einen der grössten, bleibenden Eindrücke erhalten, demzufolge es innerhalb des Menschen mehr, Grösseres und Stärkeres vermutet, als es im bloss äusserlichen Ablauf der Dinge für möglich hält. Kinder eines solchen, in der heutigen Zeit äusserst seltenen Elternpaares wissen und spüren schon in ihrer zartesten Kindheit, dass Schutz und Schirm nicht in den Eltern liegt, sondern offenbar dort, wo sich diese hinwenden, wenn sie selber nicht mehr weiter wissen. Diese haben dann jenen lebendigen Glauben, den man nicht einfach annehmen kann, sondern durch sein Handeln erwerben muss, und damit ein Gut für sich, das später so mancher vergeblich mit seinem Verstande sucht. Also ist fast nirgendwo die doppelpolige Erkenntnis stärker und reiner, als auf der ersten Lebensstufe, obwohl wir früher in diesem Kapitel feststellten, dass Kinder nicht zweipolig denken können. Empfinden können sie aber zweipolig, und meistens besser und intensiver als Erwachsene, weil sie ihr Intellekt dabei noch nicht hemmt. Eine Empfindung ist aber nicht nur auch eine Erkenntnis, sondern vor allem eine Erkenntnis, ein Innewerden und Wahrnehmen. Und wäre es nicht so, weshalb denn sonst würden gebrannte Kinder das Feuer scheuen? Und weshalb ist der Eindruck der Musik stärker, spontaner und entschiedener als die Seiten dieses Buches? Nur deshalb, weil die Musik empfunden wird. Die Worte dieses Buches hingegen müssen vorerst in den Intellekt aufgenommen werden, aus dessen bei der Aufnahme mühsam erworbenen Bildern die empfindende Seele erst bewegt werden kann, sich in ihnen zurecht zu finden – es sei denn, die Worte würden sich sofort mit der schon früher gehabten Empfindung der Musik decken, dann würde es bei der Aufnahme in den Intellekt durch die Reaktivierung der frühern Empfindung spontan zu einer erneuten Empfindung kommen, die aber im Lichte der Erklärungen ein bewussteres Erkennen der Zusammenhänge gestatten würde. Und das kann dann zum Ausgangspunkt selbsttätigen weiteren Suchens werden, das die Seele ungemein beleben kann, sofern sie sich dabei nicht allzu sehr von äussern Vorkommnissen abhalten lässt.
Das bisher über die zweipolige Erkenntnisfähigkeit der 1. Lebensstufe Gesagte zeigt deutlich, wie wichtig und wie stärkend, rundend und vervollkommnend überhaupt der innere, zweite – aber im ureigentlichsten Sinne erste – Pol wirkt.
Wenn wir nun aufmerksam über die angeführten Sextdezimakkorde die Tonleiter hinaufklettern (also uns vorspielen oder vorspielen lassen), so empfinden wir zweifelsohne den weichen, abgeklärten und gerundet vollen Klang dieser "Dreiklänge", sowie das verwandte Verhältnis der verschiedenen Akkorde untereinander – gewisserart selbst nach einander verlangend. Spielen wir dann zum Unterschied mit den normalen Dreiklängen (1–3–5) die Tonleiter hinauf – wie grausam hart fallen da die bloss einpoligen Erkenntnisse der verschiedenen Lebensstufen aufeinander! Spielen wir aus diesem Grunde aber etwa nur die Dur-Dreiklänge, so sind diese wohl schön zu hören, aber erstens ist es nur ein ganz kurzes Vergnügen, weil auf ganze drei Stufen beschränkt – und wo bleibt da zweitens der Reichtum an Empfindungen gegenüber den "Dreiklängen" der Sextdezimenakkorde aller acht Stufen?
Aber auch umgekehrt ist die Erfahrung eine gleiche oder gar noch viel frappantere. Wechseln wir nämlich bei den Sextdezimakkorden (aber auch bei den Quartsextakkorden) den grösseren Intervall (die mittlere Note) auf die jeweils andere Seite, so erhalten wir die Umkehrungen der Molldreiklänge der Stufen l, 4 und 5. Steigen wir nun über diese die Tonleiter hinauf, so empfinden wir ebenfalls eine tiefe Ausgeglichenheit, einen angenehmen, abwechslungsreichen Gleichmut und eine ausgesprochene Versöhnlichkeit unter den einzelnen Stufen, die sich ebenfalls gegenseitig beinahe verlangen. Wie viel näher liegt sich hier doch Moll und Dur! Wie abgeklärt und wohlwollend verhalten sich doch diese erweiterten, doppelpoligen Erkenntnisse untereinander – wie himmlisch reich und ausgeglichen. Wie geradezu niederschmetternd ist nachher – im Gegensatz dazu – der ursprüngliche Molldreiklang zu empfinden.
Setzen wir beispielsweise auf der 6. Stufe unter die abgebildeten Sextdezimakkorde den verkehrten, der Moll-Gruppe angehörenden Akkord, und spielen die Tonleiter aufwärts, so merken wir kaum, dass ein "falscher" Akkord sich eingeschlichen hat – ja, die ganze Tonleiter ist genau ebenso schön zu erklimmen, wie über ausschliessliche Dur-Akkorde. Das alles gibt uns nur die Ganzheit der doppelpoligen Erkenntnis! Sie lässt uns alles erfassen und in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander bringen – sie schliesst nichts aus!
In einem Sextdezimakkord findet also so viel Platz, dass wir sogar zwei gegensätzliche Tonarten wie Moll und Dur darin vereinen könnten. Dass es musikalisch der Fall ist, können wir beim Hören ohne weiteres feststellen, wie wir gerade vorhin festgehalten haben. Dass es bei geistiger Betrachtungsweise aber auch im Leben entsprechende Beispiele geben kann, soll sich an der im Kapitel "Tonintensität" begonnenen gleichnishaften Geschichte in ihrer Fortsetzung zeigen. Da war von einem Dienstmädchen die Rede, das mit seiner Anteil nehmenden Art auf das Gemüt ihres Zöglings erweckend und belebend eingewirkt hatte. Dieser fand dabei in seinem Innern wohl erstmals ein Leben und Erleben, das er dann allerdings – weil von aussen her auf ihn einwirkend – nur allzu schnell und allzu leicht in ein bloss natürlich sinnliches Fühlen und Erleben wandelte und dadurch dann wohl in der klagenden Moll-Tonart über weite Teile seines ferneren Lebensweges zu gehen hatte.
Es kann aber neben diesem einen, direkt Betroffenen, wohl ohne weiteres auch einen zweiten, nur indirekt Anteil Nehmenden geben, der durch eigenes Erkennen aus seiner Ahnung heraus geweckt wurde und dabei nur innerlich die Möglichkeit fand, an dem ihm von aussen Begegnenden Anteil zu nehmen. Seinem Erleben fehlte dann der direkte, einpolige Dreiklang 1 - 3 – 5 des äussern Erlebens. Dafür könnte sich aber in seinem spätern Leben sehr wohl auch noch eine natürliche Erfüllung ergeben, wie wir in der Weiterführung dieses Beispieles noch sehen werden. Dann wäre sein Erleben, das von Anfang an ein Innerliches war und erst mit der Zeit dann auch zu einem äusseren gelangte, von Anfang an mit einem doppelpoligen Dreiklang wiederzugeben, während das Erleben des vom Dienstmädchen Erzogenen höchstens am Ende seiner Äusserlichkeit endlich auch zu einem innerlichen werden kann. Erst dann wäre dieses mit einem doppelpoligen Dreiklang wiederzugeben. Verfolgen wir nun aber einmal die Möglichkeit eines zweiten von diesen Geschehnissen Betroffenen:
Er wohnte ganz in der Nähe jener Familie, welche das Dienstmädchen angestellt hatte, und wuchs mit seiner Schwester zusammen in der Obhut strenger Eltern auf, jedenfalls was die äussern Belange betraf. Da sie wenig gemüthaft waren, kam dem etwa zwölfjährigen Knaben ihre Strenge wie eine Sterilität des Geistes vor. Denn sie liess beiden Kindern wenig Raum zur Entfaltung. Sie mussten immer stille sein, man durfte von ihnen nichts vernehmen. Seine Schwester verlor sich darum im Verschlingen von Büchern aus der Schulbibliothek. Der Knabe jedoch konnte das weniger, da ihm der Inhalt der meisten Bücher so leer vorkam wie sein eintöniges Leben. Denn die in solchen Büchern beschriebenen Streiche und Erlebnisse kamen ihm ebenso sinnlos und gemütleer vor wie sein bisheriges Leben, oder dann strotzten sie von einer Moral und Tugend, die er ebenso stereotyp und lebensfremd fand wie der Blödsinn, der in den Streichen lag. Er dachte viel und litt unter der Lieblosigkeit und Teilnahmslosigkeit der ganzen ihm bis dahin bekannten Menschheit.
Da gewahrte er einmal auf seinem Schulweg das in der frühern Geschichte dargestellte Kindermädchen mit seinem Schützling. Auf den ersten Blick empfand er, dass er nun einmal einem wirklich lebendigen Menschen begegnet sei, dessen Sinn für das Gute und Nützliche ebenso ausgeprägt war wie seine weiche, aufnehmende Wesensart. Völlig selbstvergessen staunte er das Mädchen an, sodass es nicht verwunderlich war, dass auch das Dienstmädchen auf ihn aufmerksam geworden war. Mit einem freundlichen Blick schien es sich in seine Lage zu vertiefen – ja, schien ihm sogar Mut und Zuversicht zuzusprechen. Das alles war nur ein kurzer Augenblick, von dessen Länge sich der Knabe später keine Rechenschaft mehr zu geben vermochte. Aber in ihm war ein Feuer erwacht, das er bisher nicht in dem Masse gekannt hatte, weil ihm der Glaube an die Möglichkeit eines solchen Geschehnisses infolge seiner bisherigen Erfahrung einfach mangelte. Wohl schwebte ihm ein solches Leben in seinem Gemüte schon lange als ein ahnungsvolles Bild vor, aber er wusste aus seinem bisherigen Leben, dass es ein solches in der Realität des irdischen Lebens wohl nie geben würde. Zu lange und zu intensiv hatte er sich im Druck seines grossen, ja grössten Wunsches vergeblich danach gesehnt.
Da er schüchtern war, war ihm klar, dass er wohl nie in die Nähe dieses Mädchens kommen würde und es folglich nie zu einem direkten Kontakt kommen könne. Aber all seine Zeit – von der er viel hatte – verbrachte er in der innern Anschauung des Wesens dieses Mädchens. Er sah es auch noch mehrere Male, wenn auch nur in grossen Abständen. Immer deutlicher empfand er dabei, dass ihn das Mädchen in sein Gemüt aufgenommen habe und immer heftiger wollte er es erfahren lassen, wie dankbar er über die Erfahrung seines liebevollen Wesens sei, damit es eine Genugtuung für all seine Mühe haben würde, die es mit seinem Schützlinge hatte; denn er merkte leicht, wie schwierig seine Aufgabe war. Bei all seinen vielen Gedanken und Erwägungen über das innere Wesen des Mädchens und seinen Vorstellungen, wie es ihm in seiner Nähe wohl ergehen würde, begann er zu spüren, dass er selber auch noch manche Ecken habe, die dem Mädchen in seiner Nähe wohl wehe tun könnten. Gewiss wären sie sich beide über Sinn und Ziel des Lebens bald einmal einig – dessen war er gewiss! Aber seine eigene, manchmal heftige und aufbrausende Art, seine Ungeduld in manchen Dingen könnte es verletzen – so empfand er. Seine offene, direkte Art müsste es jedoch erfreuen, dachte er, und dennoch sah er auch, dass eine in allem offene und direkte Art auch schockieren könnte – wenigstens jene, die keine Ahnung vom Wesen ihres Nächsten haben. Das wiederum konnte seiner Meinung nach bei diesem für ihn über alles liebevollen Mädchen ja allerdings nicht der Fall sein.
Kurz: es war ein Glühen und Bewegen in seinem Innern, und er begann sich dabei selber stets strenger in allen seinen Gedanken und Handlungen zu kontrollieren, ob er nicht mit irgendwelchen das Mädchen enttäuschen oder traurig machen könnte, wenn er das Glück hätte, mit ihm zusammen leben zu können. So lieb gewann er es in sich, dass er sein ganzes ferneres Leben so einrichten wollte, dass es ein Dank und eine Belohnung für dieses Mädchen gewesen wäre, trotzdem er es einsah, dass es wohl nie zu einer Verbindung zwischen ihnen kommen würde. Das Mädchen war ja gut 5 bis 7 Jahre älter als er. Aber sollte er je wieder ein so liebevolles Geschöpf finden, so wollte er unbedingt nicht mit leeren Wesenshänden seiner seelischen Kraft dastehen.
Weil er sehr viel Ernst hatte, änderte er sein Wesen im Lauf der Zeit vollkommen, obwohl das Mädchen nach dreiviertel Jahren nicht mehr bei jener Familie diente und er es darum auch nicht wieder sah.
Hätte es in jener für sein ganzes Leben ungeheuer wichtigen Zeit einen materiellen Fortschritt gegeben – eine natürliche Zusammenkunft der beiden –, so wäre sein Ernst wohl nicht so stark mit seiner Liebe verbunden geblieben, denn er hätte bestimmt auch die Fehler des Mädchens erkennen müssen und hätte dann als Folge vielleicht nicht mehr ein Maximum als Lohn und Dank für sein sonst liebevolles Wesen bereithalten können und wollen. Also hätte ein solcher Fortschritt im Natürlichen eine Abschwächung seines innern Feuers zur Folge gehabt und wäre damit zu einem Rückschritt in seinem in Entwicklung gekommenen innern Wesen geworden. So hingegen war er in sich selber – in der Erfahrung seines Wesens und der Wirkung desselben auf andere – weit über den allgemein üblichen Stand hinausgewachsen, sodass er in seiner gestärkten Liebe bald einmal auch Gott, als seinen Schöpfer und Vater, einzubeziehen begann, als er von einem Onkel erfahren hatte, dass und wie Gott auch heute noch jenen Menschen zugänglich ist, die ihr ganzes Leben mit ihm teilen möchten.
Wohl fand er nie eine solche Frau, die dem in seiner Vorstellung entwickelten Wesen jenes Mädchens glich. Aber er fand eine, die er mit viel Liebe, Geduld und Zeit und mancher vorläufigen Enttäuschung dennoch, mitsamt seinen Kindern, in die Nähe jener Harmonie bringen konnte, von der er annahm, dass sie im Himmel vorhanden sein müsse.
Hätte er in seiner Jugend mehr Freiheit gehabt, sich ins Natürliche hinaus zu entwickeln, niemals hätte er all seine Kraft derart auf die Vervollkommnung seines Wesens konzentrieren können, dass er sich so stark hätte wandeln können, dass mit der Zeit fast alle andern seine Nähe als wohltuend erwärmend und kräftigend empfanden. Hätte sich sein inneres Liebefeuer nicht derart entwickelt, nie hätte er den für fast alle Menschen so gar nicht erreichbaren Gott so stark mit seiner Liebe umfangen können, dass er am Ende nur ihm zuliebe sein Wesen so weiter vervollkommnet hatte, um nur seiner (des Schöpfers) Idee und Liebevorstellung von seinen Menschen besser entsprechen zu können, sodass er ihm damit eine Freude bereiten könne.
Die meisten Menschen sind der Ansicht, dass man nicht wissen könne, ob und wie es drüben (nach dem Tode) ein Leben gebe. Wer jedoch in sich ein inneres Leben und Erleben, ein Sich-Erkennen und Sich-Verbessern so weit entwickelt hat, dass die natürlichen Begebenheiten des äussern Lebens erst folgen müssen, der beginnt zu fühlen dass nur das – und nichts anderes – sein Leben ist, und dass dieses intensive innere Leben keines materiellen Leibes bedarf, um weiter existieren zu können, es aber wohl noch zur Erprobung dienen kann, ob es nicht doch manchmal immer noch stärker ist als sein noch so eifriger Wille.
Aus diesem Grunde auch bedingt ein geistiger Fortschritt immer ein Nachgeben im Natürlichen. Nicht, dass das Natürliche darunter etwa leiden sollte, aber dass es für den im Geiste Fortschreitenden stets weniger Gewicht hat, sodass er es am Ende selber in der Weise zu meiden beginnt, dass einmal, bei seinem Übertritt, nicht der Würgegriff des zerstörten Natürlichen (des kranken Leibes) ihn förmlich hinüberdrängt, sondern dass er es irgendwann in seiner völligen Gleichgültigkeit ihm gegenüber einfach fallen lässt. Das geschieht allerdings nur denen, die mit ihrer vollen und ungeteilten Liebekraft sich so sehr an diese innere Reifung geklammert haben, dass sie nebenher das Äussere, Natürliche einmal fallen lassen müssen.
Wir können uns – als Gegensatz dazu – die unzähligen Leiden des einstigen Zöglings dieses Dienstmädchens vergegenwärtigen, die im Kapitel über die Tonintensität angedeutet sind, um voll erfassen zu können, was einer verliert, der im Natürlichen zu weit und zu vorschnell weiter schreitet. Wenn wir das alles miteinander und gegeneinander abwägen, so sehen wir das Leben viel umfassender und alles einbeziehend, sodass wir manches Leid nicht mehr als schwere Last empfinden, sondern als ganz natürliche und zum fernern gediegeneren Leben auch absolut notwendige Folge eigenen Fortschreitens. Dabei erst wird unser Gemüt mit jener Ruhe und stillen genugtuenden Freude erfüllt, die wir in einem Sextdezimakkord nur ahnungsweise – als tief gefühlte Entsprechung tatsächlichen Lebens – so wohltuend nachempfinden können.
Wir wollen uns nun in Erinnerung rufen, dass von den einpoligen Erkenntnissen nur gerade die Terz auf jeder Stufe der Tonleiter harmonisch klingt; von den doppelpoligen Erkenntnissen aber sowohl die einfache, wie die erweiterte, also die Sexte und die Dezime. Ausser der Oktave – also dem Intervall der ganzen Tonleiter – gibt es keine Akkorde mehr, welche auf allen Stufen harmonisch klingen, sondern auf einzelnen Stufen äusserst dissonant, wie die Quarte, die Quinte, Septime, None, Undezime, Duodezime etc. Obwohl sich die Harmonielehre vor allem am Dreiklang orientiert, ist dieser, weil nur einer einpoligen Erkenntnis entsprechend, – wenn auch oft noch so schön – beschränkt. Er gleicht in der Dur-Tonart in seiner anheimelnden Geschlossenheit und Einheitlichkeit seiner Harmonie den Bildern Ludwig Richters, welche stets mit einer meisterhaften Prägnanz das Natürliche (Leben) anheimelnd darstellen. In sie ragt zwar wohl fast immer deutlich das geistige Leben herein (nur Richter konnte die Tugend malen und zeichnen); da sich diese Tugend aber in diesen Bildern auf das bloss Natürliche beschränkt, wirkt dann das Geistige, welches das Natürliche aufzulösen und in sich aufzunehmen bestimmt ist, fast immer schwer, wird darum als Leid oder als Bürde empfunden, ähnlich dem Wissen, dass der Dreiklang nur an wenig Orten Platz hat. Einer zum vornherein natürlichen und geistigen Betrachtungsweise oder Erkenntnisfortschrittsreihe fehlt zwar das ausgeprägt gediegene, aber anderseits auch das drückend "bürdevolle" Moment, hingegen nicht die munter frische, ebenfalls anheimelnde Wärme. Die leuchtende Durchsichtigkeit eines solchen Begriffes lässt dabei erst noch Raum für die lebensnotwendige Hoffnung und die Entfaltung des Geistes, so wie wir es im eben abgeschlossenen Beispiel erlebt haben und wie sie beispielsweise vielen Bildern Robert Zünds eigen ist, und vor allem dem Quartsextakkord und noch mehr dem Sextdezimakkord. Diese "Dreiklänge" sind darum an keinen Platz mehr gebunden – im Gegensatz zum echten Dreiklang –, und deshalb so frei zu empfinden.
Nun aber noch ein kleiner Nachtrag zum ersten Erklärungsbeispiel im ersten Teil dieses Kapitels, welches vom Geben und Nehmen handelt, um zu verdeutlichen, dass dieser doppelpolige Schritt, welcher im Leben wie in der Musik zu grösserer Harmoniebereitschaft und Harmoniefähigkeit führt, überall möglich ist (also auch beim Geben und Nehmen) und deshalb auch der Harmonie-Entsprechung der Töne zugrunde gelegt werden kann und darf, oder eigentlich muss:
Wenn eine Gabe sinnvoll sein soll, so muss sie dem Bedürfnis des Empfängers voll entsprechen. Damit sie das aber kann, muss der Geber zuvor Anteil nehmen am Geschicke des künftigen Empfängers seiner Gabe. Anteil nehmen aber ist für den Liebenden und für den Weisen zugleich ein wahrhaftes Nehmen. Denn der Liebende muss seinen Nächsten voll und ganz in seine Liebe aufnehmen, damit er ihn richtig erkennt und ihm stets in himmlischer Weise korrekt, das heisst seiner Fassungskraft entsprechend begegnet, um ihn nicht durch Überforderung seines Fassungsvermögens zu schwächen oder gar zu verletzen (d.h. ärgern). Diese Anteilnahme ist aber ein wirkliches Nehmen, was der Anteilnehmende wohl bald einmal merken wird, wenn er in seinen Gefühlen stets reicher und differenzierter wird, und seine Wahrnehmungsgabe und seine Erkenntnisse stets zunehmen, sodass er förmlich im Reichtum seiner Gefühle und Erkenntnisse, also der tiefen Liebewärme und dem hohen Weisheitslicht, schwelgen kann. Natürlich nimmt er dadurch auch die Not seines Nächsten in sich auf, welche ihn zu drücken vermag, aber dafür erleidet er selber keine oder nur wenig direkte Not, und die bloss aufgenommene oder durch seine Anteilnahme angenommene Not der andern wird er leicht durch eine Gabe aus seinem Reichtume los werden. Also kann nur der innerlich Reiche, der schon viel (Anteil) genommen hatte, wirklich geben. Darum müssen wir in der Musik, bei geistiger und natürlicher Betrachtungsweise zugleich, bereits den ersten Teil des Paares "Geben und Nehmen" als eine sich widersprechende Sekunde darstellen. So sieht also genau besehen die Situation des Gebenden aus. Und nun wollen wir uns zum Empfangenden wenden, und sehen, was in ihm vorgeht:
Um etwas wirklich empfangen zu können, das heisst so zu empfangen, dass es einem mit Dankbarkeit bereichert, muss man vor allem der Wahrheit in sich Platz verschaffen, Raum geben. Diese Feststellung mag zwar spitzfindig tönen, ist es aber in gar keiner Art und Weise, wenn wir die Verhältnisse auf dieser Erde genauer betrachten! Wie viele Stolze oder auch nur Selbstbewusste gibt es doch auf dieser Erde, die nicht einmal in grosser materieller Not sich bereit finden können, etwas anzunehmen, eben, weil sie nicht zugeben können, dass sie bedürftig, und damit schlechter gestellt als die Geber sind. Wenn das aber schon bei schreiender materieller Not der Fall ist, welche dem nur naturmässig denkenden Menschen viel auffälliger erscheint, um wie viel mehr dann bei geistiger und seelischer Armut? Wie schwer fällt es uns doch, einen Fehler zugeben zu können. Ja, – so ergibt sich die Frage – können denn solche eine geistige Gabe – das Verzeihen und Vergeben – überhaupt annehmen? Kann ein selbstbewusster Mensch seinem Nächsten in sich selber soviel Raum geben, dass er ihn und seine Wahrheit, sein Entgegenkommen wirklich und mit grosser ihn ergreifender Dankbarkeit aufnehmen kann? Kann jemand, sich selbst vergessend, der Wahrheit alleine so viel Raum geben, dass er sie immer und jederzeit gerne annehmen kann, wo auch immer sie ihm begegnet, und durch wen auch immer? Wenn er das kann, so ist er geistig ein Reicher und kann wahrhaft derart zu schwelgen beginnen, dass er selber zum unbekümmerten Geber wird!
Wie viele sind das wohl auf l000 Menschen?! Es muss der wahrhaft Nehmende auch bereit sein, dem Nächsten Gelegenheit zu geben, ihm wohl zu tun, ungeachtet der Frage, wie er dann vor dem Nächsten (vielleicht als Bedürftiger) "dastehe". Und nur, wer so viel geben kann – der Wahrheit jeden erdenklichen Raum, und der Liebe seines Nächsten den ihr gebührenden Platz in seinem Herzen –, der kann auch wirklich nehmen – annehmen. Alle andern können das nicht, weshalb zum Beispiel die Wahrheit – das heisst die volle, also mit der Liebe gepaarte Wahrheit, welche alleine das richtige Verständnis bringt – so unaussprechlich selten ist auf Erden. Denn jeder, der sie annehmen könnte, glaubt, etwas von seinem Prestige verlieren zu müssen, und findet deshalb nie Gelegenheit, sie anzunehmen. Er wollte eigentlich schon, denn er erkennt den unberechenbaren Vorteil der Wahrheit auch, der in der grossen Ruhe und im innern Frieden, aber auch in der Macht besteht, die in ihr liegt, aber er kann eben doch nicht!! Dissonanter lässt sich also der zweite Teil des Paares "Geben und Nehmen" nicht schildern. Und wir erkennen daraus deutlich, dass in der Musik auch dieser Teil – bei geistiger und natürlicher Betrachtung zugleich – als dissonante Sekunde, ausgedrückt werden muss, sodass Geben und Nehmen zusammen als eine Quarte (= 2 x 1 Sekunde) dargestellt werden muss, welche in die neue, ebenfalls geistige und natürliche, d.h. doppelpolige Lebenssituation mündet, in welcher der materielle Geber die Liebe seines Empfängers erhält, und der Geber seiner Liebe die materielle Gabe. Und diese Situation ergibt also mit den beiden dazu notwendig gewesenen Schritt-Teilen zusammen eine Sexte.
Bei oberflächlicher Betrachtungsweise liesse sich nun vielleicht daraus schliessen, dass die geistige Forderung, also die Forderung der Liebe, beim Geber und Nehmer zugleich dieselbe ist. Es müssten also beide entweder dem Nächsten Raum geben oder den Nächsten in sich aufnehmen.
Dem ist aber keineswegs so, sondern da verhält es sich folgendermassen: Wessen Liebe wächst, dessen Raum nimmt auch zu, und er wird das Bedürfnis in sich empfinden, diesen zu füllen – wie der leere Magen das Bedürfnis nach Sättigung kennt. Er wird also alles das in seine Liebe aufnehmen, was sie braucht. Vorab wohl die Wahrheit, welche in Gott ruht, aber durch seinen Nächsten ihm erfahrbar wird, und wird dadurch reich und gesättigt, also bereit zum Geben werden. Wessen Liebe aber nicht wächst, der hat das Bedürfnis nach ihrer Sättigung auch nicht. Er gleicht einem fastenden Menschen, welcher das Bedürfnis nach Sättigung, seinen Hunger, zwar oftmals schon nach wenigen Tagen verliert, aber später, nach Abbruch seines Fastens, die grösste Mühe hat, der zu sich genommenen Nahrung wieder den nötigen Raum und die nötige Verdauungswärme zu geben. Ein solcher Mensch muss ja notwendig – zumindest geistig – immer ärmer werden, und wenn er sich dann endlich in seiner Not dennoch zur Annahme einer Gabe entschliesst, so hat er die allergrösste Not, der Gabe den nötigen Raum zu gewähren, oder eben zu geben (= die Wahrheit der Notwendigkeit einzugestehen); während die Liebe des Ersteren dieselbe Notwendigkeit als Wahrheit fühlt, und gerne annimmt, wessen sie so sehr bedürftig ist. Darum auch wird der Zweite über die Gabe selber nicht dankbar sein, sondern diese stets in sich aufstossen spüren, als ein seinem Wesen Fremdes; und dergestalt ist er dann eher geplagt, als bereichert.
Auf diese Art wird ein und dieselbe von der Liebe und der Weisheit geforderte Tätigkeit einmal zum Bedürfnis (Nehmen), und einmal zur Pflicht (Geben-Müssen) – je nach der geistigen Haltung des Handelnden. So, wie die Gesetze des Himmels einmal Bedürfnis der Seligen sind, und das andere Mal die als verdammend gefühlte Pflicht (weil gegen ihre Eigenliebe streitend) der Unseligen. Denn als Herrscher muss der Unselige seinem Nächsten doch noch so viel geben, dass er immerhin bestehen kann, weil er ohne ihn über nichts zu herrschen hätte.
Herbst 82 und 7.9.89
nach oben
DIE MUSIKINSTRUMENTE  Ein und derselbe Ton, auf verschiedenen Instrumenten gespielt, kann uns ganz verschiedenartig ansprechen, ohne dass wir gerade fähig wären, den Unterschied wirklich zu erfassen. Auch das Zusammenklingen mehrerer Instrumente der gleichen Art hat nicht stets die gleichen Folgen. Während das Zusammenspiel von Streichern ein abgeschlossenes, homogenes Ganzes ergibt, ist der Zusammenklang von gleichartigen Blasinstrumenten stets noch bewegter, durchdringender als der Klang eines nur Einzelnen.
Wenn wir nun die Instrumente ihrem Wesen – nicht ihrer Bauart nach – einordnen wollen, so kommen wir auf ein von der üblichen Einteilung abweichendes Resultat. Denn normalerweise unterscheidet man Blasinstrumente von Saiteninstrumenten, welch letztere dann wiederum unterteilt werden in Streichinstrumente und Zupfinstrumente.
Alleine, wenn wir ganz hingebungsvoll hinhören, wenn der Ton irgendeines Instrumentes erklingt, so können wir aus dessen Klang auf drei Arten der Tonerzeugung schliessen, welche drei Arten dann auch drei verschiedenen Prinzipien entsprechen. Weil es aber nicht möglich ist, durch Worte ein Instrument hörbar zu machen, fehlt uns ein absolutes Erfordernis zur Beurteilung der Instrumentenart aus ihrem Ton heraus, sodass wir hier dennoch umgekehrt vorgehen müssen, und aus der Verschiedenartigkeit der Tonerzeugung heraus die Verschiedenartigkeit des Wesens der verschieden erzeugten Töne erkennen wollen.
Auch wenn wir nur wenig mit den physikalischen Gesetzen vertraut sind, so erkennen wir, dass bei Blasinstrumenten der sonst kaum hörbare Atemstrom beim Passieren des Instrumentes als Ton hörbar wird. Es ist alleine diese Tatsache schon eine wunderbare Erscheinung mit einer äusserst tiefen Entsprechung, die wir nicht staunend genug zur Kenntnis nehmen können, wollen wir in das Wesen eines Tones und seiner Aussage dringen.
Der lebendige Atem eines Menschen, als eine unentwegt strömende und fliessende – also bewegte — Kraft, ist so lautlos, so unbedeutend in seiner äussern Erscheinung, dass nur gerade kleinste Kinder – die ohnehin alles zuerst entdecken müssen – ihn dann und wann hören und auch bewusst wahrnehmen, zum Beispiel wenn sie einen Erwachsenen bei einer schweren Arbeit keuchen hören, oder wenn sie einen schnarchenden Schläfer ausatmen hören. Und dennoch wird nur durch diesen Atem unsere ganze Sprache überhaupt erst ermöglicht. Er ist, einem stillen und verborgenen Weben gleich, die Grundbedingung so mancher Möglichkeiten und Erscheinungen. Er ist so kraftvoll und fürs ganze Leben wichtig einerseits, und dennoch so unbedeutend und nebensächlich erscheinend anderseits, dass wir ihn beinahe ganz aus unserm Bewusstsein verlören, wären da nicht so viele äussere Umstände und Widerstände, welche ihn hörbar werden lassen. Ausser den vorher erwähnten schweren leiblichen Arbeiten, oder schweren Krankheiten, die ihn als Seufzer wahrnehmen lassen, sind es vor allem die seelischen Anstände, die wir an den Widerwärtigkeiten des Lebens nehmen, welche ihn in Form von meist lauten Worten für andere hörbar machen, während ihn die Liebe ihrerseits nur zum lispeln benutzt.
Wie schön ist es da, dass der Mensch auch Instrumente erfunden hat, welche diesen mit dem Leben so untrennbar verbundenen Atem auch dann hörbar werden lassen, wenn der Mensch einmal in seiner Freude – anstatt nur im Ärger – seinen Gefühlen Ausdruck verleihen möchte – wenn er dem Schönen entgegenstrebt – wenn Freude seine Brust so kraftvoll schwellt, dass diese Kraft sich auch nach aussen hin kundgeben oder mitteilen möchte. Und dabei basieren dann diese Instrumente auf demselben Prinzip wie das Leben selbst. Es sind nämlich verschiedenartige, dem Lebens- oder Atemstrome entgegenstehende Widerstände, welche ihn erst hörbar machen – ihn offenbar werden lassen. Genau gleich, wie im täglichen Leben all unsere Gedanken sich erst offenbaren, wenn die Widerstände, die sich unserm Lieben und Wollen entgegenstellen, ihre Verwirklichung im Äussern hemmen oder verunmöglichen, sodass sie dann in Form von Fragen oder Forderungen laut werden. Genau so wird der Luftstrom des Atemwindes hörbar, wenn er an ihm sich widersetzenden Kanten vorbei fliessen muss und dadurch erregt und in Schwingung versetzt wird. Es ist die bewegte, lebendige Kraft selbst, welche uns entgegen tönt – bei dem einen oder andern Instrumente durch einen Schalltrichter noch verstärkt oder moduliert.
Wenn wir solchen Tönen lauschen, so spüren wir die Kraft, die Erregung – kurz: das Leben, das sie erzeugt –; in leisen Tönen nur verhalten wie die brennende Liebe eines sich seiner Liebsten kaum eröffnen Könnenden und in lauten Tönen kraftvoll und frei schwingend, oder bei hohen Tönen eher abweisend und scharf. Wenn mehrere solche Töne zusammenklingen, so spürt man die Verschiedenartigkeit ihrer innern Erregung und Bewegung deutlich und erlebt dabei den Schmelz des Zusammenwirkens einzelner ganz unverwechselbarer Individualstimmen als ein bewegtes und bewegendes Meer der Eintracht in aller seiner Mannigfaltigkeit und individuellen Verschiedenheit. Je länger die einzelnen Töne, desto überwältigender ist dieser Eindruck. Leider gibt es nicht sehr viele Kompositionen, welche diese Empfindung so recht deutlich hervorrufen, aber im vierten Satz "Adagio" von Mozarts Divertimento für Bläser in Es-dur KV 166, sowie im dritten Satz "Andante" und vor allem im unbeschreiblich schönen vierten Satz "Adagio" des Divertimentos für Bläser in B-dur KV 186 (wohl nur in der Einspielung mit der Bläservereinigung der Wiener Philharmoniker) begegnen wir ihr in geradezu ergreifender Weise. Wir erfahren und empfinden mit diesem Gefühl die positiv und aktiv sich gestaltende Kraft des Menschen in all seinen Nöten, Sorgen und Engen, in seiner grossen Bewegtheit, aber auch in der Erregtheit seines Liebewillens mit dem Zuge zur Einung und Eintracht hin.
Ganz anders verhält es sich bei den Streichinstrumenten.
Natürlich ist es auch bei ihnen eine Kraft, die sich äussert, denn es können überhaupt nur Kräfte sich äussern. Wo nur immer irgend eine Wirkung hervorgebracht wurde, waren gewiss zwei einander widerstrebende Kräfte daran beteiligt, weil unsern äussern Sinnen die Wirkung einer Kraft nur an deren Begrenzung erscheinen kann – niemals aber die Kraft selbst. Der Widerstreit mit einer andern Kraft aber ist es, der die Kraft begrenzt. So ersieht zum Beispiel niemand den Wind als eine pure Kraft, es sei denn an all jenem, das er entweder ergreift oder bewegt, als an dem ihn Begrenzenwollenden – an jenem also, das ihm entgegensteht oder seinem Zuge widerstrebt. Denn entweder erhebt er dieses durch seine innere Kraft, und wirbelt es in die Luft, oder er stösst sich daran und rüttelt an ihm, wie an den Blättern und Zweigen der Bäume, wenn er mässig stark ist, oder auch an starken Ästen und ganzen Bäumen und Dächern oder gar ganzen Häusern, wenn seine Kraft übermächtig stark ist und in voller Stärke und Heftigkeit tobt. Im letzteren Falle nehmen wir ihn auch nicht mehr bloss mit unsern Augen wahr, sondern wir vernehmen auch mit den Ohren sein Heulen, das ihm die seinem Zuge widerstrebenden (seine Kraft begrenzen wollenden) Gegenstände abnötigen, indem sie seinen Zug gewaltsam ändern und ihn dadurch in Schwingung versetzen, wie wir es nun von den Blasinstrumenten her kennen.
Aber auch der Lichtstrahl ist eine solche völlig unsichtbare Kraft, wenn er nicht ganz direkt in unser Auge dringt; es sei denn, er trifft auf einen seinen Weg begrenzenden Gegen- (oder Wider-) stand, der ihn zurückwirft und uns dadurch sichtbar macht, dass einige Teilstrahlen ganz direkt auf unser Auge treffen, in welchem dann die Netzhaut seine letzte Begrenzung ist, in welcher seine Kraft verspürt und unserm Aufnahmevermögen entsprechend gewandelt wird. Den Lichtschein einer gegen den Himmel gerichteten Taschenlampe erkennen wir bei ganz klarer Nacht aus diesem Grunde nicht. Bei nur leichtem Nebel hingegen erkennen wir seinen Strahl, weil das Licht auf seinem Wege durch unzählige Nebeltröpfchen gehemmt wird. Diese Begrenzung seines Weges macht es uns sichtbar durch die Zerstreuung, die sie bewirkt, weil durch sie gewisserart von jedem Tröpfchen auch ein Teilstrahl in unser Auge dringt. Je dichter der Nebel, also je stärker die Begrenzung, desto deutlicher wird er unserm Sinnesorgan – dem Auge – sichtbar.
Neben diesen beiden angeführten bewegten und bewegenden Kräften gibt es aber auch gebannte Kräfte, welche deshalb nicht etwa weniger stark sein müssen. Eine solche Kraft ist zum Beispiel die jedem Atome innewohnende atomare Elektrizität. Aber auch die aller Materie innewohnende Kohäsions- oder innere Anziehungskraft, welche – zwischen den Atomen wirksam – die Materie zusammenhält, ist eine solche gebannte, aber dennoch grosse Kraft – so gross jedenfalls, dass wir uns an ihr zerschellen, stossen wir mit der bewegten Kraft grosser Geschwindigkeit an die in aller Materie Ruhende. Sie ist schuld, dass die Gegenstände nicht weichen, wenn wir an sie stossen. In nur geringen Mengen von Materie ist die Summe dieser Kraft auch weniger gross, sodass wir sie überwinden können. Wenn wir zum Beispiel an eine Aluminiumplatte stossen, verspüren wir diese noch recht gut und deutlich schmerzhaft in dem an sie gestossenen Leibesteile, ohne dass wir sie dabei überwinden konnten. Wenn wir aber an eine aufgespannte Aluminiumfolie stossen würden, nähmen wir den Stoss kaum wahr, würden aber trotzdem ihre Kohäsionskraft überwinden, sodass die Folie zerreisst.
Wir kennen aber auch Materialien und Formen von bestimmten Materialien, in welchen diese Kraft noch so stark ist, dass ihre Materie bei einer Kollision nicht so schnell zerreisst, aber immerhin so stark tangiert werden kann, dass sie dabei in eine länger anhaltende Schwingung versetzt wird. Eine solche Form ist beispielsweise eine Spiralfeder, bei der wir ihr Schwingen sogar mit unsern Augen wahrnehmen können, wenn sie in gespanntem Zustand angeschlagen wird. Ein Material, welches diese Eigenschaft in sich hat, sind die verschiedenartigen Metalle, aber auch das Glas. Sie müssen aber immer in einem gewissen Spannungszustand sein, der sowohl durch die äussere Form bedingt sein kann – wie bei einer Glocke –, als auch durch eine innere Spannung durch die Verschiedenartigkeit der innern Korn- oder Kristallstruktur des Materials wie bei Stäben oder dem Triangel. Bei dünnen Fäden, den Saiten, reicht jedoch die innere Spannung nicht aus. Sie müssen von aussen her – durch einen Längszug – zuerst in Spannung versetzt werden. Jeder Schlag an die gespannte Saite (oder auch ein Zupfen an ihr) erhöht die Spannung in der Saite, weil er sie durch die dabei erfolgende Knickung verlängert. Aber die in ihr zwar ruhende, aber dennoch in Spannung gehaltene Kraft will diese "Knickung" oder Verlängerung nicht hinnehmen und zieht sie deshalb wieder mit Vehemenz in die ihr erträglichste, weil am wenigsten Spannung verursachende und schon vorher innegehabte gerade Stellung, welche die kürzeste Verbindung zwischen den sie gespannt haltenden zwei Haltepunkten ist. Durch diese vehemente Kraftanstrengung erfolgt aber eine Hinausschwingen auf die entgegengesetzte Seite, welche dann aber von derselben innern Kraft wieder zur geradlinigen Mitte gezogen wird, mit demselben Erfolg, dass sie auf der entgegengesetzten Seite erneut etwas – wenn auch vermindert – auswuchtet, und das periodisch fortgesetzt in unvorstellbarer Geschwindigkeit, aber stets abnehmend stark, hin und her. Je kürzer dieselbe Saite, desto weniger gross sind die Schwingungsweiten und desto kürzer auch ist die Zeit der einzelnen Hin-und-her-Schwingung. Die Anzahl dieser Schwingungen in einer gewissen Zeit (pro Sekunde) bestimmen aber die Höhe des dabei erzeugten Tones, und die Weite der Schwingung bestimmt die Lautsteigerung eines Tones. Also: je kürzer und schneller die Schwingungen, desto höher, aber auch kürzer ist der Ton, und je weiter die Schwingungen, desto tiefer und kräftiger, aber auch länger ausklingend ist der Ton. Darum sind die tiefen Töne auch einer grösseren Lautsteigerung fähig, wie wir im Kapitel über die Tonhöhen gesehen haben.
Diese Schwingungen übertragen sich in die Luft, verbreiten sich da überall hin und gelangen auf diese Weise auch zu unsern Ohren, bei welchen sie ein feinstes Häutchen – das Trommelfell – in dieselbe Schwingung versetzen, sodass wir eben diese Schwingung durch eine äusserst komplizierte innere Vorrichtung als Ton empfinden können. Solche Schwingungen aber übertragen sich nicht nur in die Luft, sondern auch auf alle der Schwingung fähigen Materialien. Deshalb liegt unter dem Steg, über welchen solche Saiten gespannt sind, stets eine zumeist aus Holz bestehende Vorrichtung, ein so genannter Schallkörper, welcher zum Mitschwingen genötigt wird und dadurch den Ton verstärkt, ja den Ton auch zu "färben" vermag.
Bei den Streichinstrumenten wird die Saite allerdings nicht durch ein förmliches Anschlagen in Schwingung versetzt, sondern durch ein Streichen mit einem Bogen quer über die Saiten hin. Dieses Überstreichen wird durch ein Bremsmittel (Geigenharz) erschwert, sodass die Saite unter dem Drucke der Bestreichung stets ganz wenig mitgenommen wird und dann wieder zurück "hüpfen" muss – freilich in einem allerkürzesten Zeitmoment, aber stetig von neuem wieder –, sodass sie in der ihr eigenen Schwingung verbleibt, solange sie gestrichen wird. Es ist also ein konsequentes und fortgesetztes Stören der Ruhe, welches der Saite bei einem Streichinstrument den Ton entlockt – im Gegensatz zum Blasinstrument, bei welchem es eine konsequente Störung der (Luft-) Bewegung ist, welche den Ton erzeugt (nicht entlockt).
Darin besteht ein grosser Unterschied! Die träge Ruhe, welche aller Materie eigen ist, ist einheitlicher, weil nicht so lebendig wie die bewegende Kraft. Der Ton der Streicher ist deshalb konstanter, gewisserart lebloser, als jener der Bläser. Er ist auf seine Art brillanter, aber kälter – ungerührter. Er lässt sich leicht mit andern seinesgleichen vereinigen und wird und wirkt dann äusserst homogen, undurchdringlich – fast ist man versucht zu sagen materiell; nicht etwa schmelzend bewegend wie bei den Blasinstrumenten.
Während wir den Bläserton eher mit einer Kerzenflamme vergleichen können, würden wir den Ton der Streicher eher mit dem zurückgeworfenen Lichte eines Brillanten vergleichen, der ungerührt und leblos das Licht in solcher Konzentration und Heftigkeit zurückwirft, dass wir eigentlich ein äusserst bewegliches Leben in ihm vermuten, während es in Wirklichkeit nur eine Erscheinung der geplagten Passivität der Materie ist, welche in aller Konsequenz die ihr eigene Ruhe sucht; welche nichts selber schafft und deshalb zum Empfange (von Impulsen) geeignet ist. Diese beiden Instrumentengruppen bilden also zusammen ein Paar, etwa wie: "Bewegung und Ruhe" oder "Geben und Nehmen" oder auch "Mann und Frau" oder "positiv und negativ". Dabei ist aber "negativ" nicht als Bewertung (also als "minderwertig") zu verstehen, sondern nur als Gegensatz, was uns leicht begreiflich wird, wenn wir die genannten Paare der Reihe nach betrachten: Zuerst "Bewegung und Ruhe":
Der Sinn einer Bewegung tritt erst gegenüber der Ruhe zutage. Wie liesse sich beispielsweise ein geordneter Bewegungsablauf, wie das Gehen, denken, ohne die Ruhe einer Unterlage? Das Resultat eines solchen Versuches ist leicht sich vorzustellen, wenn wir uns in Gedanken auf ein in einem mächtigen Sturme hin und her schwankendes Schiff versetzen. Dort müssen zeitweise selbst die Matrosen stehen bleiben und damit zum ruhenden Pole werden, wenn sich der Boden unter ihren Füssen allzu heftig und allzu unkoordiniert zu bewegen beginnt. Oder eine andere veranschaulichende Frage zu diesem Paar "Bewegung und Ruhe": Was für einen Sinn hätte die Bewegung eines Rades, wenn es nicht zwischen der Ruhe seiner Achse und der Ruhe des Bodens sich bewegte, sodass es dadurch den einen Ruhepunkt gegenüber dem andern verschiebt und erst dadurch zur Fortbewegung brauchbar würde?
Dass und wie "Geben und Nehmen" ein Paar ist, bei welchem weder das eine noch das andere schlecht ist, aber dennoch das eine wie das andere gut oder schlecht gehandhabt werden kann, haben wir im Kapitel des Vielklanges genauestens kennen gelernt. Bleiben noch die Paare "Mann und Frau" und "positiv und negativ".
Dass der Mann der Frau gegenübersteht, wie die Bewegung gegenüber der Ruhe, müsste eigentlich jedem Menschen klar sein, der sich nur ein wenig mit dem Wesen des Menschen befasst hat. Denn es ist doch zumeist noch stets der Mann, der gegenüber der Frau ein vorwiegendes Interesse zeigt, selbst schon in seinen spätern Kinderjahren. Und gäbe es keine Frau, so hätte er aus der Bewegung seines eher stürmischen Gemütes heraus schon lange begonnen, sich eine vorzustellen. Er hätte den tiefen Wunsch, alle seine Gedanken, welche er in seiner Ungeduld nicht tragend auszureifen imstande ist, einem ihm gleichen, aber ruhigeren Wesen anzuvertrauen, welches dann in der Annahme selbst seine Freude fände. Deshalb auch ist in der bildlich dargestellten Schöpfungsgeschichte Eva aus Adam hervorgegangen, als ein äusserst gediegenes und ruhendes Zweites aus der heftigen Bewegung des Ersten, wie etwa das Licht aus der Wärme oder die äussere Form aus dem Inhalte (deshalb aus einer Rippe, als eines formend-schützenden Elementes, Adams erschaffen), oder wie in sich ruhende Weisheit aus der bewegten Liebe. Ja, selbst in den kleinsten naturkundlichen Details, das Männliche und Weibliche betreffend, ist dieser Wesensunterschied erkennbar. So sind beispielsweise auch die männlichen Samenzellen äusserst lebendig, und nur der Tod bringt ihnen Ruhe, während die weibliche Samenzelle, die Eizelle, im Schosse der Frau ruht, ja förmlich zu Tode ruht, sofern nicht eine männliche Samenzelle auf sie trifft, sie aus ihrer lethargischen Ruhe weckt und zur Entwicklung und Entfaltung und endlich zu einer ersten Teilung nötigt, sodass eine fernere Entwicklung und das eigentliche Wachstum beginnen kann. Erst in dieser Vereinigung und Verschmelzung mit der ruhenden weiblichen Eizelle findet die männliche Samenzelle ihre Unterlage, ihre Heimat und in dieser die Ruhe, und gleichzeitig die weibliche ihr Leben. Des weitern hat der männliche Chromosomensatz der Zellen ein Geschlechts-chromosomenpaar, das aus einem x-förmigen und einem y-förmigen Teil besteht, welches also in sich heterogen ist und wie streitend sich verhält, während das Geschlechtschromosomenpaar der weiblichen Zellen aus zwei x-förmigen, also gleichen Teilen besteht, welche – sich selbst bestätigend – zur Ruhe neigen. Also ist das zweite Paar (das "xx"), welches als ein Teil aus einem Ersten erst hervorgegangen war, in diesem Ersten (dem "xy") bereits enthalten gewesen und verhält sich in seiner nunmaligen Absolutheit zum bewegten Ersten negativ, wie die Giessform – negativ ausgebildet – die äussere Form des positiven Werkes enthält.
Dem Sinne dieser Betrachtungsweise gemäss ist dann allerdings der Mann das Negative zu Gott, weil aus ihm hervorgegangen. In ihn will Gott seine Gedanken legen und in ihm den Himmel gestalten, und nur, weil der Mann noch zu wenig ruhendes Verständnis dafür hat, muss er in einem Negativen zu sich selbst das Positive der Form Gottes in ihm erkennen lernen. Somit sind dann Mann und Frau in ihrer gemeinsamen Vollendung ein Einiges vor Gott.
Darum entsprechen dann in der Musik die aus der bewegten Kraft des Luftstromes hervorgegangenen Bläsertöne den Verkündenden und die Streichertöne den diese Bewegung (zu ihrer eigenen Belebung) Aufnehmenden. Die ersteren den Befruchtern, die letzteren den Befruchteten und Ausreifenden. Die Bläser formen den Ton und die Saiten der Streicher nehmen ihn auf. Ein Phänomen, das sich auf physikalischem Gebiet sogar förmlich erleben lässt: Wenn ein Ton in einem Raume laut genug erklingt, so schwingt eine entsprechend gestimmte (gespannte) Saite mit und lässt sich auch nach dem Ende des zuerst erklungenen, und darum erzeugenden Tones noch deutlich vernehmen (als Gezeugtes). Als anschaulichen Beweis dafür, dass gespannte Saiten den ihnen entsprechenden Ton aufzunehmen und danach wiederzugeben vermögen, können wir bei einem Klavier mit dem rechten Pedal alle in ihm befindlichen Saiten, die sonst durch eine sie berührende Vorrichtung unfrei gehalten sind, frei geben und danach ein oder mehrere Töne singen. Wir werden danach aus dem Klaviere dieselben Töne wieder vernehmen.
Wie auf der Erde bei den Menschen schon die Erzeuger (oder Entwickler) von Ideen, Begriffen, Einrichtungen und Vorrichtungen gegenüber den Empfängern (Schülern und Benutzern) derselben in der Minderzahl sind, und auch sein müssen, so sind entsprechend aus demselben Grunde in einem Orchester die Bläser gegenüber den Streichern in einer bedeutenden Minderheit. Sie sind das Salz, die Streicher die gewürzte Speise.
Wie es allenfalls umgekehrt herauskommen könnte, erleben wir in heutiger Zeit, wo die ständig neuen Erfindungen, Vorrichtungen und Einrichtungen zu stets veränderten Lebensbedingungen führen, welche den Einzelnen nicht mehr zur Ruhe und Übersicht kommen lassen, bis er erschöpft und unter Depressionen zusammenbricht. Eine unheilvolle Zeit, welche sich aber entsprechend ebenso in der Musik widerspiegelt wie alle frühern epochalen Eigenheiten der Menschen in der damaligen Zeit (grosse Orchester, Bevorzugung der Streicher). Denn in vielen modernen Musikarten sind die Bläser (= Erfinder, Beweger und Erzeuger) in der grossen Mehrzahl, entsprechend dem heutigen Mensch und Menschenbild, wo ein jeder möglichst uneingeschränkt "wirken" und verkünden (sprich: herrschen) will, und niemand mehr das Verkündete annehmen, prüfen und ausführen will, kurz: niemand mehr dienen will. Dementsprechend fehlen die Streicher oftmals sogar ganz. Die heutige Musik zeichnet sich aber vor allem auch durch ihre Lautstärke (=Veräusserlichung – siehe im Kapitel Tonintensität), schnelle Rhythmik (ebenfalls entsprechend der Veräusserlichung durch Verstandesüberbewertung – siehe Kapitel Tonlänge), sowie – ausgerechnet in der so genannten ernsten Musik – in stets wachsender Anzahl neuer Geräusch- (nicht Ton-)erzeuger aus. Daraus erkennen wir mit Bestimmtheit – sofern wir das ohne die heutigen Erscheinungen nicht gemerkt hätten –, dass jede Bewegung auch eine ihr entsprechende Ruhe finden muss, wenn sie sich erhalten will; und so gesehen ist heute Ruhe zumindest in ihrer Bewertung positiv. Denn: wer in einem langsam fahrenden Zuge sich der Fahrtrichtung entgegengesetzt, aber in der der Fahrt entsprechenden Geschwindigkeit fortbewegt, kommt in der Landschaft, durch welche der Zug fährt, nicht vom Fleck. Da wäre die Ruhe seiner Unterlage (das Anhalten des Zuges) seiner Fortbewegungsabsicht und Fortbewegung gegenüber positiv.
Stellen wir uns zuguterletzt noch einen Künstler voller guten Ideen und voll hoher Ideale vor, und fühlen ihm nach, wie es in seiner Liebe feurig und bewegt zugeht, wie es etwa in Beethovens Brust zugegangen sein mochte. Wie schön ist es da, sich auszumalen, wie glücklich er gewesen wäre, hätte ihm ein dankbar aufnehmendes weibliches Gemüt in voller Hingabe und mit geduldiger Ruhe zur Seite gestanden und dadurch manch überstürzte Vorsätze oder Vornahmen alleine durch sein Verweilen bei ihm, sowie durch seine An- und Aufnahme und der daraus hervorgehenden Sänftung des Feuers, verhindert
Speziell im untern Teil des mittleren Tonbereiches können wir den Unterschied von Bläsern und Streichern (von Männlichem und Weiblichem) gut feststellen. So empfinden wir die tiefern Streichertöne (zum Beispiel das Cello) deutlich als mütterlich, eher weich und "saftig", fast triefend voll – hingebungsvoll, während wir die Bläsertöne daselbst bestimmter und ernster, zuweilen gar trockener (bei aller Gemütlichkeit) empfinden.
Damit wäre eigentlich über dieses Paar (Bläser und Streicher) genug gesagt. Weil aber ein ganz sorgsam abwägendes und tief empfindendes Gemüt bei der Betrachtung des hier Aufgeführten bald einmal alle Blas- und Streichinstrumente in seiner Erinnerung durchgegangen ist und bestimmt bei den Blasinstrumenten der höchsten Töne, der Flöte und der Klarinette, sowie bei den Streichinstrumenten der tiefsten Töne, der Bassgeige, gemerkt haben wird, dass das eine nicht mehr ausgesprochen männlich zu vernehmen sein wird und das andere nicht mehr ausgesprochen weiblich erklingen mag, so soll zur Lösung dieser scheinbaren Ungereimtheit folgende Erklärung dienen:
Das Erzeugende, Bewegende und Gestaltende ist stets der Grund, sowie das Erzeugte, Bewegte und Gestaltete die Wirkung oder das äusserlich Ersichtliche des tiefern Grundes ist. Wie wir im Kapitel über die Tonhöhen gesehen haben, ist stets die Liebe – und nur sie alleine – der Grund zu aller Wirkung – gleichgültig, ob es sich um physikalische (Erdanziehungskraft / Gravitation) oder psychische Wirkungen handelt. Also entspricht die Liebe dem männlichen Teil des Paares "Grund und Wirkung" und die Weisheit dem weiblichen Teile desselben Paares, weil die letztere aus der Beengung der Fülle der gesättigten Liebe als Gezeugtes hervorgeht, wie am Beispiel der Entwicklung des Säuglings zum Kleinkinde im Kapitel der Tonhöhen dargelegt wurde. Diese Beengung, ist zwar wohl die Ursache; der Grund aber zu solcher Ursache ist die alles an sich binden wollende Liebe, welche eben durch die vielen sich teils widersprechenden an sich gebundenen Teile beengt wird, und die Folge (das Gezeugte) ist die aus der Bedrängnis der Liebe hervorgehende Weisheit. Ferner entspricht die Liebe oder das Männliche (Zeugende) dem Inwendigen, und die Weisheit, als das (erzeugte) Licht, dem Weiblichen und dem Äussern. Nun sind aber die höchsten, der Weisheit entsprechenden Töne derart gediegen, klar und erhärtet, dass sie die sie erzeugende (männliche) Kraft der Bläser kaum mehr erkennen lassen, sodass die Flöte in ihren höhern Tönen nicht mehr als typisch männlich erscheint, weil das Extrem der Tonhöhe über das Wesen der Tonerzeugung vorherrscht; und umgekehrt entsprechen die tiefsten Töne derart der bewegenden und schwingenden Liebe, dass sie in ihrer Extremität auch das weibliche der Streichertöne einer Bassgeige zu neutralisieren vermögen. In den mittleren Tonlagen hingegen sind beide Pole oder Extreme spürbar wirksam, sodass dann der jeweils dem instrumentalen Wesenszug des Tones entsprechende Pol diese Wesenheit noch verdeutlichen – also einerseits des Bläsers "Beben" unterstützen und anderseits des Streichers Brillanz der Ruhe unterstreichen kann.
Bei dieser Aufteilungsart der Instrumente – nach der Entstehungsweise des Tones, nicht nach der Erzeugungsweise – müssen allerdings die Töne einiger Blasinstrumente, wie jene der Mundharmonika, aber auch des Harmoniums und der Handharmonika (Akkordeon) zu den Streichertönen (nicht Streichinstrumenten) gerechnet werden. Wohl hätte ein einfühlsames Ohr nichts dagegen einzuwenden, aber natürlich unser Verstand. Und weil wir gerade ihm (dem Verstande) eigentlich das Wesen unserer Gefühle und die aus ihnen entstehenden oder entspringenden Ahnungen durch das Aufzeigen ihrer Entsprechungen näher bringen wollen, so sind wir ihm den Grund dafür auch zu erklären schuldig:
Es gibt unter den Blasinstrumenten auch solche, bei welchen nicht der Luftstrom selbst durch Widerstände zum Tönen gebracht wird, sondern eine eng in einen Rahmen eingefasste Lamelle (sog. Durchschlagzungen). Diese wird von dem an ihr vorbei oder über sie hinweg streichenden Luftstrom zum Vibrieren gebracht, genau gleich wie die Saiten der Streicher vom über sie hinweg streichenden Bogen. Auch hier bestimmen Form und Material dieser Lamellen die ihnen entsprechend eigene Tonhöhe, wie sie analog bei den Saiten durch Material und Länge bestimmt wird.
Das Bewegende – der Luftstrom – tönt hier ebenso wenig selbst, wie bei der Geige der die Saiten bestreichende Bogen. Zwar wird hier geblasen, in Ermangelung eines Bogens, deshalb der Name "Blasinstrument", aber es ist nicht die aktiv bewegende Luft, die ertönt, sondern die durch sie erregte Lamelle, welche dann erst die Aussenluft – wie die vibrierende Saite auch – zu jener Vibration bringt, die sich unserm Ohr als Ton mitteilen kann. Die Töne dieser Instrumentengruppe gleichen deshalb auch den Streichertönen. Sie werden auch von den meisten so empfunden, was bei der Mundharmonika schon der Dialektname "Schnuregiege", ins Schrift-deutsche übertragen: "Maulgeige", belegt.
Nun bleibt uns noch eine dritte Art von Tönen zur Betrachtung übrig, welche sich wieder in zwei Untergruppen einteilen lassen. Es sind bei den Saiteninstrumenten jene, die gezupft werden, wie bei der Gitarre, der Mandoline aber auch bei der Harfe, und auf der andern Seite dann jene, die durch Anschlagen erzeugt werden, wie beim Klavier, aber auch bei Glocken, dem Triangel und dem Xylophon.
Allen diesen Tönen ist eines eigen: dass sie nämlich nach einer einmal erfolgten Erregung aus sich heraus eine mehr oder weniger lange Zeit in der ihr eigenen Schwingungserregung verbleiben und dann leise verklingen. Ihre Tonintensität nimmt also stetig ab, neigt also zur Verinnerlichung, wie wir im Kapitel über die Tonintensität festgestellt haben. Dabei sind die gezupften Töne nicht so rein, wie die durch Schlag erzeugten. Ihre Erzeugung, das Zupfen, stellt eine stärkere äussere Ruhestörung der Saite dar, als das Anschlagen, und hat zur Folge, dass der Ton nicht so rein erklingt, was besonders bei mittleren und höheren Tonlagen deutlich wird. Sie entsprechen eher einem etwas trägen Geiste, dessen Liebekraft noch nicht so voll ist, und deshalb erst durch ein starkes "Mitnehmen" (= zupfen) das Verlangte zu geben gewillt ist. Die auf eine der beiden beschriebenen Arten zustande gekommenen Töne sind nach deren Erzeugung nicht mehr beeinflussbar, es sei denn, sie werden "erstickt" durch eine Berührung der Saite. Es bleibt somit der Ton neutral, sich selbst stets gleich; er lässt sich nicht manipulieren (steigern, aushalten oder vermindern) wie etwa Bläser- oder Streichertöne. Und in dieser Hinsicht entspricht der Ton ganz dem Wesensinhalte des ihn erzeugenden Materials oder Stoffes; ist also neutral und damit jeder Leidenschaft bar. Das Spiel auf solchen Instrumenten kann deshalb trotzdem leidenschaftlich sein, weil zwar nicht der einzelne Ton, wohl aber seine Reihenfolge in ihrer Lautstärke zu- und abnehmen kann, und die lauten Töne schon an und für sich die Leidenschaft verkörpern. Heftiges Zu- und Abnehmen sind ebenso wie die Kürze der Töne eine Bewegung, welche der Leidenschaft entspricht. Der einzelne Ton für sich aber bleibt in seinem Erklingen und Verklingen neutral und unverändert. Wir müssen ihn als geistigen Impuls zur Kenntnis nehmen, der sich selbst auch immer gleich bleibt. Seine Unbestechlichkeit ist es denn auch, die uns bei aufmerksamem Hinhören so sehr erregen kann, besonders in seiner reinsten Form, also bei Erzeugung durch Schlag (Anschlag). Die absolute Regelmässigkeit und Reinheit eines solch angeschlagenen Tones könnten wir beinahe als "Stille" erfahren, wenn wir ihn für sich alleine ertönen lassen. Eine gewisse Bestimmtheit und eine Ruhe liegt in ihm, welche uns eine unermessliche Fülle von Reichtum in ungetrübter Ordnung erahnen lässt, was wir aber nur spüren, wenn wir ganz hingebungsvoll nur einem einzigen Tone, etwa aus den mittleren bis leicht höheren Tonbereichen, unser Ohr leihen. Die Klarheit eines solchen Klanges kann vielleicht am deutlichsten zutage treten, wenn wir einen ganz anders erzeugten Ton als Gegensatz dazu hören; mag es nun ein Streicher-, ein Bläserton oder die menschliche Stimme sein.
Die bis dahin erfolgten technischen Erläuterungen über die Entstehung und damit auch über die Wesenheit der Töne der verschiedenen Instrumentenarten sind darum etwas straff und kurz gefasst, weil sie trocken bleiben müssen, solange derjenige, der sich durch diese Erläuterungen anregen lässt, den Zauber des Tones nicht mit seinem Ohr selbst vernehmen kann, oder ihn als Musiker nicht vorher schon zur Genüge empfunden und möglichst kennen gelernt hat. Wer aber Gefallen an solchen Wesensunterschieden gefunden hat, der wird sicher Mittel und Wege finden, näher in Kontakt mit allen diesen Tönen zu kommen, um sie selbst einmal zu hören und ihre Wirkung auf sein Gemüt fühlen und empfinden zu können. Wer eher am Reichtum der Entsprechungen über die himmlischen Klänge der Musik einen Gefallen gefunden hat, weil ihn ja erst diese Erkenntnis fähig macht, einen positiven und bleibenden Nutzen für sein persönliches Leben aus der Musik zu ziehen, der soll hier folgend noch einer ihm sicher wohltuenden und ihn innerlich bereichernden und erbauenden Betrachtung begegnen können:
Im Kapitel über den Vielklang haben wir nämlich an einem Beispiel gesehen, dass nicht der äussere Reichtum wirklich glücklich macht und reiche Seligkeit gibt, sondern nur der innere. Und so wollen wir nun versuchen, aus diesen wenigen äussern Angaben über die Unterschiede in der Entstehungsweise der Töne ein möglichst reichhaltiges inneres Erschliessen ihres Wesens und seiner Entsprechung zu unsern innern, seelischen Vorgängen zu erlangen.
Als Ausgangspunkt unserer Betrachtungen nehmen wir die Erkenntnis, dass alle Instrumente, die angeschlagen werden, nur die ihnen eigenen, also spezifischen Töne haben, die sich stets gleich bleiben. Sie sind sich selber also treu, sie haben nur ein einziges Wesen, das sich uns zu offenbaren beginnt, sobald wir an sie "gelangen", sie "ansprechen", mit andern Worten: sie anschlagen.
Darunter ist eines – das Klavier –, welches die grosse Zahl von 88 (manchmal nur 85) verschiedenen Tönen oder Wesenheiten in sich vereinigt oder – anders gesagt – alle in 7 Oktaven enthaltenen Möglichkeiten. Einen ähnlichen Reichtum haben zwar auch andere Instrumente, wie etwa die Harfe oder die Orgel. Aber ausser dem Klavier hat kein weiteres mehr seine Töne so "offen liegen" und deshalb auch so ansprechbar wie das Klavier. Die Spannung seiner Saiten ist dergestalt, dass eine jede Saite bereit ist, sofort zu ertönen, wenn sie auch nur ganz leise – zum Beispiel von einem von aussen kommenden Tone her – berührt wird, weshalb dieses Instrument einen eigenen Mechanismus braucht, welcher diese Bereitschaft der Saiten, sich kundzugeben, dämpft. Und hätte das Klavier diese Einrichtung nicht, so würde es immerzu ertönen, selbst wenn im Raume, da es steht, auch nur gesprochen würde, denn jedes Geräusch vermag seine äusserst erregbaren Saiten in Schwingung, zu bringen oder anzusprechen.
Also könnten wir weiter sinnieren, dass jeder nur denkbar mögliche Ton innerhalb der 7 Oktaven in einem Klaviere einem Partner gleicht – einem, der sich von uns ansprechen lässt und damit auf unsere momentane Stimm(ungs)lage, und somit auf unser Wesen, eingeht. Wie schön wäre das doch im täglichen Leben, wenn wir für alle unsere Gedanken, Gefühle und Fragen einen Partner oder Freund hätten, welcher ständig auf alle unsere ureigensten "Gefühlstöne", die sich aus unserem Erleben ergeben, eingehen könnte, sodass er uns wahrhaft aus dem Fundamente verstünde und uns dadurch auch immer und in jeder Lage helfen könnte, sodass wir uns nie alleine fühlten und in allem ein "Du" vor uns hätten. Der darüber hinaus aber auch alle unsere Bekannten ebenso aus dem Innersten heraus verstünde, sodass er auch ihnen dasjenige wäre, was er uns selbst bedeutete, und der dadurch in der Lage wäre, zwischen uns und unseren Bekannten – bei irgendwelchen Schwierigkeiten der Verständigung miteinander – weiter zu helfen – uns auszugleichen und zu versöhnen durch das Verständlichmachen der gegenseitig verschiedenen und deshalb unverstandenen Ansichten und Gefühle. Und wenn dieser Freund von sich selber nie gross reden würde, und auch über uns selbst erst dann sich eröffnen würde, wenn wir ihn darum angehen – ihn "anschlagen" würden –, so wäre er wahrhaft vollkommen. Wie würde sich bei einem solchen Charakterwesen sein unermesslicher Reichtum doch so unerhört schön und harmonisch mit seiner Bescheidenheit, Genügsamkeit und Demut paaren!
In dieser Welt gibt es ihn nicht, diesen Freund, nur das Klavier, als ein Symbol für ihn. Aber im Geiste gibt es ihn – eben den Geist selbst, wenn es ein Geist der absoluten Liebe und Treue ist, so etwa das, was wir Christen mit "Gott" oder treffender mit "Vater" bezeichnen. Und wie sehr ihm doch das Klavier gleicht, erkennen wir leicht daran, dass es einen Mechanismus hat, welcher die leicht erregbaren Saiten abschirmt vom Lärm der Welt, weil sonst allezeit im Klavier derselbe Lärm resonieren (Resonanz finden) würde, der im Raume erzeugt wird, was dem gleich käme, wenn in der Natur alles so beschaffen wäre, dass auf eine Tat der Menschen unmittelbar eine gleiche Gegentat des Geistes erfolgen würde. Dass also, wenn beispielsweise ein Mensch den andern schlägt – mit Worten oder mit seinen Fäusten – auch er selbst sofort geschlagen würde; wenn er tötete, dass auch er sofort getötet würde usw.
Wie grausam einengend wäre doch ein solches Verhältnis für Menschen, die nicht der Liebe alleine zu dienen gewillt sind.
Nun hat aber diese Vorrichtung des Klaviers – wie des Geistes – auch eine Kehrseite: Wenn jemand, sich alleine und einsam fühlend, das Verlangen in sich trüge, sich jemandem mitteilen zu können, der den Kummer oder die drückende Last des Lebens mitfühlen könnte, und in seinem mitfühlenden, warmen Verständnis den Bedrückten etwas stärken und aufrichten könnte, so kann er, auch wenn er durchaus möchte, nicht ohne weiteres dieses Mitschwingen erreichen und in sich selbst spürbar werden lassen, dass Einer ihn zu halten und zu stärken bereit ist, weil da eben der Mechanismus vorhanden ist, welcher dieses Mitschwingen verhindert. Er müsste denn – wie beim Klaviere – von den vielen vorhandenen Tasten die genau richtige drücken, damit die Vorrichtung dieses Mechanismus unwirksam würde und ihm dadurch dann ein "Echo" zuteil würde. Und wie im Leben selbst ist es auch beim Klavier! Es ist nämlich die aller unterste und unansehnlichste Taste, nämlich die untere rechte Fusstaste, das so genannte Pedal, das er drücken muss. Dieses entspricht im Leben und Wirken eines Menschen in dieser Welt der rechten (innern) Demut, die aus der Liebe kommt! Auf sie und ihre Wege müsste ein Mensch seinen Fuss setzen, damit der Verschlussmechanismus des Geistes in ihm geöffnet würde und er ein "Echo" des in seinem Innern ruhenden göttlichen Geistes in sich fände, das ihn stärkt. Aber damit würden ihm dann natürlicherweise auch alle schlechten Töne seines Wesens, die sich in schlechten Taten kundgegeben haben, entgegentönen und an sein Gewissen schlagen; und er bräuchte dabei dann seine ganze Demut, um diese alle ebenfalls in sich – sie einbekennend – wieder aufzunehmen und aus wahrer Reue sie zu korrigieren, um sie damit wieder in eine Harmonie zu bringen. Dabei kann er dann allerdings auch des Trostes und der Stärkung teilhaftig werden, der ihm infolge der Lösung des den Ton verhindernden Mechanismus seines Liebegewissens in der geordneten Kraft des Geistes ungehindert zufliessen kann. Mit einer solchen Handlungsweise hätte er dann sein eigenes Wesen demjenigen des Klaviers angeglichen und würde auf jedes "Anschlagen" oder Anregen des Geistes reagieren, sodass sein ferneres Spiel oder Wirken in der Welt rein und erbauend zu vernehmen wäre. Gliche aber ein solcher Mensch dann seinem Wesen nach dem Klavier, so hätte er auch die unter Menschen seltene Eigenschaft der Zurückgezogenheit. Das heisst: Wohl würde sein Ton herrlich erklingen, wenn er von einem Freunde oder auch von einem Fremden angeschlagen würde, aber er hätte – wie der Ton des Klaviers auch – das Bestreben, sich wieder in sich selbst zurückzuziehen und nicht auffällig zu sein, sondern nützlich nur, sodass er sogar mehrmals angeschlagen werden muss, will man längere Zeit seine Wesenheit als Nähe verspüren. Die Verinnerlichung also wäre sein überall zu empfindendes Wesen, und Reinheit und Reichtum die Wirkung daraus.
Da in einem Klavier alle Töne präsent vorhanden sind, gleicht es in seiner Fülle schon beinahe einem kleinen Orchester, da es viele Töne miteinander gleichzeitig erklingen lassen kann – gerade so viele, wie ein einzelner Mensch aus seinen eigenen Möglichkeiten (den 10 Fingern seiner beiden Hände) ihm zu entlocken vermag. Diese Tatsache verleiht diesem Instrument ebenso das Wesen der Fülle, der Harmonie und der Vollendung, wie die Tatsache, dass seine Töne nicht manipuliert werden können. Ihr einmal ertönender Klang kann nicht verändert, verstärkt oder in einen andern übergehend gemacht werden.
Wenn wir auf dem Klaviere eine Wanderung durch das Reich der Töne machen, so können wir zwar wohl denselben (Melodien-) Weg beschreiten, wie ihn ein Streichinstrument oder ein Blasinstrument auch beschreiten kann, aber die Wanderung selbst empfinden wir anders, ruhiger, leidenschaftsloser und darum abgeklärter, leichter und sonniger auch. Das bewirkt das stets unveränderte Wesen seiner Töne. Um das so recht verdeutlichen zu können, wollen wir uns aus dem visuellen Bereiche ein beispielgebendes Bild leihen:
Wenn wir an einem schönen Frühsommermorgen in einer abgelegenen, schönen Berggegend spazieren gehen und dann während einer kleinen Rast auf einer Bank die herrlich gestaltete Landschaft betrachten, wie sie so in allen Farben prangend vor uns sich ausbreitet, so kann uns wohl auch die Lust anwandeln, einmal den einen oder andern Berg zu besteigen. Dabei erschauen wir bei dem einen oder andern sogar kleinere oder grössere Wegstrecken, und wir verfolgen den einen oder andern Pfad mit unsern Augen über die steilen Abhänge hinauf und sehen ihn sich verlieren im herrlichen Jungwuchs eines aufkommenden Waldes, finden ihn dann wieder, wie er gerade um einen grossen Felsvorsprung herum auf die Schattenseite des jenseitigen Tales verschwindet, und sehen ihn wieder weiter oben sich den karg bewachsenen Felsformationen entlang winden – wieder auf der uns zugekehrten, voll besonnten Talseite –; und endlich wird er unsern Blicken ganz entschwinden in den moosigen und Farnbewachsenen Schluchten eines Bergeinschnittes. Und nur, weil wir wissen, dass er oben auf eine Fluh führt, deren Felswand uns noch im Profil – zwischen den Zweigen hoher Bäume – schwach ersichtlich ist, empfinden wir eine volle Freude über diesen "Aufstieg", den wir mit dem Lichte unserer Augen verfolgen konnten bis hinein in die enge Schlucht der end-gültigen Wendung des Weges.
Dieses volle Bild, dieses schöne und überaus wechselseitig-harmonische Erlebnis der Wanderung gleicht der Einsicht eines geweckten Geistes über die Pfade des menschlichen Lebens — gleicht aber entsprechend auch der Melodieentfaltung auf dem Klavier. Ganz anders und gewisserart viel hautnaher oder seelisch mitgehender würden wir natürlich diesen vorher nur mit unserm Augenlicht begangenen Weg erleben, wenn wir ihn unter unsere Füsse nehmen würden: Die sengende Hitze in den von der Sonne beschienenen Felspartien würden wir ebenso verspüren, wie die nasskalte, uns frösteln machende Kühle der Schlucht. Den Abgrund, dem es überall auszuweichen gilt, würden wir ganz anders erleben, als wenn wir vom Tale aus ehrfürchtig wunschvoll hinauf blicken zu dem schönen Höhenpfad. Der Schweiss, der Durst, dann die Kälte und der Hunger, aber auch eine gewisse Müdigkeit sind alles Gefühle, welche wir zwar beim Anblicke des Weges nicht ausser Acht gelassen hatten, deren Druck aber dennoch in einem weit ausgeglicheneren Verhältnis zur Schönheit des Weges stand, als während eines späteren tatsächlichen Erlebnisses. Die tatsächliche Wanderung, als Gegensatz zu jener mit unseren Augen, müssten wir mit einem Streichinstrumente wiedergeben. Es alleine kann den Empfindungsdruck auf den Empfangenden so richtig wiedergeben. Den Durst, die Müdigkeit, ja die Pein des Ausharren-Müssens, aber auch die freudige Überraschung bei einer glücklichen Wendung des Weges, die Dankbarkeit am Ziele: alle diese Gefühle sind dem Streicher näher als allen andern Instrumenten, weil ja entsprechend auch bei ihm nur der stete Druck des Bogens die Fortsetzung der Töne erwirkt, welche sich unter ein und demselben Bogendrucke ebenso ändern können, wie die Gefühle des Wandernden auf ein und derselben ihn beengenden Wegstrecke. Es ist das seelische Moment der Bewegung, wie wir im Kapitel der Tonlängen gesehen haben, welches in einer permanenten Gegebenheit der Landschaft ein eigenes, subjektives Gefühl erwirkt. Etwa gleich wie das Einfliessen (Zeugen) des Geistes in die Seele – durch den Druck der Wahrheitserkenntnis – diese in Bewegung versetzt und sie nötigt, sich dem Inhalte des geistigen Erkenntnissamenkornes entsprechend zu verhalten, um selbst einmal als ausgereifte Frucht ihrer eigenen Tat das klare Bild des Geistes für sich zu erlangen und dann nach aussen hin durch ihre Handlungsweise auch zu verkörpern.
Ist dann aber die Wanderung, oder die Ausreifung des Empfangenen, vollendet, dann auch ist die Kraft voll entwickelt und ein starkes Mitteilungsbedürfnis wird diese Kraft erfüllen – der Wunsch also, andern vom Erlebten mitzuteilen und sie des Erfolges ihrer eigenen Bemühungen zu versichern, damit sie ebenso frei und glücklich werden können, wie es der Wanderer auf der freien Kuppe des Berges nun ist.
Dann also müsste dieses Gefühl in der Musik – entsprechend dem Ansporn an die sich noch im Tale Befindlichen – von der Höhe der Kraft aus, also durch ein Blasinstrument erfolgen, welches voll beharrlicher Kraft die vielen Widerstände des "wenn und aber" der noch im Talschatten der Erlösung Harrenden am ehesten überwinden könnte – gerade so, wie der Atemstrom des Bläsers die Widerstände seines Instrumentes durch ihre Überwindung erst zur Verlautbarung seiner Kraft bringt.
Und dennoch wäre es wieder ein anderes, wenn bereits auf dem Wege der eine Wanderer den andern aufmunterte, obwohl ja noch selber unter dem Drucke der Aufgabe stehend und unter der eigenen wie der fremden Last des Überwinden-Müssens leidend. Eine solche Aufmunterung, wenn sie echt ist, kann nur aus der Dankbarkeit eines zwar noch leidenden, aber im Leiden bereits erkennenden Gemütes kommen. Es wäre in der musikalischen Darstellung wieder ein Streichinstrument, wohl das Cello, welches in äusserst intensiven, aber nicht sehr lauten, der Höhe zustrebenden Tönen den Ausdruck der Dankbarkeit und der mitteilenden Hoffnung erkennen liesse, weil dieses durch seine etwas tiefere Stimmungslage die Zunahme in der Kraft der Liebe, als eine Folge des bisherigen treuen Ausharrens, zu verkörpern vermag.
Die eben geschilderten Situationen aber sind jene aller Menschen; und alle sind Streicher, Bläser und Klaviere zugleich, denn wir alle müssen aus der Not unserer ursprünglichen, kindlichen Armut und Unerfahrenheit herauswachsen und den Weg der Vollendung unter die Füsse nehmen, an den scharfen Felsen des niedrigen Egoismus vorbei, über die Geröllfelder des nur in Bruchstücken erkennenden Intellektes, wo die sengende Hitze des ohne Liebe erhaltenen Erkenntnislichtes uns und unsere Hoffnung beinahe verschmachten lässt, und durch die Schlucht der Selbstverleugnung zu Gunsten des Höheren, das in uns – uns befruchtend – wirksam werden soll, hindurch, bis wir endlich frei sind von Egoismus und dadurch von Täuschung und Lüge und darum dann auch die herrliche Rundsicht des Geistes geniessen können. Das verhält sich so, ob wir das so sehen können, ob wir daran glauben oder nicht; frei vom Überflusse der Welt werden wir ja alle einmal – wenn wir sie verlassen müssen. Aber mit welchen Gefühlen und mit welcher Kraft, das entscheidet jeder selber, und zwar durch seinen eigenen Weg und die Art, wie er ihn gegangen ist.
Wie glücklich, wer da an einem Feiertage die Dinge und Verhältnisse seiner innerlichen Lebenslandschaft mit seinen geistigen Augen ebenso betrachten kann, wie ehedem die natürliche Landschaft mit den Augen seines Leibes, sodass sich die Pein der Not und Mühsal des Alltages wieder verflüchtigen kann, und sich dabei die krankmachende Verkrampfung – vom Druck der Lebensbürde her rührend – wieder lösen wird, angesichts eines solchen Bildes, das ihn in seinem ganzen Gemüte wieder mit Dank und Zuversicht erfüllen wird, weil es – so klar und erlebnisreich zugleich – zu einer förmlichen Gewissheit in seiner Seele werden muss, dass nur darin der wahrhafte Sinn des Lebens liegen kann: Dass wir unsere eigenen Schluchten unserer mannigfachen materiellen Gier überwinden, so steil der Weg aus ihnen sich auch gestalten mag, und in dankbarer Zuversicht erkennen, dass trotz all unserer Bemühungen doch immer wieder von höherer Warte aus unser Weg mitgestaltet und durch alle unsere Irrtümer hindurch sicher hinausgeführt wurde in eine lichtvolle Höhe klarerer Erkenntnisse.
16.8.89 und 1.11.89
nach oben
DER ZENTRALE PUNKT  Einer Komponente der Musik haben wir bisher noch kein eigenes Kapitel gewidmet, und dennoch wurde sie in fast allen Kapiteln als überaus wichtig, erwähnt. Derart allgemein und überaus wichtig ist sie, dass sie unabdingbar ist, wenn die Musik eine reelle Wirkung haben soll, sowohl in Bezug auf unser äusseres Aufnahmeorgan, das Ohr, als auch in Bezug auf unser inneres Aufnahmeorgan, das Herz oder das Gemüt. – Und dennoch wird sie von so manchem vorerst gar nicht als Bedingung empfunden und erkannt. Es ist die Stille – die Ruhe auch, als Stille des Gemütes. Sie erst gibt den Raum, in welchem die Musik wirkt. Ja sie wirkt selber in und mit der Musik, erhöht deren Aussagekraft und belebt deren Wirkung auf unser Gemüt.
Sie kann das auf vielerlei Arten tun. Einmal, indem sie beim Solo – dem einzeln und alleine gespielten Instrument (z.B. in der Kadenz) – stets zwischen den Tönen oder Melodieabschnitten hervorleuchtet, oder indem sie ein, zwei oder gar drei zaghafte Stimmen umschliesst und sie dadurch noch augenfälliger eint, als es die Harmonie der Töne zu tun vermag. Ein andermal zerschneidet sie die laute Musik in Form einer abrupt beginnenden Pause in dramatischer Weise, wie es bei Verdis Musik oft vorkommt, oder die Musik verläuft sich in ihre Weite und verliert sich ganz, bis sie sich darin wieder zu sammeln beginnt zu einem neuen Impuls, der eine solche Pause beendet (beispielsweise in einigen Klavierkonzerten Beethovens oder im zweiten Satz von Mozarts Klarinettenkonzert KV 622). Immer aber ist die Stille der Raum, in welchem sich die Musik entfalten kann, ob sie aktiv mit einbezogen wird, indem man sie zwischen den Tönen "hört", oder nur passiv, indem sie die Töne voller sprechen lässt.
Vielleicht kommen uns nun die Gedanken des ersten Kapitels wieder in den Sinn, wo vom Raum-Geben durch demütig-andachtvolles Sich-Zurückziehen vom geliebten und geachteten Gegenstand die Rede war, welche Wesensart die Dinge, Erscheinungen und Einwirkungen auf unser Gemüt mächtig vergrössert und sie dadurch auch erst so ganz bis ins kleinste Detail erschliesst, so etwa, wie es das vergrösserte Abbild eines Gegenstandes auf der Fläche eines von einem Zentrum zurückweichenden Hohlspiegels zu tun vermag. Vielleicht sehen wir in unserer Erinnerung wieder den schwachen Lichtschein einer Kerze mit der Dunkelheit ringen und empfinden dadurch wieder die durch einen schwachen Ton belebte und gewandelte Stille, wie im Kapitel der Tonintensität beschrieben, die ein Leben und Regen ist, und in uns selbst eine Veränderung bewirkt, welche der Ton an und für sich nicht zuwege bringen kann, sondern nur als ein Verändertes aus dem Vorher-Gewesenen (eben der Stille).
So schön auch ein Ton auf einen vorhergehenden andern zu empfinden sein mag und sein kann, so unaussprechlich eindrucksvoller ist die sachte Erhebung eines Tones aus der Stille heraus zu erleben. Ein eindrückliches Erlebnis in dieser Hinsicht vermittelt uns der zweite Satz von Crusells zweitem Klarinettenkonzert, Op. 5, wohl am besten in der Einspielung mit dem English Chamber Orchestra unter der Leitung, von Sir Charles Groves mit Emma Johnson als Solistin. Die Dramatik dieses Geschehens, besonders zu Beginn – und als Kontrast zum ersten Satz – kann wohl mit gar keiner Tonvielfalt oder -lautstärke erreicht werden, sondern eben nur mit der scheinbar unendlichen Stille und den anfangs schwächsten Klangimpulsen der die Saiten zupfenden Streicher, dem Pochen des Herzens ähnlich, das sich auch nur in der Stille vernehmen lässt. Einzige Bedingung dazu ist, dass wir in uns selber die Stille und die Empfängnis fördernde Ruhe haben. Ein ähnliches, aber weniger starkes Beispiel haben wir auch in Haydns Abschiedssinfonie, wo die Stille ständig mehr zum Partner der noch verbleibenden Spieler wird und das klangliche Bild stetig in sich gediegener werden lässt, trotz der ständig abnehmenden Zahl der Musikanten – und im Gegensatz zum Anfang, wo viele Stimmen keine solche homogene Einheit zustande brachten.
Ferner erleben wir ausgerechnet im Kapitel über den Vielklang zuerst die Entwicklung und Entfaltung eines nur einzigen Tones mit seinen in sich selbst mannigfachen Schwingungen, welche nur in absoluter Stille erkennbar werden. Wir könnten dabei sogar versucht sein zu sagen, dass ein einzelner Ton ein Vielklang, sicher aber ein Zweiklang, mit der Stille zusammen, sei. Denn in einem üblichen Vielklang, also einem Akkord, hören wir natürlich die vielen sich ergebenden Tonschwingungen aus nur einem einzigen Tone nicht mehr.
Also wird bei diesen Betrachtungen ausgerechnet die Stille zum zentralen Punkt des Musikerlebens. Das soll uns trotz des scheinbaren Widerspruches nicht stören! Denn die Stille als Ruhe ist an und für sich überhaupt ein Reagenz (ein Anzeiger) für Vieles. Wie viele Menschen gibt es nur, welche die Stille nicht aushalten, weil sie ihrem Gewissen einen zu grossen Einfluss auf ihr Gemüt überlassen würde, oder weil sie die innere Leerheit zu ausgeprägt offenbaren würde. In der Stille auch wird es sich zeigen, wo der wahre Reichtum liegt, – innerhalb, oder ausserhalb des Menschen. Während sie bei Reichen an Geld, Ruhm und Ehre, an Bekanntschaften und an äusserem Wissen und Tun das Gefühl von Verlassenheit, Einsamkeit und dadurch äusserster Armut hervorruft, so gewährt sie dem Armen an äusseren Eindrücken und äussern Werten den Reichtum grösstmöglicher, weil ungestörter, innerer Entfaltung, und zeigt damit wieder – wie im Kapitel über den Vielklang an einem Beispiel anschaulich gezeigt – , dass der wahre Reichtum nur innerlich, geistig, sein kann, weil ja äusserlicher Reichtum sozusagen nur Reichtum auf Kredit ist, den wir so lange erhalten, als wir unsern – zum Äussern gehörenden – Leib mit allen seinen manchmaligen Gebrechen tragen und ertragen.
Also ist die Stille der zentrale Punkt, der Prüfstein, nicht nur des Tones oder der ganzen Musik, sondern auch des Gemütes und damit des ganzen Menschen überhaupt.
Auf alle in den vorhergehenden Kapiteln enthaltenen Aussagen würde ein jeder selber stossen, wenn er genügend Zeit (= Stille) dafür in Anspruch nähme. Die Erkenntnisse aus allen diesen Aussagen brauchen keine wissenschaftlichen Vorrichtungen zu ihrem Auffinden, keiner Vorkenntnis und keiner weitern Aufwendungen als der Musik selbst. Im extremsten Fall (beim Vielklang) setzen sie die Kenntnis über die Töne und ihre Anordnung innerhalb der Tonleiter voraus.
Mit all den in diesem Buche enthaltenen Worten aber wurde anderseits ein Äusseres geschaffen, welches als solches – aus dem Zusammenhange gerissen – Gefahr läuft, falsch und damit unwahr zu werden durch falsche Aufnahme beim Lesenden. Denn die Worte sind nun einmal gegeben und es kann sie jeder nach seinem eigenen Gutdünken gebrauchen, und sie damit falsch oder richtig – d.h. im Sinne der damit gewollten Aussage – aufnehmen und anwenden. Darin liegt stets die Gefahr beim Äusseren! Wir haben das am Beispiel des früh verstorbenen Familienvaters im Kapitel über den Vielklang eingehend erleben können. Alles, was dabei nicht gesagt ist, ist zwar in sich selber wohl noch intakt, bleibt aber dennoch unausgesprochene Bedingung des Ausgesprochenen oder Gesagten. Wer mit Herzenswärme und Gefühl lesen kann, der erahnt das nicht Gesagte auf die seinem eigenen Wesen entsprechende Weise und kann somit das hier hinausgestellte Gesagte wieder einbetten in seine innere, durch viele Erfahrungen bereinigte Wesenhaftigkeit des Gemütes, und ist dadurch bereichert. Ausschliesslich nur mit dem Verstande gelesen, wird das Gesagte wohl ebenfalls erkannt und grösstenteils als richtig anerkannt werden, aber die Anwendung, und damit die Bereicherung, wird problematisch bleiben, weil dem Hinausgestellten, und damit ausgeprägt Gesagten ein viel weniger ausgeprägt empfindendes Gefühl gegenübersteht, welches die Kanten des Ausgeprägten viel weniger zu umschliessen und dadurch in sich aufzunehmen vermag. Die dabei entstehenden "Hohlräume" aber ergeben dann die Widersprüche, welche so lange bleiben, bis entweder vom aufgefassten Gesagten die Kanten durch Gefühlsanstrengungen dem eigenen Gemüte entsprechend umgestaltet, erweicht und wiederbelebt werden, oder das Gemüt die Kraft seiner Umschliessung bei der Aufnahme, durch eine grössere Differenziertheit des Gefühles, erhöht hat.
Um dem in den vorhergehenden Kapiteln Gesagten also die Kanten etwas zu nehmen dadurch, dass wir das Absolute der Aussage als im Gemüte eines Menschen erlebt darstellen, sollen nun noch drei Kurzgeschichten angefügt sein, welche die Empfindung mehr als das eigentliche Verständnis anregen, und so vielleicht eher als genaue Begründungen das mögliche Erlebnis der Töne vermitteln können. Deshalb darf sich dann aber bei den ersten beiden Geschichten auch nicht die Frage erheben, um welche musikalischen Stücke es geht, denn wir wollen uns daran erinnern, dass eine und dieselbe Blüte derart viele schöne und absolut richtige Bilder in den verschiedenen Gemütern erwecken kann, sodass wir von der Beschreibung eines Bildes (Musikerlebnisses) nicht unbedingt auf die Blüte (Musikstück) schliessen können, umso mehr, als dieselben Bilder auch von anderen Erscheinungen – als Blüten – ausgehend sich zu bilden vermögen.
Einzig dieser Hinweis sei angebracht: dass vor allem in der zweiten und dritten Geschichte der Weg aufgezeigt enthalten ist, wie der noch so grosse, innere Reichtum beinahe spurlos verfliessen kann, wenn er an eine grosse Öffentlichkeit (= Äusserlichkeit) gegeben wird, von welcher nichts mehr zurückfliesst, weil das im Veräusserten Erstarrte nur ganz selten beim Hörer wieder verinnerlicht und damit belebt wird. Wie ungemein schön und reichhaltig das Leben sein könnte – einerseits mit seiner Spannung des Erlebens und Erkennens, und seiner Entspannung anderseits durch die dem Erlebten und Erkannten folgende, nachgelebte Tat –, das kann der Rede des Bassisten in der letzten Kurzgeschichte ebenso entnommen werden, wie der grosse (innere) Wert der reinen Kunst, welche demütiges Dienen zur Grundlage haben muss, um wirklich wertvoll zu sein. Wie erwärmend und aufbauend wäre doch die Kunst, würde sie wieder mit diesen längst ausser Kurs gekommenen Charaktereigenschaften betrieben! Es bliebe dann das "richtige" – oder eigentliche und eigene – Leben jedes Einzelnen zwar noch immer eine Kunst, aber in der Kunst zeigte sich dafür dann auch das Bild wahren, weil innern Lebens!
nach oben
INTERMEZZO SINFONICO  Erst als es stille wurde im grossen Konzertsaale, da kehrte auch in das Gemüt der 18-jährigen Seminaristin jene Ruhe und Ausgeglichenheit wieder, die sie seit ihrer frühern Jugend kannte, auch schätzte und sich ihrer deshalb so oft als möglich befleissigte. Es war zwar nicht verwunderlich, dass sie voll gespannter Erwartung in diesen Konzertsaal eingetreten war, umso mehr, als sie zum ersten Male ein Konzert besuchte; und sie hätte auch dieses nicht besucht, wenn nicht ihr Onkel sie dazu eingeladen hätte. Aber das gab ihr nun zu denken, dass sie nun, wo alles ruhig wurde und die Spannung im Saale zu wachsen schien – was sie wohl verspürte –, dass sie also nun, gerade in diesem für alle andern so spannenden Augenblick so ausgeglichen und völlig entspannt wurde, ohne dass sie in sich selber irgendeinen Grund dafür fand. Dabei überlegte sie sich, ob wohl der viele ungewohnte Lärm, die vielen äussern Bewegungen der unzähligen Besucher jene Ablenkungen waren, die sie in Spannung hielten und nicht die Erwartung der nun folgenden Musik. Und sie spürte deutlich in ihrer Erinnerung, wie tatsächlich all diese ungewohnte Äusserlichkeit an ihr riss und nagte und wie sie dagegen die bevorstehende Musik als eine ihr wesensverwandte, harmonisch entwickelte Bewegung erwartete, obwohl sie ja die auf dem Programm stehenden Stücke nicht kannte.
Sie war eine, die Musik in sich selber hatte, oder doch oft wie Musik empfand, wenn sie erregt wurde oder sich selber erregte in ihrem Gemüte. Und die äussere Musik, die sie bis anhin zumeist aus dem Radio ihrer einfachen Eltern gehört hatte, war ihr zu sehr diesem vorigen Gefummel in dem Konzertsaale ähnlich, als dass sie sie in sich als eine bewegende und verändernde Kraft ansehen konnte. Aber gerade das war ja ihre Vorstellung von der Kunst – in allen ihren Sparten –, dass sie die Aufgabe habe, den Menschen in seinem Innersten zu bewegen, ohne zu verletzen; ihn vielmehr zu verändern zum Guten hin, indem sie durch ihre Erlebniskraft Dinge oder Bilder in ihm offenbar werden liesse, welche ihn zu einem grösseren Verständnis führen, das er nicht so leicht erreichen würde, würde er nicht eben durch die bewegende Kraft der Kunst zu solchen Erkenntnisbildern angeregt.
Nun sass sie da und spürte die Erwartung der andern und dieser gegenüber die volle Ausgeglichenheit ihres jugendlich frischen Gemütes. Und sie dachte weiter, dass gerade eben diese Ruhe erst der Grund oder die Voraussetzung dafür ist, dass man sich durch die bewegende Kraft der Kunst etwas geben lassen kann, indem in der Ruhe die eigenen Bewegungen des Gemütes verdeutlicht hervortreten würden und im Zusammenspiel mit den von aussen injizierten Bewegungsabläufen neue Verhältnisse schaffen könnten, etwa so, wie wenn zwei verschiedene Menschen über denselben Gegenstand nachdächten und zufolge ihres eigenen – vom Andern jedoch verschiedenen – Wesens auch ganz verschiedene Bilder oder Essenzen aus dem gemeinsam betrachteten Gegenstand aufnehmen, welche aber dennoch in einem harmonischen Verhältnis zueinander stehen können. Bei einem Vergleich der Gedanken – nach vorherigem Austausch ihrer Inhalte – erfahre man dann die Bereicherung durch eine erweiterte Sicht der Dinge einerseits und durch das Erkennen des Wesens seines Gegenübers anderseits.
So tief dachte das Mädchen nach und es empfand die nun eingetretene Stille als einen solchen von ihm vorhin gedachten Gegenstand, den es selber ganz anders empfand und betrachtete als das übrige Publikum, sodass es in freudiger Erwartung der sich bald offenbarenden Gedanken des Komponisten und der Musiker harrte, welche beide doch ihrerseits ebenso diese Stille dazu benutzten, ihre Bilder und Vorstellungen zu verdeutlichen, um sie dann mit den Tönen der Musik malen zu können.
Nun hob der Dirigent seinen Stab zum Zeichen des Beginnes, und das Mädchen empfand schon bei diesem kleinen Akt wieder die äussere Bewegung als eine Einengung seiner innern Welt und schaute vor sich hin, das Orchester geflissentlich übersehend, in der Erwartung, dass der nun zu Worte kommende Komponist nicht auch nur eine äussere Bewegung zu vollführen beabsichtigte, wie es von vielen am Radio gehörten Komponisten gewohnt war.
Und richtig, da die ersten Töne als harmonische Akkorde aus der Stille sich zu erheben begannen und in ihren Tiefen eine mütterlich anmutende Besorgtheit mitschwingen liessen, da erlebte die junge Zuhörerin das Wesen der Liebe in den vernommenen Klängen und freute sich darüber, wie die anfangs tiefern Töne zu immer höheren und bestimmteren Melodienbildern fanden, sodass der Zuhörer, gleichsam schwebend, eine unerhört reichhaltige Landschaft zu überschauen bekam, in welcher die tiefen, trostvoll mütterlichen Töne als eine einzige, tiefste und innerste Woge überall enthalten war, sodass sich im Gemüt des Mädchens unweigerlich das Verhältnis der Liebe zu all dem geschaffenen Äussern darzustellen begann, sodass es erkannte, dass nur die fortwährende Liebe stets Neues schafft und erzeugt und das Geschaffene erhält, indem sie es umsorgt und bei ihm weilt, es zeitigt und ausreift, wie eine wirkliche irdische Mutter aus dem tief bewegten Lallen ihres Kindes im Laufe der Entwicklung stets schönere, gediegenere und höhere Gedanken formt, sie sich erkennen und schliesslich aussprechen lässt und so eine Anmut um die andere ihrem umsorgten Lieblinge entlockt. Selig war es, diese Erkenntnis nicht nur einzusehen oder auf sie erst zu kommen, sondern sie fühlend zu erleben – ja, stets erkenntnisreicher mitzufühlen in einem jeden Tone dieser Musik.
Unter diesen Gedanken und den sie erzeugenden Tonreihenfolgen entstand mittlerweile ein grosses Bild in seinem Gemüte, welches die Uferlinie eines Strandes zum Mittelpunkt hatte und das Mädchen empfand deutlich die Trennung des festen und gediegenen Landes vom fliessend bewegenden Wellengang des Wassers und es stand dabei am Ufer, wie an einem Scheidewege und konnte in der Not seiner Entscheidung kaum erwägen, zu was sich nun seine Liebe neigte: zu den klaren aber mehrheitlich starren Formen des Landes oder der sanft bewegten und bewegenden Kraft des Wassers, welches licht und hell das Licht der Sonne in sich aufnahm und dennoch auch wiederzuspiegeln vermochte. Immer schöner und bestimmter malten die Töne diese herrliche Landschaft im Gemüte der Zuhörerin, aber auch stets deutlicher empfand das Mädchen die Not der Entscheidung. Der Unterschied der Gediegenheit der Melodie zu der nur gefühlsmässig erfassbaren Bewegung der Untertöne liessen die Gegensätzlichkeit der beiden Welten – des Landes und des Wassers – derart deutlich werden, dass es sich selbst zu sehen glaubte an dieser Uferlinie und seine senkrechte Gestalt ihm dabei vorkam wie das Ausrufezeichen zu der in ihm selbst aufgeworfenen, gewichtigen Frage. Es stand zwischen zwei Welten und spürte die Lockung einer jeden auf sein Gemüt und konnte doch unmöglich entscheiden, zu was es sich entschliessen soll. – Nicht die Musik erst stellte ihm diese Frage, es kannte sie schon lange; nur diese Deutlichkeit vermochte es ohne diese Musik nie so zu empfinden.
Es sah in sich das Wohldienliche der äussern Formen, die alleine es dem Menschen ermöglichen, auf Erden zu weilen, indem er doch eine Unterlage zum Stehen und Gehen braucht, auch einen Stein, auf den er sich setzen kann, selbst die Form seines Leibes, seine Arme beispielsweise, die alleine es ihm gestatten, etwas Angenehmes zu ergreifen und es hin, zu sich zu führen und an seine Brust zu drücken. Aber es sah anderseits, wie das formlose und flüchtig erscheinende Wasser vom Lichte stets mehr erhellt wurde, als alle festen Formen und Gegenstände. Dabei spürte es, wie alleine das Wasser fähig ist, sich allem mitzuteilen, sich jedem zu geben, und wie alle Formen nur aus und mit dem Wasser sich zu bilden befähigt wurden. Es sah im Wasser die Liebe einer Mutter und in der Form des Landes das Kind, welches aus der puren Liebe der Mutter geformt werden konnte, und überlegte dabei, dass das so wohlgeformte Kind erst zu jener Mutter werden konnte die wieder aus und mit der formlosen Liebe ein neues Kind zu formen fähig war.
Diese Gedanken alle flossen so schnelle, dass sie ihm nicht so detailliert, wie hier beschrieben, erschienen, aber in seinem Erkennen waren sie klarer, als sie sich hier beschreiben lassen, trotz der immensen Schnelligkeit, die sie im Entstehen, Sich-Formieren und im Sich-Vereinigen mit wieder neuen, anderen Gedanken hatten.
Als nun fast unbemerkt die weichen, unbestimmten Intervalle der tiefen Töne sich zur Melodie zu bilden begannen und die höhern Töne in ziehenden Intervallen dahin zu strömen begannen, verspürte das Mädchen einen leichten Wind von der Wasserseite seines Gemütsbildes über es hinweg streichen, hin zum Ufer; und in einer grossen Aufwallung seines Gemütes entschied es sich plötzlich für das Wesen des Wassers.
So viel Liebe, soviel Bewegung erfrischender und belebender Kraft konnte nur im Wesen des formlosen Wassers sein, und nicht in den festen Formen des Landes, die oft hart an einen stossen, wenn man sie beim Gehen nicht genügend beachtet. Und wie von der Wasserseite her besah es in sich die Formen des Ufers und sah, wie der Wind die Wipfel der Bäume schaukelte und wie er jedes Blättchen küssend bewegte, während es selber, ohne es zu merken, den kleinen Kreiselformen der Melodie lauschte, die sich aus dem leichten Flug der hohen Töne abhob.
Und wieder wusste es nicht, ob seine Entscheidung richtig war. Wie konnte doch die Form so effektvoll das Wesen des Formlosen verdeutlichen und für was ist denn die formlose Kraft da, wenn nicht zum Formen, um dadurch erst zu verdeutlichen und zu erkennen das eigene Wesen dieser Kraft?! Und wieder stand es näher dem Ufer, gerade eben nun, da die Musik, alle Formen verlassend, zu einem sanft fliessenden Druck zu einem Endpunkt hin sich steigerte, und es kehrte sein Gesicht – ja sein ganzes Wesen kehrte es erneut dem Wasser zu und erkannte die Unmöglichkeit der Entscheidung. – Aber mit dem Nachlassen dieser musikalischen Bewegung, die dennoch nicht den Endpunkt erreichte, erkannte es auch die Notwendigkeit von beidem wieder deutlicher. Es wollte am Ufer verweilen, nicht Wasser und nicht Land sein. Das Land zwar bewundernd, wie die Werke Gottes, aber das Wasser liebend, wie die Liebe Gottes oder wie Gott in seinem Wesen, der Liebe, selbst. Das war es, was es wollte! Es erkannte dabei die Notwendigkeit seiner äussern Ausbildung aber es liebte die innere Ausbildung des Gemütes, wie es sie von seinen einfachen Eltern erhalten hatte. Es wollte ganz der Liebe dienen und alles aus der Kraft der Liebe tun, aber wollte die Formen nicht unberücksichtigt lassen, sondern sie einbeziehen, wohl erkennend, dass sie ihm dann nicht wehe tun, so wenig, wie die härteste Form dem Wasser oder dem Winde wehe tun kann, der an sie stösst und sie umfliesst.
Und wie es das so dachte, kamen dieselben Musikstellen in abgeschwächter Form, als Wiederholung, erneut vor seine Ohren, und es empfand sie, wie ein Abglanz des Lichtes, wie ein Echo oder eine Erinnerung; und diese zarten Töne der Erinnerung belebten es ungemein – ja, je sachter, sanfter und zarter sie an sein Ohr drangen, desto tiefer erregte es sich selbst in sich in wahrer Dankbarkeit für das Gute, das sie vorhin, in ihrer lauten Stärke, in ihm bewirkten durch den Kampf der Entscheidung, die sie in ihm entfachten.
Durch dieses Erlebnis sind sie gleichsam seine eigenen geworden und der äussere Ton, als Erinnerung, bewirkte nun die Seligkeit des Wiedererkennens und der Dankbarkeit. Es empfand nun die Erkenntnis als Not und das Wiedererkennen, das in der Erinnerung liegt, als Seligkeit. Es sah das Äussere und die Form als Erkenntnis, als Notwendigkeit und Not und das Innere als den ewigen Frieden der Liebe, in welchem alle Not ein Ende findet – zwar wohl erhalten bleibt, aber ohne eigene Wirkung, nur als Bereicherung und Stärkung dieses Friedens.
12.6.88
nach oben
DER VIRTUOSE  Es begab sich einmal, dass in einem kleinern und vom Tourismus noch eher verschonten, ja beinahe verträumten Ferienort ein Geigenvirtuose sich einfand, welcher die schöne, unberührte und beinahe märchenhaft gestaltete Landschaft dazu brauchte, sich von den Anstrengungen seiner Konzerttätigkeit zu erholen und seine Gemütskräfte von neuem zu sammeln und zu stärken.
Bei dieser Gelegenheit machte er auch die Bekanntschaft des Dirigenten des dortigen Kur-Orchesters, welcher ihm mit grosser Achtung begegnete, und es entspannen sich anregende Gespräche über Musik, deren Sinn und deren Wirkung bei den Musikanten selbst, wie bei den Zuhörern. Und weil die beiden so anregend, so tief gefasst und stets übereinstimmender miteinander reden konnten, so drängte sich der Gedanke, einmal zusammen zu spielen, geradezu auf, und sie beschlossen, das Violinkonzert von Beethoven aufzuführen.
Die Premiere fiel auf einen Tag zwischen dem Weihnachts- und Neujahrsfeste und der Saal war bis zu hinterst voll – und zwar mit Kurgästen sowie mit Einheimischen.
Als nach der Aufführung der Applaus kaum enden wollte, trat der Virtuose auf das Podium und spielte eine "Dreingabe". Es war ein äusserst schwierig zu spielendes Stück, das eine verwirrende Vielfalt von äusserst kurzen Noten oder Tönen enthielt, und welches geeignet war, die Fertigkeit oder Virtuosität so richtig zu zeigen. Als aber am Ende der Applaus nur mässig ausfiel und fast nur von der einen Hälfte des Saales kam, da wartete der Virtuose ohne Verneigung das Ende des Applauses ab und begann dann – was sonst gar nicht üblich, ja kaum je geschah – zum Publikum zu sprechen. Dabei erklärte er ihm, dass es ihm, dem viel bewunderten Virtuosen gefalle, dass dieses Publikum so ehrlich sei, und mit dem Applaus spare für ein so nichts sagendes, oberflächliches Stück, welches nur die Fähigkeiten des Interpreten zur Schau stellen wolle, und sonst nichts weiteres. Es sei das aber für gewöhnlich der einzige Wunsch des Publikums eines grossen Konzertsaales, ein möglichst übermenschliches Können anzustaunen, oder gewisserart einen Wettbewerb zu erleben, wer sich am meisten überbieten könne in der absolut nichts aussagenden und nichts bedeutenden Fingerfertigkeit. Er selber wisse zwar wohl, dass die Musik nicht dem Ehrgeizigen dienen sollte, sondern vor allem dem Herzen, damit es das oft niedergedrückte Gemüt wieder beleben könne. Aber wenn er früher jeweils aus diesem Grunde erhabene und einfache Weisen angestimmt habe, so habe er die Enttäuschung des Publikums jedes Mal zu spüren bekommen, sodass er von da an nur noch dasjenige gespielt habe, für das seine Zuhörer auch bezahlt hatten – dass er aber eben auch gerade darum öfters Aufenthalte in solchen Gegenden, wie dieser hier, brauche, um sich von seiner ihm aus diesem Grunde oft gar nicht gefallenden Arbeit erholen zu können.
Nun, da er heute aber so einfache, gemütvolle, und im Applausgeben überaus ehrliche Menschen gefunden habe, so wolle er ihnen gegenüber ebenso ehrlich sein, und ihnen das bieten, was ihm selber gefalle. Das Publikum könne nachher selber entscheiden, welche von den beiden "Dreingaben" seinem Geschmacke eher entspräche. Und er erhob seine Geige und begann zu spielen.
Mit einigen vollen Akkorden und schwungvollen Wendungen war er dabei von den tiefen über die mittleren bis zu den hohen Tönen gekommen, fuhr dann aber mit weich klingenden Tönen mittlerer Höhe in ruhig tragenden Weisen fort, gleichsam als würde er sich andächtig aus dem Saale begeben; steigerte dann sein Spiel, sowohl in der Höhenlage als auch in der Intensität des Tones, und entführte damit die ganze Zuhörerschaft des Saales in die herrlich lichtvolle Gegend seines Gemütsfeldes. Er entwickelte in der Thematik seines Spieles die herrlichsten Gedanken und führte die Zuhörer an Dissonanzen vorbei, über kleine Staccato-Erhebungen hinaus in ein leise schwingendes und gleichsam tragendes Spiel der Wolken, wo kein harter Ton, keine Dissonanz und kein Staccato, kurz keine wie immer geartete materielle Rührung mehr war, sondern nur Freiheit und hellstes Licht, welches er mit sichern Schwüngen, es gleichsam teilend, durchflog; und über den hin und wieder eingestrichenen kurzen Triolen schien sich dabei der Glanz dieses Lichtes ebenso zu spiegeln, wie die Sonne sich spiegelt auf der gekrausten Oberfläche des Wassers.
Und während diesem Spiel hoher und höchster, aber stets unaussprechlich reiner und weich formulierter Töne strich er manchmal auch die Saiten tieferer Töne, die sich erregend mit zu erheben begannen, bis dann viele tiefe und ruhig geführte Töne, als Resonanz auf das vorherige heitere, freie Spiel, gleichsam aufzuatmen begannen, wie das gefühlvolle Gemüt aufatmet bei längerer Betrachtung lichtvoll erklärender Bilder, sodass eine tiefe, ruhige Bewegung den ganzen Saal erfüllte, als würde dieser wonnetrunken die helle Schar der hohen Töne, sie bewillkommnend, in sich aufnehmen, so, wie die licht- und sonnenmüde warme Erde den Tau des Himmels; und würde – dadurch selber erquickt – zu seliger Ruhe kommen. Und die tiefe Stille der nun auftretenden Pausen zwischen den einzelnen Tonfolgen wirkte feierlich und majestätisch und vereinte sich am Ende mit der Ruhe, welche in den gespielten Weisen immer stärker spürbar wurde, sodass Ruhe und Bewegung in ein einziges Ganzes verschmolzen – dass Klang und Stille eines wurden, sich ergänzend, und nicht sich störend. Und wie in Erinnerung des Erlebten hoben sich nochmals sachte und leise feinste hohe Töne von der Tiefe der Gefühle ab, und schwebten wie das Licht in kleinen Fleckchen oder Konzentrationen über das tief empfundene Glück der jetzt vereint gestrichenen Saiten tiefer Töne. Und dieser grosse Raum zwischen den tiefen und den höchsten Tönen entzückte wieder so sehr, dass sich die Melodie von neuem der Tiefe entwinden musste und, dem Höchsten zustrebend, sich erhob, während – wie gerührt – sich die vorher hohen Einzel- oder Zwischentöne hernieder senkten, gleichsam die Tiefe von neuem befruchtend, und sich vereinigten mit ihr zu einer nie geahnten Fülle, die im Ausklang in die Stille erst ihren Höhepunkt erreichte und die Zuhörer aus ihrem wundersamen Erkennen und Staunen sanft weckte in die nun als äusserst nüchtern empfundene Wirklichkeit.
Es verstrich einige Zeit, bis der Applaus die Stille durchbrach, denn zu sehr ergriffen war jedermann. Und der Virtuose sagte mit ergreifend bestimmter Stimme "Solche Weisen erfordern nur wenig Arbeit, beleben und stärken aber ungemein und tragen das lebendige Gemüt über das Grab hinaus, wo die eitlen Fingerkünste im Moder schon längst vergangen sind. Das aber gibt nicht der Mensch aus sich heraus, sondern empfängt es von einem gütigen Vater im Himmel zum Weitergeben an seine Brüder und Schwestern.
22.2.87
nach oben
VOM APPLAUS  Beim Erstauftritt einer jungen Sopranistin in einem grossen Theater spielte sich am Ende eines Aktes eine äusserst eindrucksvolle Szene ab. Nicht erst nach, sondern bereits während des Verklingens der letzten Akkorde setzte ein stürmischer Beifall ein, mit einer Begeisterung vorgetragen wie nur seltene Male. Laute Rufe und nicht enden wollendes Klatschen zeichnete den soeben zu Ende gegangenen Auftritt der Sopranistin – mit einem Bassisten zusammen – als einen ganz besonderen aus. Und jedermann empfand dabei, und wusste eigentlich auch, dass damit dieser jungen Sängerin der Einstieg in die Welt der grossen Opernhäuser gelungen war. Zu begeistert aber war jedermann, als dass er so schnell mit seinem Beifall aufhören wollte. Vielmehr wollte ein jeder sein Gefallen noch vorzüglicher ausdrücken, um den gelungenen Erfolg der jungen Künstlerin noch drastischer herauszustreichen, bis endlich eine etwas ungewöhnliche Handlung den Applaus doch zu mildern begann und endlich ganz verstummen liess:
Der Bassist nahm nämlich nach einer der schon zahllosen Verbeugungen die Sopranistin in seinen Arm und zog sie zu sich an seine Brust, während er mit seiner Rechten den Applaus mit einer Geste abzuwehren schien. Als es ob der Überraschung, welche diese Handlungsweise verursachte, ruhiger und stiller wurde im grossen Saale, da begann der Bassist mit seiner tiefen Stimme eine sehr denkwürdige Rede, indem er sagte, dass er seine etwas un-gewöhnliche Handlungsweise zuerst dadurch erklären müsse, dass er das Verhältnis zwischen ihm und der Sopranistin offen legen wolle. Die nun mit so starkem Beifall bedachte junge Künstlerin sei nämlich seine Tochter, welche nicht nur vom Publikum geliebt werde, sondern vor allem auch von ihm selber, und welche auch ihn wieder liebe, was doch das Publikum daraus ersehen möge, wie gerne sie sich habe hinziehen lassen an seine Vaterbrust und wie wohl und gelöst sie sich nun doch augenscheinlich bei ihm fühle.
Es sei ein eigenes Verhältnis zwischen Künstler und Publikum, so fuhr er fort, indem man sage, dass der Künstler vom Beifall lebe und umgekehrt, das Publikum von der Kunst. Aber, gab er zu bedenken, es sei nicht ganz so einfach, einem so grossen Begeisterungssturm standzuhalten, ohne dass man mit der Zeit nicht eingebildet und überheblich werde. Solche Begeisterungsstürme seien – wie alle Stürme – oft verheerend und zerträten das Fein- und Zartgefühl im Menschen. Denn alles, was vor der Welt gross sei, sei innen zumeist hohl und leer. Wohl liebe der gute Künstler die Kunst und darin das Wahre und Gute, aber das Publikum liebe sehr oft in dieser Kunst nur die Unterhaltung. Es eifere dann mit seinem Beifall den Künstler wohl an, aber nicht zum Guten, sondern nur zur Unterhaltung seiner selbst, während doch das Ziel der Kunst sei – und bleiben müsse –, den Menschen zu vervollkommnen, ihn weiter zu führen in stets höhere Sphären und sich dabei zu vertiefen in sein Innerstes, um dieses umzugestalten nach den hohen und schönen Richtlinien der wahren Kunst und damit das ganze Wesen durchströmen zu lassen von der Wärme der Liebe zu dieser Kunst, welche trachte oder trachten müsse, der Wahrheit nahe zu kommen, – ja, die grosse Wahrheit in sich selber zu finden, um ihr ganz alleine leben zu können.
Das aber müsse nicht nur beim Künstler, als einem Solisten, und nicht nur bei der Ausübung seiner Kunst geschehen, sondern vor allem auch beim Publikum, welches gewisserart das Orchester darstelle, welches die hohen und höchsten vorgetragenen Wahrheiten und Weisheiten des Solisten in der Kunst auf die ihm mögliche Art aufnehme und in seiner ihm eigenen Weise wiedergebe und dergestalt erst das Ganze abrunde zu einem erhabenen und umfassenden Kunstwerke, das überall und in eines jeden Menschen Herzen das Gute fördere, indem es das Falsche beleuchte, erkenne und in Gutes, Wahres und Richtiges verkehre.
"Wenn Ihr alle nun so begeistert seid und auch angesprochen von der Kunst meiner lieben Tochter, " so fuhr er mahnend fort, "so müsst ihr die Kraft eurer begreiflichen Begeisterung nicht in einem grossen aber leeren Schall des Applauses vergeuden, sondern diese nun angefachte Kraft müsst ihr sorgsam in eurem Innern verwahren und mitnehmen in euer tägliches Leben, damit diese nun entbundene Kraft eurer Liebe und die Begeisterung eures ganzen Wesens euch dort – im alltäglichen Leben – zu grösseren und besseren Taten ansporne, und euch förmlich dazu dränge, eurerseits auch euren Mitmenschen euer Bestes zu geben. Eine solche, ins alltägliche Leben überführte Liebe und Begeisterung für alles Gute und Schöne bleibt dann lebendig fortwirkend in euch und überträgt sich durch eure dadurch geänderte Lebens- und Handlungsweise auch auf eure Mitmenschen. Wenn hingegen eure Gemütsbewegung und die daraus resultierende Kraft eures Gemütes sich im Applaus zu sehr Luft verschafft, so ist sie damit auch grösstenteils schon entschwunden und kann später in euch nichts Weiteres mehr bewirken, das euch und euren Nächsten zugute kommen kann.
Gedenket im Überschwang eurer Freude und Begeisterung aber auch stets des Künstlers, der zu seiner gedeihlichen Entwicklung zwar auch eine Anerkennung gebrauchen kann, der aber als Solist schon von seiner Stellung her versucht ist, sich besser oder wenigstens fortgeschrittener vorzukommen als das Publikum.
Wenn ihr aber schweigen könntet und würdet vor zu grosser Ergriffenheit der vorgetragenen Kunst, so würde das der feinfühlige Künstler gut und auch genauso sicher merken, und er könnte leicht erschauern, vor eurer grossen und unschuldigen Ergriffenheit und auch davor, was diese allenfalls in eurem ferneren Leben alles noch bewirken kann. Ja – dabei würde der Künstler plötzlich gewahr, dass er mit seinem Vortrage nur ein ganz wenig Schall erzeugt hätte, dass dieses Wenige aber in euch ganz gewaltig nachwirkt, und er könnte dabei doch nicht abschätzen, zu was für erhabenen Taten oder zu welch schönen Gedanken und zu welch demütig ehrfurchtsvollen Einsichten dieses Wenige euch – sein Publikum – zu bewegen vermag.
In dieser Weise wäre dann auch der Künstler durch eure in euch erwachte Liebe gedemütigt, indem er leicht ersieht, dass diese grosse Kraft in so vielen Herzen mehr bewirken kann, als er mit seiner Kunst alleine.
Und ihr, als das Publikum, erfahret eure Demütigung in der Erkenntnis, dass ihr den Solisten gebraucht habt, um auf so hohe, reine und schöne Gedanken zu kommen. – Wäre nicht das die einzig wahre und rechte Kunst, dass der Mensch sich an ihr ernüchtere und demütige und sich damit der Wahrheit und der wahren und reinen Liebe öffne, welche das Gute der Wahrheit mit beiden Händen erfasst und es durch Taten auch offenbar werden lässt im täglichen Leben? Ja, wenn ein Publikum dergestalt seiner Künstler gedenkt, so wird es sie auch belohnen, aber dabei nicht in Versuchung geraten lassen, und selber ebenfalls keine Versuchung erleiden, die erlebte Kunst als eine blosse Unterhaltung zu missbrauchen.
Für dies eine Mal, an diesem hoffentlich für uns alle denkwürdigen Abend habe ich zwar meinen väterlich schützenden Arm liebevoll um meine Tochter gelegt, um ihr und euch zugleich behilflich zu sein, das Richtige zu erkennen. – Und meine Tochter nimmt das auch gerne von mir an, sonst würde sie nun nicht vor Rührung weinen; aber viele gibt es, die nicht sichtbar und hörbar einen Vater bei sich haben, wenn sie ihren ersten oder auch nur ihren grossen Auftritt haben. Ihrer aller möget ihr, als Publikum, gedenken und euch in euren Handlungen meiner Vaterworte erinnern.
Aber auch jeder Einzelne aus euch allen ist in irgend einem Fache ein Meister oder Künstler. In dieser Eigenschaft wünsche ich einem jeden von euch, meinen geduldigen Zuhörern, von ganzem Herzen jene Verwahrung, die ich vor euren Augen meiner Tochter angedeihen liess, damit ihr frei bleibet von Falschem, und falscher Ruhm euch nicht verleite, sodass ihr selig werden könnt in der vollen Wahrheit und der durch sie gereinigten Liebe.
14.6.87
nach oben
NACHBEMERKUNG  Obwohl ich mich bemüht habe, durch das ganze Gebiet der Entsprechungserkenntnisse der Töne – welche die Wirkungsart und -weise auf das menschliche Gemüt erklären – mich einzig und alleine vom Kompass der unvoreingenommenen Wahrheitsliebe leiten zu lassen und mich von keiner Seite her binden zu lassen, bin ich nicht darum herum gekommen, die Liebe als die zentrale Kraft aller Dinge, Wesen und Erscheinungen zu erkennen. Jene Liebe, welche die heutigen Wissenschafter sich scheuen, als Faktum anzuerkennen und deshalb in der Psychologie so viele Umschreibungen dafür brauchen, wie: Zuneigung, Zärtlichkeit und Nestwärme, oder gar so absurde Worte dafür konstruiert haben wie "Streicheleinheiten", um nur endlich ein Mass für ihren messbegierigen Magen zu haben. Das aber wurde dabei nicht berücksichtigt, dass allen ihren stellvertretenden Ausdrücken ein absolut unabdingbares Prädikat der Liebe fehlt, nämlich der Ernst. Liebe ohne vollkommenen Lebensernst ist keine wahrhaftige Liebe, sondern Trieb – bestenfalls bedeutungsloses Geplänkel aus einem momentanen Bedürfnis nach Nähe, welches bei der nächstbesten Probe ins Nichts sich auflöst; etwa so, wie die von der christlichen Lehre geforderte Liebe zu Gott sich auflöst, wenn ihr handfeste, irdische Interessen entgegenstehen, sofern nicht zuvor die menschliche Trägheit – als eine Folge passabler äusserer Verhältnisse – die Fähigkeit, sich überhaupt für etwas zu erwärmen, jede Art von ernst gemeinter Liebe schon im Keime erstickt hat. Darum auch kann – umgekehrt – eine Liebe Gottes zu uns Menschen von uns nicht mehr empfunden werden, weil ihr beigesellter, alles erhaltender Ernst denn doch über unsere schalen Begriffe unserer bloss materialistischen Vorstellungen zu weit hinaus geht.
Wenn ich nun – eingedenk dieser Tatsachen – alles Geschehen wieder als auf das vielgestaltige Wirken dieser Kraft gegründet darstelle und zu erklären versuche, so scheint mir das ebenso wenig unwissenschaftlich zu sein, wie die Lehre Kopernikus es war, welche die Bewegung der Erde gegenüber dem ruhenden Pol der Sonne als gegeben darstellte, obwohl damals sowohl der (blinde) Glaube als auch das natürliche Scheinbild eine andere Anschauung forderte. Fordert doch anderseits der heutige Glaube an die Wissenschaft nicht nur, dass wir ihre stets sich verändernden Aussagen als für alle Zeiten gültig und bewiesen anzunehmen haben, sondern oftmals so obskure Aussagen anzunehmen wie es die Evolutionstheorie Darwins darstellt, welche in allen Teilen widerlegbar ist. Etwas überspitzt formuliert besagt sie, dass der blinde, in der Erde bohrende Wurm einmal zur Erkenntnis gekommen sein musste, dass es über dem von ihm bevorzugten Tätigkeitsfeld ein weites und lichtvolles Gebiet gäbe und dass zur Nutzung desselben durch seine späteren Nachkommen das Augenlicht gut wäre und dazu auch Mittel und Wege fand, schon seinen "nächst höheren Verwandten" ein Auge zu konstruieren, das nicht nur alle ihm bis dahin doch völlig verborgen gebliebenen optischen Gesetze völlig richtig ausnutzt und anwendet, sondern erst noch aus dem Lichte die elektrische Energie gewinnt, welche via Nervenbahnen seinem Gehirn die durch das Auge empfangenen Sinneseindrücke zu vermitteln imstande ist. Er – der Wurm in der Nacht der Erde – hat also etwas bildlich ausgedrückt einen Weg gefunden, elektrische Energie aus dem Sonnenlicht zu gewinnen, und hat es deshalb nicht nötig gehabt, für den Zweck der Stromerzeugung Atomkerne zu zerstören, deren gefährlich strahlende Resten dann wieder ihn selbst zerstört hätten, lange bevor sein Ziel erreicht gewesen wäre. Aus diesem Grunde hat man bei den wissenschaftlichen Erklärungsversuchen zur Entstehung des menschlichen Lebens dann die Mutation (eine zufällige unerklärbare Veränderung der Wesensmerkmale) als Grund für den Formenreichtum allen Lebens angenommen, der am Ende durch die Auslese bis zum Menschen geführt habe (Neodarwinismus).
So absurd es wäre, zu behaupten, dass sich eine Weltraumsonde mitsamt ihrer Trägerrakete aus den Mineralien entwickelt hat, die sie enthält, und ihre Intelligenz, mit der sie ihre Ziele ansteuert und das Aussehen solcher Ziele optisch sogar festhalten kann, um diese Bilder zur Erde zu übermitteln, aus eben diesen Mineralien in ewig langen Zeitläufen evolviert sei – und das ebenso wie die ganze Gliederung ihres materiellen Inhaltes auch, so absurd ist es auch, zu behaupten, dass sich der Mensch mitsamt seinem unglaublich kunstvoll eingerichteten Leib selbst entwickelt habe – entweder durch die Erkenntnisgewinne seiner Vorstufen oder gar durch völlig blinde Zufallsveränderungen (Mutationen) eines ursprünglich allerprimitivsten Ausgangsorganismus, wie beispielsweise der eines Wurmes oder gar einer einzelligen Alge. Und dennoch werden heute die meisten Bücher so geschrieben, als wäre es mit Bestimmtheit so gewesen!!
Es ist jede Ansicht über den Grund aller Dinge bloss ein Glaube, denn Beweise gibt es keine! Aber wohl sollte man meinen, dass es ein lichtvollerer Glaube ist, anzunehmen, dass eine Intelligenz nach und nach stets höher entwickelte Wesen erschafft, um durch sie der in alle Materie gebannten Kraft stufenweise ein immer stärkeres Freiwerden und sich selbst Bewusstwerden zu ermöglichen – gerade so, wie die Menschen aus unzähligen Vorfabrikaten ein hoch kompliziertes und leistungsfähiges Produkt herstellen, als anzunehmen, dass dem Staub der Erde plötzlich eingefallen sei, sich – etwa als Wurm – ordnend zu einem Wesen zu ergreifen.
Wer den Darlegungen in den einzelnen Kapiteln unvoreingenommen zu folgen vermag, wird darin kaum Widersprüche oder Ungereimtheiten finden, und schon gar nicht im vorher aufgezeigten Ausmass. Und der Gedanke an eine dennoch vorhandene Intelligenz, deren Wesen Liebe und Erhaltung ist, wird ihn eher erwärmen und erfreuen und sein Gemüt erheitern können als die absurde Vorstellung, dass aus der Erstarrung der Materie sich am Ende dennoch ein Leben von selber entwickeln könnte oder gar würde.
Dass darin die Gravitation (Erdanziehungskraft) wie die Kohäsions- und die Magnetkraft alle als Formen ein und derselben Liebekraft dargestellt sind, wird den vorurteilsfreien Leser nicht beirren, wenn er bedenkt, dass schon die Geschlechtssporen einer primitivsten, gegliederten Algenart ihre entsprechenden weiblichen Partner auch in der Dunkelheit des tiefsten Meeres finden – ebenso, wie ein Atom eines Elementes das andere durch die Kraft der Kohäsion. Zudem ist sogar die Wissenschaft nicht mehr weit davon entfernt, all die verschiedenartigen Kräfte als im Grunde nur eine einzige – lediglich in verschiedenen Formen auftretende – beweisen zu können. Sollten wir uns dann darum streiten, wie sie heissen soll? Warum nicht das unserem Wesen verwandteste Wort "Liebe" nehmen, wenn doch der christliche Glaube lehrt, dass Gott Liebe sei, und alles, was gemacht ist, aus Gott – und seiner Liebe – gemacht sei.
FACHAUSDRÜCKE
| Akkord: | Sinnvolle Verbindung zweier oder mehrerer Töne zu einem Zusammenklang – ein Vielklang. |
| Sekunde : | Tonschritt (Intervall) 1 – 2 |
| Terz: | " " 1 – 3 | | Quarte: | " " 1 – 4 |
| Quinte: | " " 1 – 5 |
| Sexte: | " " 1 – 6 |
| Septime : | " " 1 – 7 |
| Oktave : | " " 1 – 8 |
| None: | " " 1 – 9 |
| Dezime : | " " 1 –10 |
| Dissonanz : | Disharmonischer Klang. In der Musiktheorie zwar festgelegte Intervalle, welche aber alle nur der subjektiven Empfindung wegen für dissonant erklärt werden. |
| Dominante: | Fünfte Stufe über dem Grundton (=1. Stufe) einer Tonart. |
| Subdominante: | Eigentlich fünfte Stufe unter dem Grundton einer Tonart. Diese Stufe aber ist einfach die vierte Stufe der untern Oktave. |
| Tonika: | Grundton einer Tonart. |
| Legato: | Gebundene Tonübergänge. |
| Staccato: | abgehackte Tonübergänge. |
| Polyphonie: | Musikart, in welcher jeder Stimme melodische Bedeutung zukommt. |
| Solo: | Einzelstimme. |
| Quartsextakkord: | Bedeutet im Sinne dieses Buches: ein Dreiklang, bestehend aus den beiden gleichzeitig erklingenden Tonschritten: Quarte (1-4) und Sexte (1-6), also 1-4-6, welche von "1" aus aufwärts oder abwärts vollzogen werden können. (In der Musiklehre wird nur der aufwärts vollzogene Schritt so genannt. Den abwärts vollzogenen Schritt nennt man dort einfach "Sektakkord" – auch wenn er die Quarte enthält.) |
| Sextdezimakkord: | Bedeutet im Sinne dieses Buches: ein Dreiklang, bestehend aus den beiden gleichzeitig erklingenden Tonschritten: Sexte (1-6) und Dezime (1-10), also 1-6-10, welche von "1" aus aufwärts oder abwärts vollzogen werden können. |
|