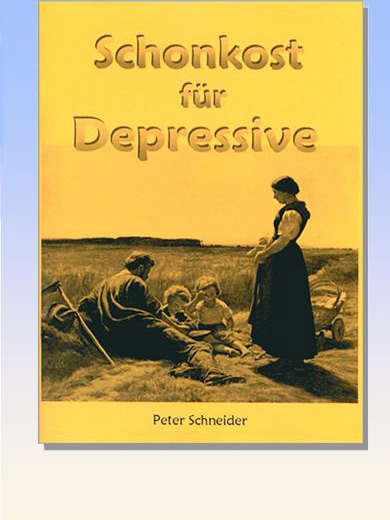Zum Verständnis über die folgenden Texte
Alles, was der Mensch von aussen her (über Worte) vernimmt, kann er glauben oder auch nicht glauben. Alles, was er hingegen selber erfahren hat, das weiss er bestimmt! Nur fragt es sich dabei, ob er es auch begreift, weshalb er etwas erfahren hat, das er nicht selber gesucht hat, zum Beispiel einen Unfall, eine Krankheit, eine Ausgrenzung oder ein inneres, seelisches Leiden. Ist seine Erfahrung gravierend, so bleibt er zumeist einsam, weil ihn alle andern Menschen ohne eine solche oder ähnliche Erfahrung gar nicht wirklich, das heisst in der ganzen Tiefe der Empfindung, verstehen können.
Es kann mit der Zeit zwar "Gras" über ein solch verwundendes Ereignis oder eine solche Erfahrung wachsen, aber für sich selbst bleibt die Erfahrung als etwas seinem Wesen Fremdes bestehen. Und schon ein kleines Vorkommnis ähnlicher Art reisst die Wunde – das Loch, das nicht zuwachsen will, sondern immer nur vom äussern Gang der Dinge leicht zugedeckt wird – wieder auf. Das ist eine Erfahrung, die viele schon gemacht haben und darum auch kennen. Nur ein jeder auf eine andere Art.
Die hier folgenden Texte sind so geschrieben, dass sie Menschen mit solchen Erfahrungen ansprechen. Wenn der Leser darauf achtet, wird er bald einmal merken, dass diese Texte ganz unvermerkt oder versteckt diese Wundnarbe durch ein aufkeimendes Verständnis und einer daraus hervorquellenden Hoffnung heilend zu beleben beginnen, wie eine wohltuende Salbe eine leibliche Wunde.
Gesunde spüren das viel weniger, denn wo keine Wunde vorhanden ist, da ist auch keine heilende Wirkung zu verspüren. Ob diese Texte einer tiefern Wahrheit entspringen, vermag nur derjenige zu beurteilen, den sie belebend berühren. Sie sind deshalb auch nur für ihn geschrieben – genau gleich, wie eine Wundsalbe auch nur für Verwundete hergestellt wird. – Und eine volle, das heisst innere, seelische Genesung wünsche ich allen, die sich ehrlich und vorzugsweise gerade darum bemühen.
|
|
HERZLICHE EINLADUNG ZU EINER UNBESCHWERTEN MAHLZEIT  Schonkost für Depressive sind Speisen für den Geist. Speisen für den Geist sind Worte oder Gedanken der Liebe und des Verständnisses, welche die Wahrheit innerer Verhältnisse offenbaren. Durch das Erkennen – wenn vielleicht vorerst auch nur ahnungsweise – werden wir in unserer Liebe gestärkt und dadurch freier und beweglicher. Unsere Liebe aber ist es alleine, die aufbaut – nicht etwa der Verstand. Denn dieser ist nur das Werkzeug oder der Handlanger dieser Liebe, damit sie im Äussern dasjenige verwirklichen kann, was sie in sich selber sehnlichst wünscht. Er ist aber auch das Instrument zum Erkennen der Richtung eines jeden Liebezuges und darum brauchbar zum Ordnen dieser mächtigen Lebenskraft in uns, die unser Wesen gar leicht und gar schnell – zum Guten, wie zum Schlechten – verändern kann.
Denn eine Kraft kann nur wirksam werden, wenn sie geordnet ist. Das gilt auch von der Liebe. Will sie zwei sich entgegenstrebenden Prinzipien dienen, um sie in sich zu vereinigen, so wird sie früher oder später in ihrer Kraft zerteilt und zerrissen und dadurch unwirksam, gewisserart in sich selber blockiert. Rafft sie auf der andern Seite in einseitig auf sich selbst und auf die Materie konzentrierter Gier (Egoismus) zu viel zusammen, so erliegt sie dem Druck, der auf ihr lastet, und erdrosselt sich damit selbst. In beiden Fällen verarmt sie mit der Zeit derart, dass sie als Kraft kaum mehr wahrzunehmen ist, wiewohl sie auf der andern Seite diese Schwäche äusserst schmerzlich verspürt, sodass ihre Ruhe dadurch aufgezehrt wird und sie kaum mehr etwas Wahrgenommenes in sich wirksam verarbeiten kann, weshalb dann alles drückend auf ihr lastet. Darum gilt es in Zeiten innerer und äusserer Not – und Depressionen zählen sicher dazu – vor allem, diese einzig wirksame Lebenskraft im Menschen wieder frei zu machen und neu zu ordnen.
Worte und Gedanken, die dies vermögen, wären also eine wahre Kost des Lebens für sie. Werden aber solche Worte zum Handlanger der Liebe – zum Verstande – gesprochen, so braucht dieser erstens seine Zeit, bis er sie zu fassen bekommt, und zweitens dreht und wendet er sie dabei in sich auf seine ihm eigene analytische Art und Weise, sodass sie dem Wesen des Herzens mit seiner geschwächten Liebe derart entfremdet werden, dass sie von ihm nicht mehr richtig wahrgenommen und darum auch nicht mehr direkt aufgenommen werden können. Und so braucht dann diese Liebe ihrerseits wieder längere Zeit und viel von ihrer ohnehin geschwächten Kraft, bis sie sich darin zurechtfinden kann. Das alles braucht also umso mehr Kraft, als die Kräfte des Verstandes ja ihrerseits auch nur wieder vom Herzen genährt werden. Darum gehört zum Wesen einer Schonkost, dass sie nicht erst vom Verstande mühsam zerkaut und begriffen werden muss, sondern dass sie so zubereitet ist, dass sie sich, ohne grosses Verständnis vorauszusetzen, direkt dem Herzen oder seiner Kraft der Liebe mitteilt, also gleichsam darin zerfliesst. Aber weil eine solche Speise die Verhältnisse der Liebe dabei auch ordnen helfen muss – weil ja eine ungeordnete Kraft nicht frei wirksam sein kann –, so muss diese Kost ganz rein sein, das heisst durchgängig und ausschliesslich nur ausgerichtet nach der höheren und darum allen dienenden Ordnung einer gereinigten Liebe, so wie sie als entsprechende Wahrheit auch in allen äussern Dingen und Geschehnissen zu finden ist.
Stehen wir beispielsweise mitten in einer Landschaft, so wird unsere Aufmerksamkeit von ungezählten Dingen in Anspruch genommen und wir wissen oft gar nicht, welchen von ihnen wir uns mit unserer Liebe zuwenden wollen. Stehen wir hingegen auf der Spitze eines Berges weit über der Landschaft, so ergibt sich aus dieser Distanz eine ganz andere Sicht und Wahrnehmung derselben Landschaft. Wir erkennen viel eher das Zusammenspiel als die uns verwirrenden Einzelheiten; das gegenseitige Sich-Dienen und Nützen all des darin Vorkommenden – mit andern Worten: den grossen Sinn darin.
Schon diese einfache Erfahrung in den Dingen und Verhältnissen der Natur lehrt uns, dass wir, statt gierig nach dem Materiellen zu suchen, uns vielmehr um ein Verstehen bemühen sollten. Das können wir in unserm Gemüt auch leicht und sofort spüren, gleichgültig, ob wir uns auf eine einsame Höhe in der natürlichen Landschaft zurückziehen oder in eine einsame, tief empfindende Stellung in unserer seelischen Gemütslandschaft begeben. Derartige Erfahrungen und Betrachtungen darüber sind es, die unsere seelische Kraft – unsere Liebe – nähren.
Wie Vieles in unserm Leben betrachten wir im Moment als Unglück, das wir später – aus einer durch Distanz etwas abgeklärteren Sicht – als eine glückliche Fügung erkennen können; und wie Vielerlei wünschen wir zur Vermehrung unseres Glückes, das wir später – in zeitlicher Ferne – als unser ganzes Gemüt Belastendes und Einengendes kennen lernen. Darum ist es klug, auch die verschiedenen Lebenswege nicht nach ihren momentanen Details zu beurteilen, sondern nach der Artung derjenigen Liebekraft, die uns von einer Erfahrung zur andern treibt, und deshalb alleine dafür bestimmend ist, wie wir alle Geschehnisse in uns aufnehmen und nach welchen Gesichtspunkten wir sie schlussendlich ordnen.
Diese Arbeit selber zu tun, oder – beim Nichtvermögen – von jemandem dabei unterstützt zu werden, erfüllt das ganze Gemüt mit Zuversicht und Hoffnung und das Herz mit Liebe zu dem Schöpfer solcher Verhältnisse.
Bei den äusserlichen Dingen bringt uns also die Höhe der verständnisvollen Weisheit den gewünschten, befreienden Abstand. In innern, seelischen oder gar geistigen Belangen die tiefe, bescheiden demütige Verinnerlichung.
In beiden Fällen sind wir etwas getrennt oder zurückgezogen vom äussern Geschehen und werden deshalb eher berührt von der innern Kraft der göttlichen Liebe, die uns und all das auf uns Einwirkende nicht nur geschaffen hat, sondern uns auch führen will, sofern wir uns ihr mehr öffnen als allem von ihr Geschaffenen. Das verspürt man deutlich beim Lesen der nun folgenden Geschichten, welche aus dieser Sichtweise der Dinge geschildert sind. Und das kann und soll zu jener Schonkost werden, die uns in depressiven Situationen wieder unmittelbar über unser Herz und Gemüt kräftigen soll.
Eine Schonkost für das kranke Gemüt ist also eine solche, die das mühsame Kauen mit den Zähnen des Verstandes überflüssig macht. Es ist darum voll verständlich, wenn eine solche Kost einen gesunden und kräftigen Menschen nicht ebenso ansprechen kann. Wer die Kraft hat, mit Lust in einen reifen Apfel zu beissen, dessen Säure seinen kräftigen Magen eher zur Arbeit anregt, als ihn zu belasten; und wer gerne ein Schnitzel zerkaut, das seiner Verdauung auch eine längere, sie erfüllende Arbeit verschafft, der wird das auch mit Vorteil tun. Wer also mit andern Worten gerne an den Problemen des Alltags seine physische und intellektuelle Kraft messen will, diese dabei übt und stärkt, der erbringt – bei vernünftiger Betätigung – das Seine zur gedeihlichen Entwicklung des äussern Zusammenlebens.
Nur wer durch ein Zuviel an solcher Kost seine Verdauung einmal überlastet hat, oder durch Krankheit in seiner normalen Verdauungskraft sehr geschwächt worden ist, der hat dann eine grosse Freude an einer Kost, die schon ganz direkt eher seinen Geist nährt und stärkt, als zuerst den Leib und den Verstand. Durch die Stärkung des Geistes wird dann mit der Zeit auch der Leib wieder gesund und der Verstand wieder kräftig. Soviel zum Verständnis dafür, dass diese Kost nicht jeden zu jeder Zeit begeistern kann, so sehr er vielleicht ihre Nützlichkeit einsieht.
nach oben
DER WEG EINES WEIBES  Der Weg der Liebe in der Entscheidung zwischen Geist und Materie
Es begab sich, dass eine schöne und gesunde Maid, die ins Alter kam, in welchem man um sie zu werben begann, gleich zwei Bewerber hatte. Obwohl sie zwar sehr verschieden voneinander waren, hatten dennoch beide wirklich etwas Anziehendes an sich, sodass sie längere Zeit nicht wusste, wie sie sich entscheiden solle. Der eine war ein stiller, oftmals fast schüchterner Jüngling, der nur voll und offen mit ihr sprach, wenn sie alleine zusammen waren. Sobald mehrere Leute zusammen waren, schwieg er; und wenn er merkte, dass die Gesellschaft länger bleibe, so entschuldigte er sich stets und entfernte sich. Das war der Maid die unangenehme Seite an diesem Bewerber. Wenn sie aber längere Zeit mit ihm alleine war, da konnte er mit der Länge der Zeit auch stets mehr sich entfalten; und was er dann zu ihr sagte und was er ihr dabei auch zeigte, das war so erfüllend und erquickend, dass sie keine Worte fand, es zu beschreiben. Und wenn er sie das eine oder andere Mal in seine Arme nahm, was zwar selten geschah, so war das für sie ein Ereignis, dessen Tragweite sie mit ihrem Gefühl nie erfassen konnte; sie war dann so geborgen und fühlte sich so zu Hause, wie sie nie zuvor sich fühlen konnte, obwohl sie doch in einem rechten Zuhause aufgewachsen war. Auch hatte dieser Jüngling eine Weisheit und eine Kenntnis, deren Grenzen sie nicht einmal erahnen konnte. Jedoch liess er in grösserer Gesellschaft nie etwas davon verlauten - wenn er überhaupt je mit ihr längere Zeit in einer Gesellschaft blieb. Sie spürte überall, wie unendlich reich dieses Jünglings Gemüt war, wie rein alle seine Empfindung und Absicht mit ihr und dennoch vermisste sie stets das eine an ihm, das der andere Bewerber hatte.
Dieser war ein geselliger Mensch. Er war reich und lebensfroh und konnte herzlich lachen. Wenn er irgendwo einen Abend gestaltete, so waren stets alle Anwesenden begeistert von ihm und er, und mit ihm auch die Maid, wurden stets zum Mittelpunkt der Gesellschaft. Dabei war er freigiebig und grosszügig, auch feurig und leidenschaftlich, und wenn er seine Maid küsste, so war sie beinahe betäubt von der Glut und Heftigkeit seiner Liebe. Er war geschickt, aber weder weise noch überlegt und die fernen Dinge waren ihm fremd; er beschäftigte sich mit der Gegenwart. Das alles gefiel der Maid wohl und sie hatte eine grosse Freude an ihm. Nur war er stürmisch in seiner Leidenschaft und wollte bald ehelichen oder wenigstens einmal eine ganze Nacht mit ihr verbringen; und das wiederum war der Maid nicht angenehm. Nicht, dass sie nicht Sehnsucht nach einer solchen Nacht gehabt hätte, aber sie wollte vor einer festeren Bindung denn doch auch das Fernere und das Kommende beleuchtet haben. Aber die Zeit ihrer Unschlüssigkeit brachte sie nicht weiter und die Entscheidung fiel deshalb - wie so oft bei unschlüssigen Menschen - bevor sie noch gewünscht wurde. Und das geschah in einer Nacht, nach einem Feste, bei welcher Gelegenheit ihr der Bewerber einige gar feurige Küsse gab und sie so ganz sachte und unvermerkt dazu brachte, dass sie sich ihm ganz hingab.
Der Tag darauf war für die Maid ein sonderbarer. Denn sie empfand es, dass nun etwas endgültig festgelegt war, und die Liebe zum anderen Bewerber, der ihr stets die Freiheit liess, ja der sie - ihrer Meinung nach - oft zu frei liess, wuchs. Das war allerdings eher eine Reaktion auf die doch nicht ganz gewollte Entscheidung; aber es war dennoch auch das Empfinden einer tiefen Sympathie zum Wesen des ersten Bewerbers. Kurz, die Entscheidung war gefallen und nach einer grossen und hinreissenden Hochzeit war sie eine verheiratete Frau. Und es gefiel ihr die Rolle, die sie dabei spielte, noch ganz gut. Vor allem waren die Nächte stets bewegt und ihre Leidenschaft wuchs, sodass sie vor allem nur stets die Nacht vor Augen hatte.
Bei dieser Lebensart aber verstrich die Zeit schnell und nach etlichen Jahren nahm die gewohnte Lebensweise jäh eine andere Richtung. Der Mann starb unverhofft an einer bösen Krankheit, und da sie keine Kinder hatten, fiel das Erbe zur Verwandtschaft des Mannes, und das Weib stand mit leeren Händen da. Es war das eine traurige Zeit für sie, die aber nicht so lange währte, dass eine tiefe Nachdenklichkeit ihr Klarheit für die fernere Zukunft gebracht hätte. Denn bald einmal gewahrte ein unsteter Mann den Kummer, aber auch das Verlangen dieses Weibes und er brachte ihr, was sie glaubte, dass sie vor allem brauche, nämlich etwas Geld und bewegte Nächte. Und sie kam durch weitere Wechselfälle des Lebens am Ende zum Stand einer gemeinen Hure und stand wie diese und mit diesen des Abends auf Plätzen. Vorstellungen und Erwartungen hatte sie keine mehr vom Leben; nur hie und da eine etwas bewegtere Nacht unterbrach das Einerlei ihrer trüben Tage. Und, als sie merkte, wie selbst die Huren noch futterneidisch waren, als könnten sie noch etwas gewinnen, das ihr Leben verbesserte, da erfasste sie eine tiefe Niedergeschlagenheit; und in ihr war eine Leere, die sie mit nichts auszufüllen vermochte. Da geschah es, dass sie einmal von einem Manne ein gutes Angebot erhielt für eine einzige Nacht, und sie ging – völlig überrascht, dass nun gerade sie selber dazu gekommen sei – mit ihrem Bewerber. Als sie dann nach einem fetten Mahl ihr bezahltes Geschäft mit ihm verrichten wollte, da erkannte sie mit grossem Schrecken, dass dieser ihr Geldgeber krank war, und ein grosser Schauer lief ihr den nackten Rücken hinunter. Und zum ersten Mal sah sie wieder weiter und sah ihre Zukunft und die Leere ihres Gemütes wich der Verzweiflung. Alles in ihr stemmte sich gegen das vor ihr liegende Geschäft, das durch die Bezahlung bereits besiegelt war. Sie fühlte sich betrogen und verraten, und dennoch erkannte sie auch die natürliche Gesetzmässigkeit ihres Geschäftes und sie fügte sich.
Aber, was sie erwartet hatte, erfüllte sich bald und sie ward selber krank und musste als eine Kranke an andere Plätze. Sie war verdrängt von den Gesunden und fristete ein kümmerliches Dasein mit andern, die ihr Los mit ihr teilten. Wo sie nun war, gab es nichts mehr, das man hätte angenehm nennen können. Hunger, Kälte, Krankheit und grosse Demütigungen waren ihre steten Begleiter, die ihr so hart zusetzten, dass auch das Wissen um das gleiche Los der andern ihr weder Trost noch Erleichterung brachte. Menschen, die sich da ein Weib suchten – für eine einzige Nacht –, waren stets selber krank, zumeist auch schon verkrüppelt, oft auch roh und grausam. Öfters geschah es auch, dass eine der vielen Huren an einem Morgen nicht mehr zurückkehrte, aber niemand wusste, weshalb. Wohl konnte man es sich denken, aber niemand sprach davon. In einer Art Betäubung, durch die vielen Strapazen und Kümmernisse bedingt, lebten diese Huren dahin, ohne Sinn und ohne Aussicht - in ihrer eigenen Leere gefangen. Nur der Zorn auf jene, die sie dazu gemacht haben, was sie nun waren, unterbrach das Grau ihres Seins, sofern es ihre Kräfte überhaupt zuliessen, in Zorn zu kommen. In diesem Elend gab es zumeist nur ein einziges Gefühl, das nämlich des Verlorenseins auf ewige Zeiten. In dieser Verfassung war auch die einst schöne und gesunde Maid, die nun aber an einer zehrenden Krankheit litt und deren Gemüt so verkümmert war, dass keine ordentlichen Bilder mehr darin sich fanden.
Als sie eines Abends in ihrer Hoffnungslosigkeit so dastand in der Nacht und die feuchte Kühle des umschlagenden Wetters in sich eindringen fühlte, ohne dass es in ihr eine Regung hervorrief, ausser der Verdichtung ihres Elendes, da begab es sich, dass ein sonst noch nie auf diesem Platze gesehener Mann erschien und in halbwegs hastiger, halb schüchterner Weise eine um die andere Hure ansprach, aber von allen abschlägigen Bescheid erhielt. Sie selber konnte die Worte nicht hören, da sie als die Letzte zu weit entfernt war; aber sie merkte, dass alle sich von ihm abwandten. Als dieser, der Reihe nach alle ansprechend, in ihre Nähe kam, hörte sie, dass er eine werben möchte für nur ein kleines Stückchen Brot. Und sie sah wieder, wie alle sich von ihm abwandten. Seine unaufdringliche Art, die beinahe etwas Scheues oder Verbergendes an sich hatte, fiel ihr auf. Es war ihr klar, dass er für diese Gabe von niemandem eine Zusage erhalten konnte, und dennoch tat er ihr leid. Als er zu ihr kam, fragte er nicht einmal mehr um ihren Dienst, sondern hielt ihr nur das wahrlich kleine Stückchen Brot entgegen, was in ihr eine plötzlich starke Regung hervorrief, sodass sie mit einem Kopfnicken einwilligte und ihm wortlos folgte. Da der Mann ebenfalls kein Wort sprach, so hing sie auf dem Wege ihren Gedanken nach. Eigentlich wollte sie wissen, was dieser für dieses eine Stückchen Brot alles mit ihr vorhatte, denn Männer, die auf diesem Platze eine suchten, hatten zumeist vielerlei im Sinne. Dann dachte sie wieder an ihren Zustand, an die Krankheit, an alle Entbehrungen, an alle Demütigungen und sie ersah dabei auch wieder den Weg, über welchen sie zu diesem Jammer kam. Und dabei kam ihr der längst vergessene schüchterne Liebhaber von einst auch wieder näher und lebendiger in den Sinn, und sie fragte sich erstmals, was dieser wohl getan haben mochte, als er von ihrer Heirat vernommen hatte. Und als sie so einherging, wortlos wie ein Hund an der Seite seines Herrn, in die trübe Nacht hinaus, da kam ihr auch der vergleichende Gedanke, was wohl ihr tatsächlicher einstiger Gemahl getan hätte, wenn sie den andern, anstatt ihn, geehelicht hätte. Nun sah sie, die bisher nur noch grau in grau sah, endlich wieder einmal zwei deutliche und unaussprechlich inhaltvolle Bilder in sich selbst. Sie sah, wie der schüchterne Bewerber wohl nie mehr das Glück haben konnte, eine andere, ihm geneigtere Maid zu finden, und wie er einsam im Dunkeln seiner Verlassenheit sein Leben zu fristen verurteilt sein musste; wie all sein Reichtum im Gemüt und alle seine Weisheit vergeblich einer danach Gelüstenden harren, und sie wurde sich bewusst, dass sie nun anderseits für ein Stückchen angenommenes Brot vielleicht Dinge erwarten würde, von denen sie keine wünschte und noch weniger danach gelüstete. Dann sah sie in einem zweiten Bilde wieder den andern Bewerber, der hernach ihr Mann wurde, und sie sah in ihrem auf Augenblicke erhellten Gemüte, wie dieser bei ihrer Absage tausend andere Mädchen gefunden hätte und wie es ihm überhaupt hätte gleichgültig sein müssen, welche von den Vielen er am Ende hätte behalten sollen. Und sie gewahrte in sich einen grossen Unterschied der Beiden und ihrer Geschicke, sodass sie eine Ungerechtigkeit darin erblickte. Und nun tat es ihr erstmals von ganzem Herzen leid, nicht den ersten Bewerber genommen zu haben; denn ihr Leben hätte dabei einen Sinn erhalten; und sie erkannte nun den Fehler, den sie begangen hatte und der ihr nach und nach zu diesem Elend verhalf. War sie nun nicht eine der Tausend, die ihr einstiger Gemahl hätte haben können - und sind sie sich nicht alle gleich? Suchen und suchten sie nicht alle nur das ihre, anstatt dasjenige ihres Nächsten, von dem sie sagen, dass sie ihn lieben? Bei dieser Erkenntnis aber merkte sie, dass auch ihrem nunmaligen Begleiter alle andern abgesagt haben, ausser sie selbst, und in einer stillen Genugtuung empfand sie eine aufkeimende Liebe zu ihrem Begleiter. Dieser aber schritt schnell und entschlossen in die Nacht voran wie einer, der sein Geschäft gemacht hat und nun schnell zur Ausführung gelangen wollte. Und sie wurde erst jetzt gewahr, dass ihr nunmaliger Begleiter nicht, wie alle andern, schon unterwegs allerlei von ihr begehrt hatte; ja, es schien ihr, dass sie ihm geradezu gleichgültig war. Dabei erschrak sie ein wenig, denn sie dachte sich, ob er sie wohl für etwas anderes gedingt hatte, als für sich selbst – ob er wohl nur Scheusslichkeiten vorhatte mit ihr. Sie sah seinen Ernst auf seinem Gesicht und ihr wurde unheimlich, ihre Füsse versagten ihr beinahe ihren Dienst, und lähmend wirkten ihre Fragen auf sie ein. Sie konnte fast nicht mehr! Die Nacht schien ihr unendlich und die Unendlichkeit grausam, sehr grausam sogar. Sie fühlte sich verlassen und total verloren. Und in sich empfand sie, als wäre dies ihr letzter Gang und sie spürte, wie sie rein mechanisch ihre Füsse bewegte, dabei einen Fuss vor den andern setzend. Mit diesem Gefühl des letzten Ganges und des eventuellen nahen Endes wurde sie aber dennoch bald vertrauter und vertrauter und sie sah in sich wieder ihren ersten Bewerber, wie er ein letztes Mal – und damals wohl auch ohne Gewissheit – für immer von ihr ging, und sie erkannte darin auch seinen letzten Gang. Dabei fühlte sie sich erstmals, durch die äussere Lage bedingt, mit ihm verbunden; ja, sie begann ihn zu lieben und wollte einmal in ihrem Leben wenigstens mit ihm den Weg teilen. Und ein merkwürdiger, beinahe wärmender Mut beflügelte ihre Schritte, sodass sie ihrem Begleiter wieder gut zu folgen vermochte. Dieser aber schritt ungerührt, gleichmässig schnell voran und nahm von ihrer Gefühlsentfaltung keine Notiz, während sie selbst sich stets mehr und mehr mit dem ersten Liebhaber beschäftigte und gewissermassen in Gedanken und in ihrem erstmals wieder etwas bewegten Gemüte den vor ihr liegenden Weg mit ihm zusammen teilte.
Am Ende ihres Weges erblickte sie ein grosses Haus mit vielen Fenstern, davon nur noch wenige erleuchtet waren. Und sie dachte unwillkürlich an ein Haus, in welchem an Unzüchtigkeiten alles und jedes zu haben war, und ihr wurde bewusst, dass sie dazu eingewilligt hatte, denn ein Recht gibt es für derlei Personen nicht. Der Begleiter öffnete die Türe und hiess sie eintreten. Im Hause selbst war alles wohl bestellt und es sah freundlich aus und auch ihr Begleiter schien ein nicht unfreundlicher Mensch zu sein, und sie fragte, als sie sein Gesicht im vollen Lichte ersah, wie es doch gekommen sei, dass sie bis jetzt nicht ein einziges Wort miteinander gesprochen hätten. Und er erwiderte ihr, dass das ganz natürlich daher käme, dass sie ihn nichts gefragt hätte, während er selber nichts zu fragen gehabt hatte, indem sie ihm seine einzige Frage bei ihrer Begegnung mit einem Kopfnicken beantwortet hätte. Darauf liess er sie ihre Lumpen abnehmen und hiess sie baden und gab ihr neue Kleider, nach welchem allem er ihr eine Mahlzeit anbot, welche er mit ihr teilte. Beim Tischgespräch erkundigte er sich nicht so sehr nach ihrem Leben, als vielmehr danach, wie sie darüber denke, und es entspann sich ein tieferes Gespräch, das ihre Lähmung, aber auch ihre Einförmigkeit lockerte und während welchem sie stets mehr Zuneigung zu diesem Manne empfand, obwohl sie nie so recht wusste, was noch alles sich ergeben würde. Als sie dann aus einer nahe gelegenen Kammer ein klagendes Ächzen hörte, wurde sie bleich und begann zu zittern und sie konnte kein Wort mehr reden. Da fragte sie der Bewerber und nächtliche Begleiter, was es denn sei, das sie habe, und sie begann stotternd zu reden, dass es die Dinge seien, die sie erwarten würden. Da lächelte er und fragte sie, was sie denn noch zu erwarten habe nach all dem, was sie bereits erlitten habe; und sie dachte dabei unwillkürlich wieder an ihren ersten Bewerber und sagte zu ihm: "Nicht mehr viel – nur einmal noch möchte ich halb wollend und halb zagend mit meinem ersten Bewerber, von dem ich vorhin auch erzählt habe, den Weg in die Verlassenheit und Einsamkeit teilen". Da sah sie der nächtliche Begleiter gross an und fragte sie mit einer merkwürdig Anteil nehmenden Wärme, ob sie es denn nicht wüsste, ob sie mehr wollend oder eher zagend dieses tun könnte, wenn so etwas bevorstände. -- Sie besann sich eine zeitlang, ehe sie zu einer Antwort kam, und sagte dann: "Wenn ich ruhig bin, dann viel mehr wollend und nur im Schreck, wie vorhin, etwas zagend". Und er sagte zu ihr in bedeutungsvollem Tone: "Dann ist es recht, denn wider Willen wohnt niemand in diesem Hause deines früheren Bewerbers!" -- Und sie erkannte ihn als ihren ersten Bewerber und wandte sich von ihm ab, denn sie schämte sich sehr; und als er zu ihr hinging und sich vor sie stellte, sie ansah und fragte: "Wie? – Willst du dich denn abermals von mir wenden?" da überkam sie eine tief gefühlte, heisse Reue und sie liess ihren Tränen freien Lauf und sagte schluchzend, dass sie es nicht verdient habe, bei ihm zu sein. Und er antwortete ihr in liebevollem Tone: "Siehe, wie du, so haben meine Bewerbung unzählige nicht ernst genug genommen und ich könnte nun wahrlich so alleine sein, wie du glaubtest von mir. Aber ich gehe einem jeden meiner Berufenen nach und sehe, was sie tun, und prüfe auch, ob sie gar nie mehr meiner gedenken. Und wenn ich nur eine geringe Liebe zu mir sich noch entfalten sehe, so erwähle ich sie zum zweiten Male und sie können alle bei mir sein und mich mit der Zeit dann auch auf meinen Wegen begleiten. Aber sie müssen sich zugleich auch mehr und mehr vom alten Schmutz der Eigenliebe reinigen, was ihnen noch so manchen klagenden Laut entlocken kann, ob welchen du deshalb in Zukunft nicht mehr so erschreckt sein darfst. Denn erst bei einer völligen Reinigung und Gesundung können wir dann vollends eins werden. Und das kann nur in diesem meinem Hause der Fall sein. Meine Nähe und damit meine Liebe spüren aber alle, die in reiner Liebe an mich denken und sich wieder zu mir kehren!"
8.9.1982
nach oben
INNERE ENTSPRECHUNGEN DES ÄUSSEREN BILDES  Eine jede gesunde, das heisst voll entwickelte und geweckte Seele kann im Bilde oder Gleichnisse als eine Maid betrachtet werden, indem sie, wie eine natürliche Maid, alle Anlagen und Gaben zu einem ewigen Leben hat, nur eben das ewige Leben selbst noch nicht. Dieses aber liegt im Geiste der Wahrheit und der Liebe in ihr verborgen. Und wer dieses ewige Geistesleben noch nicht in sich und mit sich (mit seiner Seele) vereinigt hat, der kann auch nichts Erspriessliches für die Ewigkeit tun – weder für sich noch für andere. Diese Taten aber wären ja dann eben die Kinder, die eine Maid noch nicht haben kann, darum, weil sie noch nie mit einem Manne (dem göttlichen Geist in sich) sich vereint hatte.
Der Geist als das männliche Prinzip oder - im tiefsten Grunde - der Vater in Gott, also ist es alleine, der Gutes zum ewigen Verbleib stiften oder zeugen kann, und deshalb ist auch nur jener fähig, Gutes für ewig zu wirken, der in sich selbst dieses himmlischen Vaters Kraft in der Person Jesu wirken lassen kann; dann werden nämlich alle seine Werke eben von diesem höchsten Liebegeiste vollbracht, und die Seele selbst gab nichts dazu, als ihr "Ja", wenngleich die Ausführung für sie dann oft auch etwas beschwerlich wird, gleich einer Schwangerschaft beim Weibe.
Also ist das vorherige Bild dieser Maid genau entsprechend einer Seele, die bereits so weit entwickelt ist, dass sie einerseits in sich wahrzunehmen anfängt, wie die Verhältnisse stehen, oder stehen sollten, aber auch anderseits ausser sich vermerkt, wie die äussern Verhältnisse sind und wie und wodurch diese wirken auf sie selbst. Dabei ist die Seele entscheidungsfähig geworden, wie die Maid im Gleichnis, die zwei Bewerber hatte. Der erstere und wohl auch vertrautere, der nur in stillen Stunden zu ihr spricht, zeigt das Wirken und Einfliessen des Geistes beim Menschen in stillen und einsamen Stunden – die allerdings nur zu oft nur durch äussere Widerwärtigkeiten sich einstellen.
Jedermann, der gleich der Maid im Bilde schon voll entwickelt und auch aufgeweckt ist, kennt wohl dieses sanfte Herniedertauen schöner und schönster erhabener Gedanken, von himmlischen Gefühlen der Freiheit und der Liebe begleitet, und erinnert sich oft noch deutlicher daran, je seltener er dasselbe erlebte. In diesen Stunden ist der Mensch selbstvergessen und hingegeben an ein höheres, ihn beseligendes Wirken. Das sind – bildlich dargestellt – die seltenen Umarmungen des ersten Liebhabers!
Aber durch diese Umarmungen gibt es noch lange keine Werke oder Kinder, weil sie nur kurze und zeitweilige Vereinigungen darstellen, in welchen die Seele zu noch nicht mehr, als nur zur momentanen Freude und Beseligung "ja" sagt. Denn einem Manne dienen, nach der Forderung der Schrift, heisst ja nicht bloss: seine Liebe annehmen und geniessen. Weil diese Stunden der Entrückung aber selten sind, so ist das eben jener Umstand, welcher der Seele unangenehm erscheint; während der zweite Bewerber, der die Welt mit ihren Reizen und ihrer Lust darstellt, wirklich immer und jederzeit beim Menschen zur Hand ist. Sei es in der blossen Stillung des Gaumenkitzels, sei es im Glanze und der Pracht des Herrschers oder auch in der Leidenschaft äusserlicher Betätigung und äusserlicher Liebe. Ist es ja doch keine Kunst, einen Menschen sanft zu streicheln und in ihm dadurch zuneigende Gefühle zu erwecken, um ihn hernach für egoistische Zwecke zu missbrauchen, wie die Welt den Unerfahrenen gerne tut. Darum auch ist im Bilde der zweite Bewerber stets um die Maid. Ob dieses Streicheln und Schmeicheln mit der Hand (also durch äussere Reize) oder in feiner Rede (also geistlich) geschieht, ist dabei einerlei, denn beidem liegt die Selbstsucht der Welt zugrunde, die sich sofort entpuppt, sobald der so umworbene Mensch geneigt wird und nachzugeben beginnt. Darum wird im Bilde erwähnt, dass für diesen Bewerber nur die Gegenwart zählt und nicht die Zukunft.
Die Leidenschaft seiner Bewerbung zeigt, wie wenig lange die weltliche Handlungsweise auf den Erfolg zu warten bereit ist. Die glühenden Küsse im Bilde entsprechen der so intensiven Berührung entweder äusserlicher Reize oder innerlicher Ansprechung der Herrschsucht, sodass die Seele in einem momentanen Lustzustand wie betäubt bleibt. Das sind dann auch eben jene Momente, in welchen der Mensch am ehesten geneigt wird, diesem Prinzip fortan zu dienen, sich also mit ihm zu vereinen (bildlich: ehelichen) und daraus Werke folgen zu lassen, was im Bilde die Kinder darstellen würden.
Alle Unschlüssigen in geistigen und ewigen Dingen laufen höchste Gefahr, einer solch erhöhten Versuchung zu unterliegen; wie es denn im Gleichnis bei der Maid auch der Fall war. Dieses stete "Im-Mittelpunkt-Sein" schmeichelt der Geltungs- und Herrschsucht des Menschen und verpflichtet ihn, stets etwas dafür zu tun, damit er in diesem Zustande bleibe.
Das steht ganz im Gegensatz zum ersten Bewerber, des Geistes Gottes, der nur selten eine Umarmung zulässt, damit die Willensfreiheit des Menschen erhalten bleibt und bei welchem Verhalten sich der Mensch sicherlich nicht geschmeichelt vorkommt, sondern im Gegenteil eine rechte Portion Demut benötigt, um die Einsicht in sich wach zu halten, dass Gott nicht ihm, sondern er nur Gott dienen soll, damit die Vereinigung eine Bleibende werde – wiewohl ihm Gott im eigentlichen Sinne noch mehr dient, als er Ihm, wie das Ende des Gleichnisses dann aufzeigt.
Die stete und beinahe mühelose Tätigkeit fürs eigene Ansehen entfremdet die Seele nur stets mehr vom ersten Bewerber und es braucht in einer Nacht – welche dem Unverstand und der Lüge in irgendeiner Sache entspricht – nicht viel der Schmeicheleien oder Küsse, bis eine Seele es sich vornimmt, dem zweiten Prinzip zu dienen. Und schon ist eine willentliche Vereinigung geschehen, deren Folge eben die Werke oder die Kinder sind, sofern der Annehmende darin selber tätig wird, und eine Ehe ist geschlossen! Diese Ehe bedeutet das gegenseitige Unterstützungsverhältnis: Der Mensch unterstützt dabei alles, was ihm nachher schmeicheln kann. Und die Schmeicheleien unterstützen umgekehrt alle schlechten Eigenschaften der Seele – wie Genusssucht, Eigenliebe und Eigendünkel sowie Herrschsucht, damit sie ja nicht mehr davon abgehen kann. Das alles ergibt jene Ehe des Gleichnisses, in welcher die Nächte – als Entsprechung für Lüge, Trug und Blindheit – zum Mittelpunkt werden und die durch sie entstandenen Leidenschaften noch weiter anfachen.
Je heftiger dabei gebuhlt wird, oder: je intensiver die Vereinigung der Seele mit diesem Prinzip vonstatten geht, desto kürzer ist auch die Zeit der Ehe, weil nämlich dabei nur schneller das wahre Gesicht der Werbung und des Schmeichelns enthüllt wird und der Mensch oder die Seele den Selbstbetrug entdeckt oder entlarvt. Damit aber ist der Ehemann tot, weil er als gar nicht reell existent erkannt wird. Diesen Handlungen aber entspringen keine ewigen Kinder, da keine Lüge oder die aus ihr hervorgehende Handlungsweise ewig dauert. Also ist die Seele bei der Entlarvung ihrer Selbsttäuschung nackt und ohne Kinder oder: das Erbe fällt auf ihren Gemahl, die Lüge, zurück; das heisst, dass eben nur die Lüge selbst jene Handlungen hervorrief, die nun mit der Ablegung der Lüge ebenfalls abgelegt werden.
Nun wäre eigentlich die zwar äusserst not- und peinvolle Zeit des "Sich-Wiederfindens" und Neu-Ordnens! Aber eben, – wer so ausschweifend lebte, der zog so Vieler Augen auf sich, dass er auch als verwitwet nicht alleine dasteht. Der unstete Mann, der die verwitwete Maid bald einmal umsorgte und weiter hinab zog, entspricht der Leidenschaft, die sich entwickelt hat, entspricht also dem Hunger und dem Durst nach Vergänglichem, also wieder nach Lüge. Hunger und Durst aber sind in sich keine Lügen, weder der Hunger nach Brot noch der Hunger nach Antworten. Nur ist der Hunger der Seele nach solcher Ehe mit der Lüge auf Materielles gerichtet und er wird darum auch mit nur materiellem Schein gestillt. (Denn alles Materielle ist vergänglich und darum nur eine zeitweise "Nahrung" für die ewig lebendige Seele.) Solch materielles Brot ist etwa das Sorgen um ein möglichst sorgloses - wenn auch nicht mehr glänzendes - Leben; ferner die Sorge um die Gesundheit des Leibes, der ja jeder Seele nur auf Zeit gegeben ward und darum nicht ihr eigentliches Wesen ist. Die Zerstreuung ist anderseits die Schein-Stillung des Durstes nach dem Sinn des Lebens. Ja, wer sich nach der Verwitwung diesem Manne in die Arme begibt, der muss ja elender und elender werden und gleich einer Hure alles und jedes annehmen und dabei dennoch stets ärmer und ärmer werden.
Wohl ist er noch insofern gesund dabei, dass er jederzeit – zumindest theoretisch – neu ehelichen könnte, das heisst neu sich verbinden mit einem andern Manne oder einem andern geistigen Prinzip. Nur eben fehlt ihm die Kraft des Willens dazu. Der Wille aber, der nur aus der Liebe kommt und wächst, wird stets schwächer, je öfters man ihn dazu missbraucht, äusserlichen Erkenntnissen, durch die Tat danach, zu dienen. Das wird dann offenbar, wenn eine Seele oder ein Mensch durch äussere Verhältnisse und daraus hervorgehende Erkenntnisse zu Taten kommt, von denen seine Liebe Abstand nehmen muss, weil sie selbst für seine doch schon stark verdorbene Liebe noch zu verkehrt und zu scheusslich oder zu krank sind.
Das zeigt im Bilde der Kranke, dem die Hure folgte aus äusserer Erkenntnis des äusseren Vorteils. Bei Entblössung, das heisst: bei Einsicht ins Wesen allen äusseren Denkens, erschauert die Seele wohl, aber sie hat sich ja vorhin schon bereits dafür verpflichtet. Was also bleibt ihr übrig, als es zu tun und dabei angesteckt, und damit selber krank zu werden? Die Krankheit, die letztendlich den Tod beinhaltet, ist aber eben die volle Loslösung des Willens von der Liebe und seine Unterstellung unter den Verstand.
Wohl kann und darf der Verstand die Liebe leiten, wenn er durch Einsicht und Licht die Liebe erhellt, aber dann erwächst der Wille dabei dennoch der erhellten Liebe und nicht dem toten Verstande. Weil aber nur die Liebe des Menschen eigentliches Wesen ausmacht, bleibt der so gewachsene Wille dann auch lebenskräftig und kann auch fürs weitere und erhöhte Leben der Seele tätig sein, während der von der Liebe getrennte Wille, der nur noch dem Verstande dient, die Liebe ja fortwährend töten muss, indem er gegen sie und nicht für sie tätig ist.
Das ist jene Krankheit, unter welcher die ganze Welt seit jeher leidet und die im Menschen jeden Liebesfunken tötet und damit auch den Sinn des Lebens oder der Liebe in Frage stellt, weil eine tote Liebe so gut wie keine Liebe ist. Wer das noch empfinden kann, in seinem Elende, der hat wenigstens noch einen Funken Leben (durch die Liebe und Treue zur erkannten Wahrheit bewahrt) in sich, der ihm – immerhin nach längsten und grausamsten Leiden – wieder zur Liebes- und Willenskraft verhelfen kann. Wer es aber nicht mehr wahrnimmt, der hat den geistigen Tod schon hinter sich.
Es ging also der Hure trotz aller ihrer unaussprechlichen Leiden noch wahrlich gut, weil sie trotz der eingehandelten Krankheit noch am Leben blieb. Obwohl dieses Leben ja aus ihrer eigenen Sicht durch Sinnlosigkeit gekennzeichnet war, so war es dennoch schon deshalb nicht sinnlos, weil es eine eventuelle Umkehr noch beinhaltet. Erst der Tod schliesst diese Umkehr aus. Eine so stark erkrankte Seele, deren Wille - als deren Tatkraft - am äussersten und toten Verstande hing, kann aber aus sich selber kaum mehr die Kraft schöpfen, in sich selber zu gehen und damit umzukehren, weil sie eben in sich selber keine Bilder – die eigentlich Gleichnisse für eine gefühlte Wahrheit sind – mehr erschauen kann. Solche Bilder könnten sie aber geleiten – gleichsam als Boden und Unterlage ihres innern Fortschreitens. Aus diesem Grunde müssen oft äussere bedrückende Begebenheiten sich vorfinden, welche die Seele nach innen wenden.
Diese Begebenheiten sind eines Teiles vorbereitend in dem Gleichnisse erwähnt – durch die Feuchtigkeit des umschlagenden Wetters –, welche gleichsam durch die Kranke und Vereinsamte hindurchging und ihr Elend dadurch noch verdichtete, dass sie ihr anzeigte, dass sie nicht nur auswendig, sondern in selbem Masse auch inwendig verlassen war, auch ohne jeden Widerstand, sodass sie im eigentlichen Sinne nichts mehr ihr Eigen nennen konnte, also auch die Kraft ihres Herzens und ihres Gemütes – als den diesen beiden entspringenden Willen – verloren hatte. Und diese Vorerkenntnis war eine gute Vorbereitung zur Hinwendung zu einem andern Brennpunkte des Lebens, der sich im werbenden Manne kundgab, der, durch die kleine Gabe des Stückchen Brotes bedingt, nur Abneigung und Entrüstung – selbst der Kränksten und Ärmsten – hervorrief. Dabei erkannte diese Seele schon durch ihr "Zuhinterst-Stehen", dass sie als total verarmte, die nicht einmal mehr einen (Willens-)Widerstand ihr Eigen nennen konnte, diesem Manne gegenüber noch ärmer war und dass sie darum selber nichts mehr verlieren konnte, sondern nur noch gewinnen. Allerdings nicht durch das Stückchen Brot selber, als vielmehr durch die Gewährung der Erfüllung eines Liebewunsches dieses Mannes. Denn, wie kümmerlich dieser auch immer aussehen mochte, so war es dennoch ein Wunsch, der ja seiner Liebe entstammen musste. Durch die Abwendung aller andern vom Ansinnen dieses Mannes aber empfand die total verarmte Seele nämlich die wirkliche Armut der Menschen, die darin besteht, den andern nicht anzunehmen, ihn nicht zu lieben, ihm und seiner Not keinen Raum im eigenen Herzen zu geben. Wie will denn einer reich werden, der nichts annimmt!!
Aber nicht, um selber reicher zu werden, sondern nur, um den kleinsten Rest des Liebereichtums eines Fremden zu schützen oder zu wahren, nur darum nickte sie ihm zu, als er zu ihr kam. Das Stückchen Brot war für diese Seele eher ein Bild dessen, was sie empfand beim Merken dieses wohl kleinsten Restchens von Liebe in dem Fremden. Und sie folgte ihm wortlos in die dunkle Nacht hinein. Weil aber sie selber durch eine verkehrte Liebe, die nach Aussen zog, anstatt durch Verinnerlichung sich sammelte, zu ihrem Elende kam, und es auch kannte und wusste, wie sehr dieses Elend ansteckend war und wie wehe es einem andern tut, so wurde sie bei der Ausführung des Vorsatzes oder bei Betätigung ihrer Willenskraft ängstlich, dass sie selber dabei leiden könnte oder müsste. Dabei gedachte sie dann erstmals des Schmerzes, den sie selber ihrem ersten Liebhaber zugefügt haben musste; und bereits ein zweites Mal empfand sie damit für ihren Nächsten mehr, als für sich selber. Ja, sie merkte in dieser Empfindung auch bald, dass sie dem zweiten Liebhaber, also ihrem einstigen Gemahl – der Lüge – keinen Schmerz bereitet hätte bei einer Absage, da ja die Lüge alles umfasst, was der Wahrheit widerspricht. Ihre Zahl ist also Legion, während die Wahrheit nur eine Einzige ist und vereint bleibt in Gott. Darin sah sie ein Ungleichgewicht und empfand dieses als Ungerechtigkeit. Und ihre Liebe wuchs zu dem Einen, zu der Wahrheit, und sie gewahrte also damit zwei Bilder in ihrem Gemüte und erhellte in der gefassten Liebe zu dem einen der beiden Bilder ihr Gemüt. Das war eine Stärkung der Liebe, die sie durch die in ihrem Gefühl erkannte Wahrheit selbst erfuhr. Das äussere Bild des vergeblichen Werbens und damit des Alleinigen und des "Allein-Seins" eines Fremden verhalf ihr zu ihrem innern Bild und ebnete damit den Weg zurück in ihr Gemüt. In dieser innern Sammlung erweckte das Licht dieser Erkenntnis die Wärme ihrer kranken und geschwächten Liebe. Aber, wie jemand, der Gott und Sein Wirken nicht kennt, so erkannte diese arme, ja ärmste Seele nicht die Absicht ihres Liebeerweckers. Und wie einer, der keine Gemeinschaft mit Gott hatte und deshalb nur dessen Ordnung als stereotyper und tödlicher Ernst erkennt, ebenso erkannte diese Maid nur den scheinbar ungerührten Ernst und die Entschlossenheit ihres Bewerbers und ihre Furcht war deshalb gross und lähmend. Es erging ihr darum gleich, wie einem, der endlich eine Liebe zur Gottheit fasste, indem er wenigstens in sich selber die Möglichkeit einer solchen und die wohltuende Wirkung derselben auf ihn selbst zu erahnen beginnt, aber in aller äussern Erkenntnis eigentlich vom Gegenteil überzeugt wird. Ist das nicht das Los der meisten Menschen, die noch ein wenig Ernst und den Wunsch nach echter Liebe, trotz aller Vorkommnisse auf ihrem Lebensweg, behalten haben? Zweifel und Hoffnung ringen in solchen Seelen unablässig und dementsprechend ist auch ihr momentaner Gemütszustand; genau gleich wie beim nächtlichen Wandel dieser Maid. Nur die Hingabe an das Höhere belebt die Liebe und damit das Gemüt, vertreibt die Furcht und macht den Zustand erträglich. Bei der leisesten Prüfung der Verhältnisse aber gewinnt Zweifel und Furcht die Oberhand, wie bei der Maid, als Töne der Qual und Pein an ihr Ohr drangen.
Bei so fortgeschrittener Neubildung des Gemütes, wo sich die Seele wieder in einem Hause und Zuhause befindet, wie die Maid am Ende ihres nächtlichen Weges, fehlt dann aber auch die väterliche Frage, die sich in der Liebe des Gewissens kundgibt, nicht, ob die Seele eher wollend oder zagend bereit sei, alles für die Vereinigung mit der Liebe zu tun, oder: alles dafür anzunehmen, dass sie einmal wenigstens mit der Liebe, die aus Gott kommt, gleichen Weges wandeln kann.
Diese Frage dann wird, wenn sie oft gestellt wird, zur tieferen Besinnung führen und man wird finden, dass man dabei bereits vor Gott, dem Treuen und Liebenden, steht und das frühere Verschulden wird dabei zur unerträglichen Last. Das ist dann die erste Vereinigung mit Gott, die in der Erkenntnis geschieht. Aber erst nach unendlich vielen Übungen, die diese Einigung auch zur Tat werden lassen, wird die anfänglich verpasste Einigung oder Ehe mit dem ersten, besten und alleinig wahrheitsvollen Liebhaber auch in der Liebe möglich, wie sie in einem folgenden Bilde dargestellt wird.
20.9.1982
nach oben
TRENNUNG UND BEGEGNUNG  Es war einmal eine Jungfrau von so ausserordentlich schöner Gestalt und mit derart weichen, sanften Zügen, dass sie eher noch, als sie erwachsen wurde, alle Männerherzen höher schlagen liess, obwohl sie sehr bescheiden lebte und sich ganz unscheinbar kleidete. Sie hatte dementsprechend viele Zugeneigte und später viele ernsthafte Bewerber. Dennoch war sie keineswegs stolz oder auch nur von sich selber eingenommen, was wahrlich kaum sonst möglich ist bei einem Frauenherzen in der geschilderten Stellung. Keinen Bewerber, ja nicht einmal einen Zugeneigten wies sie von sich in ihren Gesprächen und in ihrem Gebaren. Bei einem jeden dachte sie daran, wie es ihr selber wohl zumute sein müsste, wenn sie - ganz bezaubert von der Schönheit und dem edlen Wesen eines Andern – von diesem schroff abgewiesen würde. Und sie stellte sich vor, wie sie selber dann nicht darüber hinwegkommen würde, dass bei solch vollkommener Schönheit ein so verdorbener Geist walten könnte. Sie war somit eine der wenigen echten Perlen, die ob ihrem äusseren Glanze in ihrem innern Wesen nicht blind und taub wurde, sondern, im Gegenteil, dem vom Schöpfer zugedachten und gegebenen äussern Ebenmass auch innerlich voll genügen wollte. Auf den ersten Blick merkwürdig aber war der Umstand, dass keiner ihrer Bewerber und Zugeneigten längere Zeit bei ihr blieb oder längere Zeit den Wunsch hegte, sie für immer "sein" nennen zu können. Sie selber kannte den Grund wohl, der darin bestand, dass sie allem äussern Wesen abhold war, praktisch nie scherzte und sich keinen äussern Vergnügen hingab, sondern ihre Vergnügen und ihre Erbauung nur in ernsten und aus Liebe begründeten Gesprächen suchte, sowie in liebevoller Hilfe an Bedürftige.
So kam es, dass diese wahrlich seltene Jungfrau stets älter wurde, ohne je die Gelegenheit gehabt zu haben, je einmal in eine ernste und dadurch wahrhaftige Bekanntschaft mit einem ihr ebenbürtigen Manne zu treten. Das verdross sie stets mehr und mehr, denn sie spürte die Isolation von den andern umso mehr, als alle stets ihre Dienste gerne in Anspruch nahmen, für sie selber jedoch keine Gefühle mehr hatten. Und sie fragte sich deshalb stets ernstlicher, ob sie nicht doch in die Weise der Welt einstimmen sollte. Dabei nahm sie ganz unvermerkt stets mehr vom Wesen der Welt an und hatte dann auch bald allerlei ernstere Bekanntschaften; jedoch erkannte sie dennoch lange keinen Mann. Mit der Zeit fand sie Gefallen am äusseren Treiben der Welt und begann die äusseren Wechselseitigkeiten zu geniessen und auszunützen. Ihr Ernst schwand dabei natürlich mehr und mehr, aber dennoch wusste sie stets noch eine gewisse Grenze zu wahren. Obwohl sie nun alles hatte, was sie sich von dieser Welt nur wünschen konnte, war sie nicht mehr recht glücklich und fand in diesem Erdenleben keinen rechten Sinn mehr. Niemand aber konnte sie trösten, denn alle fanden ja gerade darin den Sinn, wo sie selber ihn zu verlieren begann.
Nun begab sich aber, dass ein Fremder diesen Ort besuchte und die nun schon älter gewordene Jungfrau wie zufällig traf. Da sie ein längeres Stück Weg gemeinsam zu gehen hatten, entspann sich ein längeres, sehr ernstes und tief greifendes Gespräch. Und der Fremde konnte dabei so fasslich, tief und überzeugend reden, und Liebe und Wahrheit schaute so klar aus einem jeden seiner Worte und Gedanken, die er ihr eröffnete, dass sie zuinnerst gerührt wurde und mehr und mehr in ihre Jugend entrückt wurde, wo sie selber noch ebenso dachte, redete und handelte; und eine tiefe Sehnsucht nach jener reinen, ungetrübten Liebe und dem reinen, demütigen Ernst ihrer Jugend und dem reichen Sinn ihres Lebens begann ihr Herz zu beunruhigen und weckte tiefe Reue in ihrem Gemüte über ihren Entscheid, der Welt zu gefallen, damit auch sie Gefallen an ihr fände.
Als sich die Wege teilten, und der Fremde seitlich abbiegen musste, während sie selber geraden Weges nach Hause musste, brach ihr fast das Herz ob der Erkenntnis, dass sie – wäre sie wie in ihrer Jugend geblieben – diesem Fremden alles hätte sein und bedeuten können; und sie hatte stets mehr den Eindruck, dass eben "Ausharren" der Sinn ihrer damaligen Situation gewesen wäre.
Seit dieser Zeit der Begegnung mit dem Fremden war es mit ihrer innern Ruhe vorbei. Stets mehr kam es ihr vor, dass eigentlich der Fremde nicht fremd, sondern der Vertrauteste und das Vertrauteste war, gleichsam das Vaterhaus oder ihr Vaterland, in welchem sie in ihrer Jugend ihre glückliche Zeit zubrachte. Reue über Reue peinigte ihr Herz, und es half ihr nicht einmal der Gedanke, dass sie noch nie je einen Mann erkannte und deshalb eigentlich dem Fremden noch ganz gut angehören könnte, wenn dieser nur wollte. Dabei sprach aber der Fremde nie eigentlich über ein mögliches längeres oder dauerndes Verhältnis mit ihr, wies sie also auch nicht von sich – es trennten sich nur ihre Wege. Aber wie er sprach und was er sagte, zeigte ihr dennoch die Kluft zwischen ihrem jetzigen Sein und seinem Stande. Ein eigenartiges Heimweh bemächtigte sich stets mehr ihres Gemütes und die Unruhe wuchs. In ihrem Kummer entschloss sie sich – wenn sie auch nie damit rechnen konnte, dass der Fremde wieder einmal in diesen Ort käme und noch weniger sie aufsuchen würde – sich von allen andern Menschen und ihrem weltlichen Tun abzuwenden und sich stets nur mehr dem Fremden in ihrem Gemüte zuzuwenden. Denn, so sagte sie sich, sollte er auch nie mehr kommen, so war doch nur er alleine wahrhaftig in seinem ganzen Wesen und gab ihr in seiner kurzen Rede mehr als alle andern zusammen in all ihren jahrelangen bisherigen Plaudereien und Spielereien. Und so lebte sie lange Zeit zurückgezogen und äusserlich einsam, denn die Bewerber und Zugeneigten liessen nach mit ihrem Werben, weil sie ihren frühern Ernst in ihrem Kummer wieder fand und ihre reiche Körperfülle schon abnehmend war. Vertraute hatte sie keine, und so lebte sie in äusserster Einsamkeit, und dennoch hatte sie stets vermehrt einen treuen Begleiter. Es war die Hoffnung, die sie spürte. Das Leben und die Tage aber wurden lang, und finster die Nächte. Und, wer die Traurige und stets noch Trauernde gekannt hätte, hätte sie beweinen mögen und ihre Verlassenheit beklagt.
Eines Nachts aber pochte es an die Türe ihrer Wohnung, und als sie öffnete, erkannte sie den Fremden, der sie fragte, ob sie ihm für diese Nacht ein Lager hätte. Dabei erschrak sie sehr und in einer tiefen Liebeswallung sprach sie stotternd zu ihm: "Ja, willst du und kannst du hier in meiner Wohnung bleiben die ganze lange Nacht? Mir wäre es von ganzem Herzen recht, wenn sich das nur schickte". Der Fremde aber sah sie ernst an, lächelte ein wenig und sagte mit trostvoller Stimme: "Für diese eine Nacht wird es sich wohl schicken, aber am folgenden Tage wirst du mit mir kommen, in mein eigenes Haus - vorausgesetzt natürlich, dass du willst". Sie aber schwieg, denn sie konnte in ihrer Erregung nicht sprechen; er jedoch kannte die Antwort wohl. -- -- Darum, wer sich eine bessere Zukunft erhofft, bedenke, dass diese über dem Grabe erst voll sich entfaltet, aber im irdischen Leben schon beginnt. Der "Fremde" kommt zu einem jeden, dem er fremd geworden ist, aber auch die heisse Reue dann beim Wiedererkennen und der Entdeckung, dass wir selber ihn fremd werden liessen. Die dann folgende Trennung erst wird als Zeit bewusst erlebt und ist hart - sehr hart -, wie süss auch daneben das Sehnen und das Hoffen ist.
20.3.1982
nach oben
VON EINER SKLAVIN ZUR BRAUT IHRES HERREN GEWORDEN  Es war in einem mächtigen Reiche ein König, der hatte viele Sklaven und Sklavinnen und viele Diener und Dienerinnen. Er war ein Starker und hatte in nichts eine Not und alles fügte sich seinem Willen.
Er hatte aber unter den Sklavinnen eine, die ihn stark liebte seiner Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit wegen und auch darum, weil sie zu glauben spürte, dass ihr Herr ein edles, übergutes Herz habe, wiewohl er stets strenge war. Und je mehr sich diese Sklavin in die Anordnungen, Reden und in das Benehmen ihres Herrschers vertiefte, desto mehr glaubte sie, in allem seinem Tun nur die Liebe als Grund zu gewahren. Das aber machte sie nur stets mehr eingenommen von ihrem Herrn und sie hatte beinahe zu keiner Stunde des Tages mehr Ruhe in ihrem Herzen. Nur eines bewegte sie dennoch und brachte ihr oft starke Zweifel. Das war der Umstand, dass sie der Herr nie ansah. Manches Mal konnte er noch so leutselig sich geben und mit allen ein gutes Wort reden, doch waren alle Umstände immer so, dass sie selber nie zur Rede mit ihrem Herrn kam, während alle andern bei solchen Gelegenheiten oft zwei oder gar mehrere Male sich mit ihrem Herrn besprechen konnten. Das betrübte diese Sklavin sehr und sie dachte manche durchwachte Nacht darüber nach, was wohl der Grund für diesen sonderbaren Zufall war, oder – ob es dennoch eine verdeckte Absicht ihres Herrn war. Eine längere Zeit gab sie sich alle Mühe, einmal so nahe zu ihrem Herrn zu gelangen, dass sie ihn hätte anreden mögen, aber sie konnte das auch wieder nicht. Und diese Härte kam ihr denn doch stets gegensätzlich vor zu all der Güte, die sie von ihm kannte.
Mit der Weile aber beruhigte sie ihr Gemüt damit, dass sie sich sagte, dass ein Mensch, der alle seine Anordnungen, Reden und Taten – und seien sie noch so streng – aus purer Liebe begründete, dass ein solcher Mensch doch unmöglich gerade bei ihr eine Ausnahme machen konnte, die sie ja im Geheimen stets mit ganzem Herzen bei ihrem Herrn war und ihn in seiner Unbestechlichkeit hoch achtete und in seiner Güte und Weisheit liebte. Und sie zog sich mehr und mehr ins Herz ihres Gemütes zurück und wurde dabei stets froher und dankbarer, dass sie doch wenigstens als Sklavin gerade diesem Herrn dienen durfte und dass sie mit diesem Dienen dennoch auch seine Gegenwart erwirkte - wenngleich auch ohne Möglichkeit, mit ihm direkt zu reden. Und stille und voll erfüllt betrachtete sie täglich das Wirken ihres Herrn. Und stets sah sie mehr und mehr in allem seine Güte; und was sie anfänglich noch als zufällig oder eher unbeabsichtigt an ihm erkannte, das ersah sie stets mehr und mehr in ihrem Herzen als sein Wollen.
Damit wurde sie so erfüllt in ihrem Gemüte, dass sie sich vor lauter Glück oft fast nicht zu helfen wusste, und stets sann sie, wie sie solcher Liebe und Güte etwas entgegen tun könnte, und sie merkte in sich, dass sie wohl nur dadurch ihrem Herrn in etwas entgegenkommen konnte, wenn sie möglichst viel von seiner Vollkommenheit annahm. Und sie bemühte sich stets vermehrt, in allem ihrem Handeln und auch in allen ihren Absichten ihrem Herrn zu gleichen, dass auch bei ihr all ihr Tun nur aus ihrer Liebe komme. Je mehr ihr dies aber gelang, umso mehr wuchs ihre Liebe, Freude und Erfüllung, und sie misste immer weniger ein offenes Wort mit ihrem Herrn. Den andern fiel mit der Zeit die Änderung in ihrem Wesen auf, nur wusste keiner um den wahren Grund. Nur der Herr selbst merkte nicht auf, dass man hätte sagen können, er sieht es auch. Das aber verdross die Sklavin nicht mehr, denn sie hatte längst erkannt, dass sie ihrem Herrn ja nicht mehr geben könne, als dass sie in allem und jedem Tun eines Sinnes mit ihm würde. Nur wenn der Herr bei Widerwärtigkeiten oder beim Widerstreben seiner Diener und Sklaven etwas enttäuscht oder auch wehmütig wirkte – wenn auch bei seiner äussern Strenge bleibend –, dann dachte diese Sklavin, warum es ihr auch nicht einmal gegönnt sei, wenigstens mit ihrem guten Willen ihren Herrn erfreuen zu können; und dabei konnte sie dann ganz leise zu sich selbst zu reden beginnen und klagte – ganz leise nur – ihr Leid, besonders nachts.
Als sie einmal bei mondheller Nacht auf ihrem Lager sass und still vor sich her trauernd beklagte, dass sie, die so gerne ihren Herrn erfreuen wollte und alles dafür gäbe und alles dafür zu tun bereit wäre, in gar nichts ihm dienen und helfen könne, da geschah es, dass sich sachte die Türe ihrer Kammer öffnete und der Herr selbst ihr erschien. Er schloss die Türe hinter sich zu und blieb stehen indem er sagte: "Was beklagst du, meine treue Dienerin, dass du nicht tun kannst, was du doch schon eine geraume Zeit tatest?" Und sie fühlte sich getroffen und sah errötend zu Boden. Der Herr aber fuhr liebevoll redend fort und sagte zu ihr: "Meintest du nicht anfangs, dass du doch – wie deine Genossinnen ebenfalls alle – mit mir sprechen können solltest? – Siehe, des Mundes Rede taugt nur für solche, die in sich noch nichts oder doch nicht Vieles haben. Aber was du mir sagen wolltest und zu sagen gehabt hättest, das hättest du ohnehin nicht in Worte fassen mögen, und all deines Herzens Schätze hättest du hergegeben, um nur durch deinen Mund dich mir zu nähern. Das merkte ich wohl und darum nur habe ich dir keine Gelegenheit dazu gegeben, damit deines Herzens Schätze nicht durch deinen Mund wertlos vergeudet würden, sondern dass sie fest in deiner Herzenskammer verwahrt bleiben, wo alleine sie sich mehren können und sich auch beachtlich gemehrt haben bei dir. Und du bist damit zugleich ganz in mich eingegangen und in mir aufgegangen derart, dass es sogar deine Genossinnen merkten. Und das war wohl besser so, als es dein ursprünglicher Sinn gewesen ist, was du wohl merken konntest daran, dass du seliger und seliger wurdest und dich nur das eine noch störte, dass du mich nämlich nach deinem Urteil nicht zu erfreuen vermochtest. Aber ich sage dir, diese Annahme von dir war falsch, aber ich durfte dir die Wahrheit nicht früher aufdecken, da du sonst eitel geworden wärest. Nun aber hast du selber erkannt den innern Wert der innern Liebe und wie dieser sich mehrt im Gegensatz zu äusserer Liebe und äusserer Betätigung. Damit bist du auch reiner und reiner geworden und bist nun schon zu meiner ordentlichen Braut geworden, ohne dass du das ahntest oder wolltest. Aber das wollen wir nicht gleich allen mitteilen oder kundtun, sondern wollen so verbleiben, wie wir dem Äussern nach vorher waren, damit du eines Teiles nicht angefeindet wirst und andern Teiles nicht deine dich so beseligende Art und Gewohnheit verlässt und in Versuchung fallest, als mein öffentliches Weib anders zu werden in deinem Gemüte. In allen stillen Stunden aber werde ich, so wie heute, bei dir verweilen und mit dir teilen meine Freude. Und dir wird zukommen aus meinem grossen Schatze alles, ohne dass es dich beengt und ohne dass du Versuchung erleidest. Und also geschehe es, und nun erhebe dich und komme hin an meine Brust, zu meinem Herzen, damit du in der Fülle fühlst die Liebe deines Herrn und jetzigen Bräutigams." -- -- Der Herr ist zwar heute noch derselbe, aber – wo findet man eine Sklavin, das heisst eine durch äusseres Gesetz gefangene Seele, welche durch solche Liebesfülle frei würde und damit fähig zur Einswerdung mit dem Herrn, – nicht nur für Stunden, sondern für ewig bleibend?!
nach oben
DIE KINDER IM WALDE  Auf die Feststellung eines Bruders, dass ihn das tief Menschliche fasziniere und dass er vor allem dieses liebe, im Gegensatz zu mir, der ich das Vollkommene mehr liebe als das Menschliche, kam mir folgende Geschichte:
Ein Vater hatte viele Kinder, die er alle recht lieb hatte und die er auch alle so erziehen wollte, dass sie – ihm gleich – vollkommen würden in jeder Beziehung, aber vorab natürlich in der Demut, der Uneigennützigkeit und in der Liebe.
Einmal führte er seine grosse Kinderschar in einen weiten, schönen Wald. Dabei gewahrte der Vater bald, dass viele seiner Kinder sich an den Neuheiten und Schönheiten des Waldes mehr zu erfreuen und zu ergötzen anfingen als an seiner Nähe, seiner Liebe und seiner Weisheit und Wahrhaftigkeit. Das betrübte den Vater zwar wohl, aber er wollte ja seine Kinder nicht durch ein Gesetz an sich binden, und so beliess er ihnen ihren freien Willen und beschränkte sich aufs Zureden und Locken.
Einige blieben dann – im eigenen Zwiespalt – dennoch bei ihm; viele andere aber zerstreuten sich im Walde und erfreuten sich mit vielerlei Neuem. Als einige dann eine ergiebige Honigquelle fanden, da der Honig wie ein Bächlein aus einem hohlen Baumstamme sickerte, da war es aber auch bei den zwiespältigen Kindern aus mit ihrer Anhänglichkeit an den Vater und ihre Neugierde und Süssigkeitslust trieben sie vom Vater hinweg zur Süssigkeit des Waldes. Als sie nun alle um den Honig versammelt waren und damit ihr Wesen hatten, da betrübte es den Vater und er sagte zu sich selbst: "Da sind sie nun alle versammelt um den Honig, diese Süssigkeit des Waldes und gedenken dabei nicht der mannigfachen Gefahren – und noch weniger ihres Vaters, der sie doch gerade auch mit Honigbroten grossgezogen hatte. Nun muss ich sie – um nicht alle ihre Liebe zu verlieren – ihre eigenen Erfahrungen machen lassen, damit sie sich frei darüber entscheiden können, was ihnen besser bekommt: meine Nähe und Liebesorge für sie, oder die Nähe zur Natur in die sie ja durch ihre Geburt in diese Welt gestellt worden sind; und wären solche Erfahrungen in diesem grossen und unüberschaubaren Walde für das eine oder andere dem Anscheine nach auch noch so schlimm!" -- Und der Vater zog sich nach mehrmaligem, vergeblichen Rufen zurück und überliess die Kinder ihren Schleckereien und Spielereien. Erst nach längerer Zeit wurde den Kindern bewusst, dass sie nun ganz alleine in einem grossen Walde sind. Da begannen einige ängstlich zu werden und den Vater zu suchen. Andere wiederum fühlten sich dadurch freier und zogen weiter umher, um den Wald besser zu erforschen – wie sie meinten. Mit der Zeit fanden sie sich aber alle wieder und die Ängstlichen hörten auf, den Vater zu suchen, da sie es einsahen, dass es eine vergebliche Mühe wäre, wie es vor ihrer Trennung die "Forschenden" zu ihnen schon gesagt hatten. Da nun die Abenddämmerung sich zu verbreiten begann und sie ersichtlichermassen keine Eltern mehr hatten, so erkoren sie sich eines unter den Knaben als Vater und eines unter den Mädchen als Mutter. Und so taten sie wie eine richtiggehende Familie, und die Kleinen und Schwächern suchten Trost bei ihren After-Eltern, und die älteren und grösseren Kinder kamen sich dabei stark und wichtig und erfahren vor. Der Vater aber sah all diesem Treiben betrübt und traurig zu und sah darin das Menschliche, und sah sehr wohl, wie finster dieses Menschliche ist und wie tödlich auch, denn er kannte ja all die Gefahren dieses Waldes, besonders in der nun aufkommenden Nacht. Denn in dieser Gegend werden all jene sich stark erkälten, die in dieser feucht-kühlen Waldluft sich nicht eng zusammenschmiegen zu einem Haufen, um dadurch wenigstens ihre Eigenwärme erhalten zu können. Natürlich sähe das Bild eines solch zusammengedrängten Kinderhaufens – wie er sich mit fortschreitender Dunkelheit auch wirklich gebildet hatte – für einen zufälligen Betrachter schön und ergreifend menschlich aus, solange er nicht mit dem Herzen eines um ihre Seelen besorgten Vaters fühlte. Indessen trügt ein solches Bild! Denn in diesen Menschenknäuel war ja ein jedes für sich nur deshalb verwickelt, weil es für sich selbst viel Wärme erhoffte, aber keines deshalb, um seinem Nächsten Wärme zu geben. Und so war diese scheinbare Eintracht im Grunde genommen eine Zwietracht, in der jeder dem andern das Seine nehmen wollte für den eigenen Zweck. Das merkte der Vater wohl und es schmerzte ihn nicht wenig. Aber ein anderer Betrachter hätte das wohl nicht in dieser Weise sehen können und hätte es wohl als tief menschlich und schön empfunden. Nur der Jüngste der Kinderschar empfand diese Härte und den Druck der Gier, und er verliess den Haufen Kinder und entfernte sich, den Vater suchend und still zu ihm seufzend, mit der Weile auch laut zu ihm rufend. Aber er fand den Vater nicht, noch hörte er sein Rufen, auf das er hoffte. Und er fragte sich alsbald, ob er wieder zu dem Haufen zurückkehren solle. Dieser Gedanke an den selbstsüchtigen Haufen aber betrübte ihn und er begann zu weinen und beschloss, hier lieber ohne Vater zu sterben, als ohne den Vater in dem Haufen zu leben. Da erst rief ihn der Vater, der in Wirklichkeit seinen Kindern sehr nahe war – und auch immer nahe bleiben wird –, bei seinem Namen, und der Jüngste empfand eine grosse Wonne in seiner Brust, sah auf in die Nacht und fragte: "Vater, wo bist du?" – Und der Vater antwortete ihm und sagte: "Es nützt dir nichts mein Junge, wenn du weisst, wo ich bin, denn du kannst in der Nacht weder sehen noch ordentlich gehen und hast mich dann auch nicht so recht der Liebe nach bei dir. Wenn ich aber zu dir käme und dir meine Hand reichte, wärest du dennoch nicht so ganz sicher, ob du wirklich die Hand deines Vaters hieltest oder bloss diejenige eines andern Mannes mit ähnlicher Stimme. Aber ich will, wie du es von deinem treuen Vater gewohnt bist, dir ein weiches und warmes Lager geben, darauf sollst du dann ruhen und die Worte deines Vaters wohl überdenken, damit du ihn am kommenden Morgen auch erkennst, wenn er dir mit dem Lichte der aufgehenden Sonne entgegenkommt, allwann deine Augen vom Schlafe noch trunken sind und das helle Licht dein Auge noch blendet." -- Und während das Kind andächtig und mit stets grösser werdender Liebe und Sehnsucht lauschend einige Schritte in Richtung der vernommenen Stimme tat, trat es in eine mit dürren Blättern gefüllte Bodenmulde und fiel dabei in das weiche und durch die Gärung der unteren Schichten erwärmte Laub und fiel bald, froher Erwartungen voll, in einen tiefen Schlaf. – – Dass es den Vater am Morgen fand, ist sicher. Ob aber auch die andern des andern Tags den Vater fanden? Wohl rief auch ihnen der Vater zu öfteren Malen, aber das lärmende Treiben der Kinder übertönte seine Stimme und der Vater überliess sie sich selbst, wohl wissend, dass jedes einmal zu ihm zurückfinden wird. Das "wann" und "wie" aber ist etwas, das vor allem den Kindern nahe geht.
Dabei ist es klar, dass der Wald den Verstandeserkenntnissen aus der Natur der Dinge entspricht und der Honig den Weltlustbarkeiten; und das Wohlbehagen des Zuschauers beim Betrachten des Haufens bezeichnet den sich erhaben vorkommenden Philosophendünkel der Menschen und Dichter. Wer und was der Vater und die Kinder sind, wird jeder fühlen, dessen Herz noch der Liebe entgegen schlägt.
10.4.1978
nach oben
NACHTRAG  Sehr mitleidige, aber auch sehr neidische Leute könnten dem Jüngsten der Kinder des guten Vaters den Vorwurf machen, dass er nicht nach der christlich gebotenen Nächstenliebe gehandelt habe, indem er anstatt den andern zu helfen, nur an sich denkend den Vater suchte. Nun, dazu ist recht wenig zu sagen, da dieser Einwand aus der Kurzsicht der Eigenliebe entsprungen ist, und zwar aus der Sicht der übrigen Kinder betrachtet. Denn, wenn beispielsweise 16 Kinder, sich aneinanderschmiegend, sich erwärmen können, so brauchen sie das siebzehnte nicht mehr dazu. Können aber 16 Kinder einander nicht mehr selbst erwärmen, so fragt es sich ernstlich, ob es das Siebzehnte alleine dann imstande wäre. Einzig das wäre dem Jüngsten vorzuwerfen, dass er nicht darauf drängte, dass alle mit ihm den Vater suchen gingen. Alleine, dieser Einwand ist noch kurzsichtiger und auch kraftlos, weil ja ohnehin am hellen Tage schon mehrere den Vater suchten und diese Suche dann übereinstimmend aufgaben. Da wäre es wohl schon zuviel verlangt von der Weisheit eines schwachen Kindes, dass sie dann die Übermacht von 16 Andersdenkenden gerade in der Nacht hätte von der Richtigkeit ihres Vorhabens überzeugen sollen. Somit hat der Jüngste durchaus am vernünftigsten gehandelt. Denn er wusste wohl noch aus der Erinnerung, wo ihm Liebe entgegenschlug und er suchte diese wohl spät, aber immer noch zur richtigen Zeit auf, und er liess das blosse äusserliche Getue, darin kein Leben, weil keine Liebe ist, hinter seinem Rücken. Den Toten ist von menschlicher Seite nicht zu helfen, und so hatte er innerlich keine Nächsten oder gar Brüder mehr, denn diese müssten doch denselben Zug zu demselben Vater haben – und auch lebendig verspüren. Und äusserlich konnte er seinen nur dem Äussern nach Nächsten, die ihrem innern Lebenszug nach tot waren, nicht helfen, denn erstens brauchten diese dem Äussern nach nichts und zweitens hatte er selber ja nichts, das da hätte helfen mögen.
Einzig wäre noch weiterzuspinnen, die Möglichkeit, dass er anderntags zu seiner eigenen Probung hätte können vom Vater zu seinen Leibesbrüdern gesandt werden, um ihnen vom Vater Kunde zu bringen, und hätte dafür vom Vater ein Stück guten Honigbrotes als Wegzehrung mit auf den Weg bekommen. Da liesse sich allenfalls von einem mehr als Halbblinden fragen, ob der Jüngste dann hätte aus grossem Mitleide sein Honigbrot mit seinen Brüdern und Schwestern teilen sollen. Ja, hätte er das gemacht, so hätte er dann keinen grossen Fehler begangen, da ihm die Liebe diese Handlung geboten hätte. Bei einer sehr grossen Liebe aber hätte er, durch die Erregung derselben, zum Lichte gefunden, das ihm den Weg seines Vorgehens erhellt hätte, indem ihm klar geworden wäre, dass da die Bruderliebe mit der Liebe zum Vater in der Gabe – dem Honigbrote – gestritten hätte. Da aber die Liebe zum Vater stets heftiger und grösser sein soll, als jene zu den Menschen, hätte diese grosse Liebe zum Vater ihm weiter gezeigt, dass der Vater für alle seine Kinder Honigbrote bereit hält, und dass es nur darauf ankäme, dass alle Kinder auch wirklich zum Vater wollten und auch wirklich wollten verzehren solch köstliches Honigbrot. Dann bestünde seine Aufgabe wohl darin, seine Brüder mit aller Geduld zu ihrem Vater zu führen, aber niemals darin, sein eigenes Brot unter die ihm und seinem Vater spottenden Fremden zu verteilen, die wie die Schweine alles fressen und keinen Unterschied machen zwischen jedwedem Zeug des Waldes und dem guten Honigbrot des Vaters, bereitet zum Wohle seiner Kinder. Denn dafür fände sich sehr wohl auch eine Stelle in der Schrift, wo es heisst, dass die Perlen nicht unter die Schweine verteilt werden sollen. Ja, wenn der Jüngste zum zwanzigsten Male käme und ein halbverhungertes Brüderchen dann endlich mit ihm zum Vater zurückkehren wollte, so könnte er diesem aus grosser Liebe zu ihm und noch grösserer Liebe zum Vater, dem er möglicherweise eines seiner Kinder wiederbringen könnte, wohl sein ganzes Honigbrot hergeben, weil er dann ja offenbar der Gesättigtere ist, der nur kurze Not gelitten hatte und andernfalls sein Brüderchen – zwar wohl selbstverschuldet – aber immerhin doch, seit seinem Beschluss, zurückzukehren, nicht mehr selbstwillig auf das Gute - des Vaters Honigbrote - bis zur Ankunft zu Hause verzichten müsste. Vom Zeitpunkt der Wendung an ist jeder – obwohl selbstverschuldet – ein Armer. Vor der Wendung aber gilt der Satz, dass einem Selbstwollenden kein Unrecht geschieht und dass er somit auch nicht im eigentlichen Sinne arm ist.
31.7.1978
nach oben
DER UNTERSCHIED  Nach menschlichem Ermessen wollte es der Zufall, dass in einer kleinern Stadt – und zwar an deren äusserstem Rande – zwei Nachbarn wohnten, die beide, neben einigen gesunden Kindern, auch je ein Blindgeborenes hatten. Und bei beiden war es ein Mädchen. Obwohl beide Eltern alle ihre Kinder, und besonders das Blindgeborene, sehr liebten, so gaben sie aus eben dieser Liebe, die verschieden war, auch ihren Kindern eine ganz verschiedene Erziehung. Der eine Vater sagte nach der Geburt des Kindes einmal bei Tische: "Es jammert mich, dass nun unser Jüngstes nie sollte sehen die Herrlichkeiten Gottes auf dieser Welt und nie mit uns teilen kann die Freude an der Natur, an den Farben und an der Sonne. Es wird nie uns, seine Eltern, sehen und euch, seine Geschwister." Und als das Kind heranwuchs zu einem schönen und wohlgestalteten Mädchen mit einem sanften aber etwas scheuen Gemüt, da jammerte es den Vater immer mehr, dass seine Tochter nicht mit ihm teilen könne jede Freude und Wonne des Lebens. Und auch das Mädchen begann immer mehr unter seiner Blindheit zu leiden. Und sie zogen von einem Arzt zum andern und von einer Klinik zur andern und je mehr sie so herumzogen, ohne dass ihnen ein Arzt oder eine Klinik hätte helfen können, desto schwerer drückte die ganze Familie das Gebrechen des Mädchens und das Mädchen selber wurde bleich und blass und bekam ein eingefallenes Gesicht und weinte viel und bitterlich, sodass die Eltern bald um seine übrige Gesundheit zu bangen anfingen. Während es früher noch öfters mit dem blinden Kinde seines Nachbarn spielte, zog es sich jetzt immer mehr zurück und seine Blindheit lag wie ein Schatten über dem Glück der ganzen Familie. Bei der andern Familie verhielt es sich etwas anders; da sagte der Vater einmal bei Tische, nachdem das Kindlein geboren war: "Wir alle sind wohl stark überrascht, dass nun unser Jüngstes blind zur Welt geboren wurde und nie sollte schauen können, was unser Gemüt oft erhebt, und nie sollte schauen den Himmel und die Erde. Aber ich weiss dazu auch etwas anderes zu sagen und das andere sagt die Bibel, wo es steht: "Dieser Himmel und diese Erde werden vergehen aber meine Worte werden ewig Bestand halten." Also, sehen wir mit unseren Augen nur einen vergänglichen Himmel und eine noch vergänglichere Erde. Und nur der Anblick des vergänglichen Himmels ist unserer Tochter verschlossen, nicht aber vielleicht der Einblick in den wirklichen Himmel, der im menschlichen Herzen verborgen ruht, denn sonst hiesse es wohl kaum in der Bibel, dass das Reich Gottes nicht mit äusserem Schaugepränge kommt. Aber wir, die wir von Gott auch die Gabe des äusseren Gesichts erhalten haben, wollen unserem Schwächsten helfen und wollen ihm von unseren Eindrücken aus der Natur erzählen und wenn es sich dann innerlich zu bilden anfängt, so wird es die von euch mündlich empfangenen Natureindrücke zu verarbeiten beginnen und wenn es fleissig und redlich ist, so wird daraus dann auch für uns ein süsser Honig werden. Denn darin gleicht unsere Familie dann beinahe einem Bienenvolk. Jene Bienen, die geschickt sind, draussen sich zu tummeln und zu sammeln, die sammeln auch und bringen fleissig nach Hause, was ihnen Gott bereitet hat auf dem Felde der Natur. Jene aber, die nicht geschickt sind, draussen zu sammeln, die bleiben in sich zu Hause und bereiten durch die Liebe aus dem gesammelten Nektar einen allersüssesten Honig. Und wenn einst der Winter unseres irdischen Lebens anbrechen wird, so werden wir voll Freude und Dankbarkeit von dieser süssen Herzensspeise zehren können, die unsere Tochter und Schwester für uns bereitet haben wird. Und wenn wir in solcher Ordnung bleiben, so wird keinem etwas abgehen, unserer Tochter die äussere Speise nicht und uns dann der äussere Himmel und die äussere Erde nicht, so wir sie verlassen müssen, weil wir uns laben können am wohlbereiteten Honig unserer Schwester. Aber: wir dürfen nicht vergessen, dass eigentlich nur der Vater im Himmel uns geschickt machte zum Sammeln und des-gleichen kann auch nur er unsere Tochter geschickt machen zum Honigbereiten. Also ist der Honig ewig des Herrn, ob er noch in den Kelchen der Blumen ruht, oder durch seine Liebe in der Menschen Herzen schon zu Honig bereitet ist. Das wollen wir stets beachten!"
Und das Mädchen dieser Familie wuchs heran und hatte eine liebliche Gestalt und ein äusserst warmes, gottergebenes und weiches Gemüt und wenn es sein Gesicht zu einem wandte, glaubte man beinahe, es sähe einen, und man konnte ganz glücklich werden ob solchem Anblick.
Einmal, als ein jüngstes Geschwisterchen das Gefühl hatte, als ob es in etwas verkürzt wäre, was die Liebe seiner Eltern betraf, sagte es mehr zu sich selbst als zu der blinden Tochter: "Oh, warum sieht denn der Vater nur stets nach dir und nicht auch nach uns ?" Da lächelte das blinde Mädchen und sagte zu seinem Geschwisterchen: "Komme einmal zu mir, ich will dir etwas sagen". Und es nahm sein Geschwisterchen in seine Arme und sagte zu ihm: "Siehe, als der Vater vorhin dich zurecht wies, da sah er vorher und nachher fest zu dir, nur hast du es nicht sehen können, weil du von ihm weg schautest!" Und ganz erstaunt rief der kleine Bruder: "Aber, meine Schwester, warum weisst du das, hast du denn das gesehen? Hast du das Augenlicht erhalten?" Das blinde Mädchen aber küsste ihn und sprach: "Nein, das gerade nicht, aber ich habe ein Licht in meinem Herzen und das hat es mir gezeigt. Sieh, der Vater hat dich doch sieben Male heute gewarnt, dass du von deiner Spielerei möchtest ablassen und deine Arbeit verrichten. Also hat er dich doch sieben Mal angeschaut und siebenmal Geduld und Mitleid mit dir gehabt. Aber du hast, ob deiner Spielerei, ihm nicht in sein gutmütiges Gesicht geschaut. Als er dich dann strafte, da erzürntest du dich und du hast deshalb wieder nicht in sein Gesicht geschaut, das nur Liebe zu dir verraten hätte." Da sagte der kleine Bruder etwas trotzig: "Du hast es ja auch nicht gesehen!" Und das blinde Mädchen erwiderte: "Aber ich habe gehört, wie der Vater nach der Strafe leise betrübt zu sich selber sagte: 'Warum musst du es denn stets so weit kommen lassen!?' Sage, mein lieber Bruder, hat er dabei also nicht trauernd noch einmal auf dich gesehen und heiss gewünscht, es hätte nicht so sein mögen, wie er es siebenmal zuvor wünschte, es müsste nicht geschehen. Siehe, darum weiss ich, dass der Vater nach allen schaut und jedem das Beste gibt. Kehre nur du deine ganze Liebe wieder zu ihm und gehe zu ihm und du wirst es selber auch erschauen, dass er dich liebt!" Und es gereute das Brüderchen sein Ungehorsam und es ging zum Vater, der es freundlich ansaht und sagte: "Mache du, dass du mit deinen Augen nicht weniger siehst, als deine Schwester in ihrem Herzen."
Und so verging auch in dieser Familie die Zeit und die blinde Tochter wuchs heran und jedermann kannte sie und liebte sie, aber niemand mochte um sie freien, weil sie blind war. Sie aber freite nur um die Liebe Gottes.
Es lebte aber in einer andern Stadt ein entfernter Verwandter des ersten Vaters, der kannte wohl beide Schicksale der beiden blinden Kinder und hatte selber ein blindgeborenes Töchterchen. Und dieser dachte also und beschloss bei sich: "Ich kenne beide Fälle von Blindgeburt: die meines Verwandten und die seines Nachbarn. Mein Verwandter aber sah diese Blindgeburt als ein Gebrechen und ein Fehler an, während sein Nachbar darin das Positive suchte und auch fand. Also will ich in der Blindheit meines eigenen Kindes auch nur das Positive sehen und es das auch lehren, selber darin das Positive zu sehen." Und er zeigte seiner blindgeborenen Tochter auch fortwährend das Positive ihrer Blindheit und schonte sie, soviel er konnte, sodass sie keine Arbeit tun musste. Aber diese Tochter wurde deshalb bald eingebildet ob ihrer Blindheit und hielt diese für eine Tugend, die einen reich mache. Und sie wuchs heran, wurde wohl schön, aber sie hatte etwas Hartes und Kühles in ihrem Benehmen und sie selber litt darunter schwer. Da begab es sich, dass der Vater dieser Tochter einmal mit jenem Vater, der ein Nachbar seines Verwandten war, zusammentraf und er klagte ihm seinen Kummer und das Leid seiner blindgeborenen Tochter indem er sagte: "Nun habe ich doch deine gute Methode der Erziehung angewandt und nun siehe meinen trübseligen Erfolg!". Da sagte der andere Vater: "Weißt du, du hast es nur dem Anscheine nach gleich gemacht wie ich. Du glaubtest, dass ich im Blindsein etwas Positives sehe. Siehe, das war aber nie so. Denn Blindsein ist nie gut, sondern Sehen ist gut, sonst hätte Gott nicht allen Menschen zwei Augen erschaffen. Aber im Sehen selber liegt auch eine Gefahr. Man glaubt bald, dieses und jenes gehöre einem. Dabei nimmt man ja "dieses und jenes" nur durch die Augen wahr, die ein Geschenk Gottes sind. Und "dieses und jenes" gehört einem auch nur gerade also, wie das Licht der Augen, das Gott den Menschen gab und das uns "dieses und jenes" beschauen lässt. Darum ist aber das Schauen nicht schlecht und das Blindsein nicht gut. Gut ist nur, mit dem Licht, das du erhältst – ob ein inneres des Gemütes oder ein Äusseres oder beides – den Geber allen Lichtes zu suchen und zu finden, denn dann wirst du selber stets mehr Licht und kannst als selbst Licht nicht mehr in die Finsternis kommen.
Darum war es ungeschickt von dir, deine Tochter mit dem Licht ihres Gemütes nur das Dunkel der Erde erschauen zu machen. Hättest du sie mit ihrem Gemütslicht lieber die Liebe erkennen lassen, die das Inwendigste ist und damit auch der Urgrund des Lichtes, so hätte sie auch den Herrn als ihren Urgrund gefunden und wo der Grund des Lichtes ist, da hört auch das Licht nie mehr auf!"
10.12.1977
nach oben
NACHTRAG  Drei Väter, drei Möglichkeiten, so könnte man kurz den Inhalt dieser Geschichte bezeichnen. Weil aber der "Vater" einer jeden Handlung die Liebe zur Handlung darstellt, so kann auch gesagt werden: Dreierlei Arten von Liebe und dreierlei Arten der Entwicklung. Weil die Liebe der Vater der Handlung ist, so ist die Handlung – und insbesondere auch der Erfolg der Handlung – gleich oder entsprechend der Liebe oder dem Ursprung der Handlung.
Ist die Liebe noch blind in ihrer Art und noch wenig verfeinert, so gleicht sie der Liebe eines sinnlichen Naturmenschen, der sich vieles wünscht und alles, was ihn gut dünkt auch allen jenen wünscht, die er in seine Liebe eingeschlossen hat. Er selber ist glücklich dabei und kann auch andere glücklich machen, sofern sie zufälligerweise genau dasselbe benötigen wie er. Benötigen sie aber aus ihrer anders gestellten Liebe eine andere Kost, so kann sie der Naturmensch nicht mehr beglücken, ja, er macht sie durch seine Kost sogar unglücklich und wird dann durch das Unglücklichsein seiner Geliebten selber unglücklich und das zeigt im Bilde der Geschichte der erste Vater.
Wird die Liebe aber durch dieses "Unglücklichsein" zum Suchen kommen, so wird sie bald gar manches finden oder entdecken, das ihrer bisherigen Unbekümmertheit leicht entgangen ist. Dadurch aber muss sich die Liebe regen und durch die Regung mehren und es wird heller in ihr. Wenn sie dann in ihrem helleren Zustande gar den Spender aller Helle oder allen Lichtes erkennt und ihr Wesen von diesem Lichte ganz durchdringen lässt, das inwendig ist, dann wird es auch allen jenen etwas heller und leichter, die von dieser seiner Liebe eingeschlossen sind. Ja, wenn diese Miteingeschlossenen ebenfalls das Licht empfinden und sich selber wieder ganz dem Lichte ergeben und sich von ihm durchdringen lassen, so werden sie selber heller und heller und es entsteht ein Strahlen und Widerstrahlen, wie das im Bilde der Geschichte beim zweiten Vater der Fall war.
Bei diesem heller und heller Werden wird natürlich auch der Verstand des Menschen stets heller und heller und es besteht dabei dann die Gefahr, dass sich der Mensch in seinem erhellten Verstande zu gefallen beginnt und als Folge davon alle seine Liebe an den Verstand zu hängen beginnt. Da der Verstand aber nicht lebendig, sondern tot ist, so ermattet dabei das Leben dieser Liebe und sie wird darum kälter und kälter und dabei stets finsterer. Denn: wie das Sehen nicht im Auge liegt sondern in der Seele nur, so liegt das Erkennen auch nicht im Verstande sondern im Lichte und der Liebe des Herzens nur. Wohl geschieht das Sehen durch das Auge, wie auch das Erkennen teilweise durch den Verstand; aber nur die Seele oder das Liebe-Licht des Herzens ist des Sehens und Erkennens fähig. Wer das weiss, der halte sich an das Licht und ja nicht an den toten und für sich alleine dunkeln Verstand, sonst müsste es ihm ergehen, wie im Bilde der Geschichte dem dritten Vater, welcher auch das Innwendigste nicht merkte, weil er zu sehr auf das Äussere sich konzentrierte und so zu der irrigen Meinung kam, dass Blindsein – was gleich ist der Nacht –, gut sei; das innere Licht der Liebe aber gewahrte er nicht, obwohl es alleine das Sehen und Erkennen ausmacht. Und wer sich also vom Lichte wendet, der wird es mit der Zeit mehr und mehr missen und es wird notgedrungen auch stets kälter in ihm, und das ist es, was die Leute merkten an der Tochter dieses Vaters, dass sie zwar wohl schön sei, aber dennoch abweisend wie das Dunkel oder wie die Werke des äussern Verstandes, der äussern Höflichkeit und des bloss äusserlichen Liebesdienstes. Wohl jedem, der das noch erkennt und sich Rates holt bei einem, der noch vom Lichte durchdrungen ist oder gar direkt beim Licht der Welt, bei Jesus selber – durch seine Liebe zu ihm. Er wird noch schwer genug haben und sich am Rückweg noch lange genug verweilen.
Das sind die drei Väter oder Liebesarten: Die erste als die Unentwickelte, die zweite als die recht Entwickelte, die zurückführt zur Urliebe, und die dritte, die falsch Entwickelte, in Richtung von der Urliebe hinweg.
nach oben
WEITERER NACHTRAG  Die kleine eingeschobene Schilderung der häuslichen Verhältnisse bei der zweiten blinden Tochter ist ein Gleichnis des richtigen Verhältnisses im Menschen. Dabei stellt die Tochter das Gemüt dar und ihr jüngerer Bruder den Verstand; und die Szene verdeutlicht, wie der Verstand, welcher dem Menschen verliehen wurde, um in der äussern Welt zurechtzukommen – wie dieser Verstand auch nur stets mit dem Äussern beschäftigt ist und deshalb keine Zeit und keine Lust hat, sich mit dem Wesen der Liebe zu befassen, und zwar auf eine solche Art, dass die Liebe, welche im Gleichnis durch den Vater symbolisiert ist, ordentlich Gestalt annimmt. Deshalb wendet sich der Verstand oftmals auch gegen die Vorsehungen der Liebe Gottes und zerstört die Möglichkeiten der Einswerdung mit Gott und damit den innern und – als Folge – auch den äussern Frieden.
Wohl einem Menschen, der noch ein starkes Gemüt (im Bilde: ein für das Weltlicht blindes Mädchen) besitzt, das in einem unglücklichen Moment des Verstandes (wenn die Entwicklung äusserer Geschehnisse gegen jeden Verstand abläuft) seine durch die Liebe gestärkten Arme öffnen kann und diesem zuruft: "Komme zu mir (d.h. kehre dich zu mir, in dein Inneres), ich will es dir zeigen und sagen, wie sich die Sache verhält!" Wohl aber auch jedem Verstande, welcher sich vom Gemüte, als der innern Wahrnehmung, umfassen lässt, sich also gewissermassen gefangen nehmen lässt und stören lässt in seiner nach aussen gerichteten Tätigkeit. Und wenn dieser Verstand dann auch einmal einsehen und auch annehmen kann, dass das Gemüt in sich selbst ebenfalls ein Licht oder eine Wahrnehmung hat, so lässt er sich befruchten von den Wahrnehmungen des Gemütes (wie sich das Brüderchen küssen liess von seiner Schwester, dem für die Welt blinden Mädchen). Und das Gemüt, welches alles mehr nach der Liebe abwägt, beurteilt und bestimmt, wird dem Verstande aufzeigen, dass innere und innerste Gründe der Liebe und Vorsehung Gottes Grund dafür sind, dass die Entwicklung der äussern Dinge (nur scheinbar) oft gegen allen Verstand vor sich geht.
Der dadurch geläuterte Verstand kann nachher viel mehr erfassen, weil er sodann alles nach dem Grunde – und nicht bloss nach der Ursache – beurteilt; und für ihn wird dadurch dann der eigentliche Urgrund oder Gott erstmals auch tatsächlich ersichtlich, wie dem Brüderchen im Gleichnis der Geschichte der Vater ersichtlich wurde.
Das wäre dem Menschen unserer Zeit doch sicher sehr zu wünschen und insbesondere jedem, der an der jetzigen Zeit und den Zuständen der äussern Welt irre wird und zu zerbrechen droht. Ihm gilt auch der Satz der Schrift: "Ärgert dich dein Auge, so wirf es von dir! Es ist dir besser, dass du einäugig in das Reich Gottes gehest, denn dass du zwei Augen habest und werdest in das höllische Feuer geworfen..." (Markus 9. 47). Das heisst auch: Plagt dich der Verstand, so lege ihn von dir und suche das Innerste deines Gemütes auf und lasse dir von ihm etwas sagen. Auch dann, wenn du dieses "Etwas" anfänglich nur sehr verschwommen wahrnimmst und nicht viel damit anfangen kannst, denn es ist besser mit nur undeutlichen Vorstellungen auf dem rechten Weg zu sein (welcher zum Lichte führt), als mit deutlichen Vorstellungen die falschen Wege zu gehen.
Das Gleichnis der Geschichte aber zeigt auch, wie die Menschen geartet sind. Da gibt es viele "Brüderchen", die sich fragen: "Wo und wer ist Gott?" und nur ganz wenig "Schwesterchen" – oder der Liebe gehorchende Menschen –, die Gott als unsern Vater finden und seine Wege erkennen, obwohl doch beide stets um Gottes Führung sind (von Gott geführt werden), wie die beiden Kinder im Gleichnis der Geschichte um ihren Vater waren. Aber die einen kümmern sich bloss um das Ihre (d.h. um ihren Anteil, wie es der verlorene Sohn auch tat) und erkennen deshalb den Vater nicht ebenso gut und ebenso schnell, wie jene, die sich nur um die Wahrheit und die Liebe kümmern.
5.8.1986
nach oben
HEILIGER ERNST  Es begab sich einmal in einer grossen Stadt in der Welt, in einem grossen und glänzenden Konzertsaal, nach der Aufführung eines Mozart-Violinkonzertes, dass nach dem Leerwerden des Zuhörerraumes ein etwa zwölf-jähriger Knabe weinend und schluchzend gegen den Orchesterplatz lief und daselbst von einem Saalwächter angehalten und gefragt wurde, was ihm fehle, worauf er antwortete, dass er unbedingt mit der Violinspielerin reden müsse, weil er etwas wissen müsse. Auf die zweite Frage des Saalwächters, was er denn von ihr wissen müsse, sagte der Knabe nur, dass er ihm das nicht erklären könne. Die etwas laute Szene lockte aber einige Musiker zurück aufs Podium, darunter eben die Violinspielerin, was der Knabe sofort bemerkt hatte und sie unverwandt anblickte, sodass es auch der Saalwächter zu merken begann, der mit dem Rücken zum Podium stand; und er drehte sich um und winkte und gab der Violinspielerin zu verstehen, dass es um sie gehe, worauf die noch jüngere Künstlerin das Podium verliess und sich zu den beiden begab. Da nannte ihr der Saalwächter den Grund seiner Handlungsweise und die Künstlerin fragte den Knaben, was es denn sei, das er mit ihr besprechen möchte. Und der Knabe, der noch unsicher den Saalwächter ansah, sagte ihr, dass er das nicht so schnell sagen könne, worauf sich die Künstlerin mit einem freundlichen Lächeln setzte und der Saalwächter sich zu entfernen begann. Da begann der Knabe mit noch etwas unsicherer Stimme und hin und wieder etwas stockend ihr zu sagen, dass er noch nie ein so schönes Violinkonzert gehört habe, dass er aber dieses Konzert nicht zum ersten Mal höre und dass er glaube, sie, die Künstlerin, habe wohl den Mozart am besten verstanden. Natürlich erfreuten diese Worte das Herz der Künstlerin, obwohl sie nur von einem Knaben kamen, dessen Gesicht allerdings schön harmonisch geschnitten war und in dessen Augen zwar der noch kindliche Blick zu erkennen war, der aber für einen Knaben von zwölf Jahren einen ungemein schönen, sanften Ernst verriet, sodass die weitere Unterredung beinahe etwas Feierliches hatte und die Künstlerin ahnte, dass er sicher nicht alleine dieses Lobes wegen mit ihr reden wollte und fragte ihn darum, weshalb er ihr denn das habe sagen wollen; und der Knabe atmete tief auf und sagte dann, dass er stets finde, dass die Musik viel schöner und reiner sei, als dass sie die Menschen für gewöhnlich spielen würden und dass er besonders die Violintöne stets etwas "verzogen" und auf eine Art wie leidenschaftlich empfinde. Auch sagte er, dass er glaube, die Menschen legten absichtlich dieses Unreine hinein, weil es die Gemüter der Menschen und der Zuhörer eher errege und weil sie damit dem sonst reinen Tone ein eigenes, persönliches Gepräge verleihen und man dann an den Tönen den Künstler erkenne. Und er meinte weiter, dass das, wenn es manches Mal auch noch ganz schön klinge, dennoch das Unschöne und Eigenliebige der Menschen in die sonst reine Musik bringe, sodass nie – aber auch gar nie – auf der Erde etwas wahrhaft erhebend Schönes und Reines zustande käme. Und weiter sagte er, dass er heute, eben in diesem Violinkonzert, einmal eine Geige gehört habe, die keine menschlichen Verzerrungen oder Züge aufwies und dass nur die Reinheit der Tonfolge zu ihm gesprochen hätte – und ganz vorsichtig, beinahe zaghaft setzte er hinzu, dass er sie, die Künstlerin, nun eben fragen wolle, ob sie das wirklich absichtlich so gespielt habe. Das brachte nun aber die sonst aufrichtige Künstlerin etwas in Verlegenheit. Denn erstens war die Frage so tief gefasst und enthielt zweitens so viele, ihr erst jetzt als neu aufgehende Aspekte, dass sie wirklich etwas überfordert war, wollte sie eine ganz wahrheitsgetreue Antwort geben, und das wollte sie auf jeden Fall, denn dieser kindlich reine Ernst hatte sie selber ernster gestimmt, als sie sonst für gewöhnlich nach einer gelungenen Aufführung war. Und sie antwortete deshalb erst zögernd und nur mit der Zeit dann der vollen Überzeugung nach, dass sie zwar nie irgend eine Eigenheit in die Töne ihres Instrumentes habe setzen wollen, aber dass sie darüber auch noch nie in dem Sinne, wie er das erklärt habe, nachgedacht habe, sodass sie also nicht mit Bestimmtheit sagen könne, sie hätte das nicht gewollt.
Und der Knabe antwortete, dass er über diese Antwort glücklich sei, denn ob sie bis jetzt absichtlich oder unabsichtlich reine Töne spielte und damit ausschliesslich der Harmonie diente, sei ihm nun nicht mehr so wichtig, weil er nun gemerkt und gespürt habe, dass sie habe eine ganz reine und wahre Antwort geben wollen, und seine Augen wurden nass, was die Künstlerin tief berührte und auch bewegte, denn sie empfand es, dass in diesem Knaben noch alles heil und ganz war und dass er Recht hatte, obwohl man mit diesem Recht für gewöhnlich nicht sehr weit kommt.
Und etwas bewegt sprach der Knabe weiter: "Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie stets so spielen, wie Sie mir geantwortet haben! Ich habe, obwohl ich jung bin, überall schon in der Welt gesucht nach dem Wahrhaftigen und habe es nirgends gefunden – bis zu dieser Stunde nun. Alle Menschen, die mit mir sprachen, bewahrten in und mit ihren Worten ein eigenes Interesse für sich selbst und keinen noch, bis zu dieser schönen Stunde, sah ich eine Arbeit tun, nur um des Guten der Arbeit willen und nur darum, weil diese gute Arbeit dann auch Gutes unter den Menschen stiften würde. Ein jeder dachte auch – und zumeist zuerst – an sich und daran, was ihm selber eine Rede oder eine Tat einbringen würde; aber daran, was sie dem Fragenden oder dem Empfangenden bringen würde, dachte keiner zuerst und wohl kaum halbwegs auch zuletzt. Aber ich weiss es nun und habe es erfahren, dass es anders auch geht und ich wollte, dass ich es Sie ebenfalls spüren lassen könnte, wie schön das ist. Nur in den guten Märchen geht es sonst so zu und her, wie ich glaube, dass es richtiger und besser wäre, aber auf der Welt nirgendwo. – Aber ich muss nun gehen, weil ich zu Hause versprochen habe, zu der mir gesetzten Zeit zurückzukommen, aber ich brauche fürder auch kein Violinkonzert mehr zu hören, denn ich habe heute ein wirkliches gehört. – Ich wollte zwar, ich könnte Ihnen mehr geben – wie andere – zum Beispiel Blumen, oder, dass ich Ihnen helfen könnte, dass Sie noch an möglichst vielen Orten spielen können; aber – wenn ich das auch könnte und Sie damit erfreuen würde, so würden Sie dann vielleicht dennoch mit der Zeit auch mehr der Blumen und des Ruhmes wegen spielen. Leider ist es so auf dieser finstern Welt, dass nur der Kleinste und Ärmste nicht so schnell in eine Versuchung fällt. – Vergeben Sie mir die Härte meiner jetzigen Worte, dann können Sie darin auch das Süsse, das Heimatliche finden; ich wünsche es Ihnen von Herzen!"
Bei diesen Worten drehte sich der Knabe schnell um und verliess mit raschen Schritten den Konzertsaal, sodass die Künstlerin alleine im schon fast dunklen Raum zurückblieb und noch einige Zeit brauchte, um sich zu finden, denn zu sehr bewegt und auch bewegend waren diese Worte des Jünglings für sie gewesen.
Sie spielte dann noch etliche Male in derselben Stadt dasselbe Konzert. Aber stets mehr beschäftigte sie sich mit den Worten dieses Knaben, und stets bewusster und inniger wurde deshalb ihre Hingabe an diese Musik und reiner die Töne ihres Spieles, aber stets schaler tönte ihr der Applaus des Publikums in den Ohren.
Sie sah diesen Knaben nie mehr, so sehr sie es sich auch immer wünschte, aber – sie hielt dennoch stets weniger von Ruhm und Erfolg. In späterer Zeit, wenn sie wieder dieses Violinkonzert spielte, bekam sie oft feuchte Augen, und ihr Spiel wurde dabei so rein und schön, dass sie selber oft ihren eigenen Tönen lauschte, wie sie sich vorstellte, dass jener Knabe sie vernommen haben musste. Manches Mal auch, ja oftmals sogar, erhielt sie dann Anerkennungen von Menschen, denen sie anmerkte, dass sie ernster und reiner dachten und empfanden als die Übrigen; aber so rein und so ernst wie damals von dem Knaben von keinem mehr. Aber es freute sie dennoch zutiefst in ihrem Herzen, weil sie es spürte, dass es, wie der Knabe gesagt hatte, auch auf diese Art gehen würde, und sie merkte auch, dass diese Erfolge echt waren, dass sie also bleibende Wirkungen in den Menschen hervorzurufen vermochten.
Und als sie nach einem glücklichen und erfüllten Leben merkte, dass nun ein neuer Abschnitt – jenseits – zu beginnen war, da erst erkannte sie voll die Nichtigkeit des Äusseren und war froh, sich von einem unmündigen Knaben etwas gesagt haben zu lassen.
14.6.1982
nach oben
EINIGE WORTE ÜBER DEN ENTSPRECHENDEN SINN, DER IN DIESER GLEICHNISHAFTEN GESCHICHTE VERBORGEN IST  Die "Welt" stellt dasjenige Bild dar, das die Menschheit ihrer Aussenwelt oder ihren Aussenbeziehungen aufprägt. Sie ist also veränderlich, jedoch nur in jenem Masse, in welchem die Menschen als Ganzes der Veränderung fähig sind.
Eine Stadt in dieser Welt ist gleich einer Interessengemeinschaft. In einer Stadt begegnen sich nicht nur Menschen, sondern auch Gewerbe, Kunst und Handel. Sie ist die Stätte des Austausches und deshalb auch des intensiven Verkehrs.
Im engsten Sinne des Wortes ist ein jeder naturmässige Mensch in seinem Äussern gleich der Welt und in seinem Wesen gleich einer Stadt in dieser Welt. Denn in seinem Wesen kommt der intensive Austausch oder Verkehr aller seiner Eigenschaften und Wesenszüge zustande und aus seinem Wesen dann für andere zum Ausdruck. Im Wesen des Menschen streiten die äussern Notwendigkeiten (die Welt) mit den innern Wünschen und mit dem Bilde des Ideals (des Geistes). Aber auch die verschiedenen Interessen aus den äussern Notwendigkeiten streiten (oder verkehren) untereinander, wie auch die verschiedenen, noch unfertigen geistigen Bilder untereinander streiten (oder verkehren) und sich dadurch allmählich finden und ergänzen. Eine wahrhafte Stadt also, wo eine Fertigkeit der andern Dienste leiht oder aber auch eine Fertigkeit der andern Konkurrenz ist, wo Handel (Ausgleich) und Wandel (Fortschritt) herrscht.
Ein Konzertsaal, als eine Stätte der Kunst, ist gleich dem Sonntag (Sabbat) oder der innern, feierlichen Beschauung und Darstellung aller Möglichkeiten und Formen vor den Augen des Geistes. Man zieht sich – zumeist erst abends – aus der Welt in dieser Stadt zurück und betrachtet die innern Bilder als eine Quintessenz der vorherigen äussern Betätigungen. In diesen Konzertsälen (oder Beschauungen) finden wir Saalwächter. Sie sind gleich dem ordnenden Prinzip des Verstandes bei solchen innerlichen Beschauungen. Sie sind also gleich den äussern Gesetzmässigkeiten, sei es der geistigen oder der weltlichen; sie stellen – als Repräsentanten des Verstandes – die äussere Norm dar. Denn bei solchen Konzerten oder Beschauungen hören nicht nur kunstbeflissene und kunstbegeisterte Menschen zu, sondern auch solche, die durch das Zuhören erst verdeutlichen wollen, dass sie von Kunst etwas verstehen; dann aber auch wieder andere, die sich nur zerstreuen oder trösten wollen über die Unbill vergangener, mühsamer Arbeitstage; aber auch solche, die noch darin versuchen, ihre äussere Lage durch Geschäfte zu verbessern. Ist der Saalwächter noch hauptsächlich von der Welt und den Einwohnern der Stadt bezahlt, so lässt er, wie im Bilde, die grossen vor der Welt, die viel Geld haben, auf die vordersten Plätze, wie auch jene, die sich gross dünken und sich daher zeigen wollen; aber die echten Kunstliebhaber oder Liebhaber des Geistes lässt er weit hinten Platz nehmen, da sie zumeist nicht so viel weltlichen Reichtum zu sammeln vermögen wie die ersteren, weil sich ihre Aufmerksamkeit eben mehr auf den Geist konzentriert. Darum auch musste der Knabe (erst nach dem Leerwerden des Saales) zuerst auf den Orchesterplatz hinzu laufen. Die Violinspielerin, als Solistin, ist gleich der Seele in diesem Konzerte oder dieser Beschauung. Sie ordnet alle Töne in Bilder und diese Bilder zu einem Ganzen, und alle ihre weltlichen und geistigen Interessen oder Neigungen (die Zuhörer) nehmen diese Bilder zur Kenntnis und wissen und erkennen daraus, wo sie sind – wo ihr Platz ist. Sie wenden sich dementsprechend entweder von oder zu der Seele; bestürmen oder verlassen sie – und bestimmen auf diese Art die Richtung ihrer weiteren Entwicklung. Ist der Ton und das Spiel noch rein, so wenden sich die mehr äussern nach dem Konzerte bald hinweg, während die innern dann näher hinzukommen; ist der Ton und das Spiel aber weniger rein, so erdrücken die äusserlichen nachher eine solche Solistin beinahe, mit ihrem stürmischen Beifall und Zudrang. Und die weitere und spätere Ordnung (durch die Saalwächter – als dem ordnenden Prinzip des Verstandes) wird noch in verschärftem Masse die äussern Interessen bevorzugt behandeln. Ist aber in einer Seele, während ihrer Entwicklung, zwar die äussere Ordnung schon etwas stark geworden, aber ihr Spiel dennoch ursprünglich und rein, also aus der wahrhaftigen, reinen Liebe kommend, so kann und wird es auch zu wiederholten Malen geschehen, dass – durch solche Reinheit und Intensität der Liebe – ein Knabe im grossen Saal der vereinigten Interessen und Sinne der Seele geweckt wird, aufsteht und zu der Seele hineilt und sich mit ihr bespricht. Dieser Knabe, als ein Jüngling, stellt das Gewissen dar, als ein Kind des Geistes.
Es kommt aber eine solche Besprechung mit dem Gewissen nicht so leicht zustande, eben der äussern vom blossen Verstande her bedingten (Rang-) Ordnung wegen (Saalwächter), die eine ganz willkürliche und deshalb starre und tote Ordnung darstellt (wie alle äussern Gesetze, seien sie staatlicher oder kirchlicher Natur) und keine Rücksicht nimmt auf das Leben oder die Liebemöglichkeit und Lieberichtung der Seele und noch weniger auf die Interessen des Geistes. Darum wird es aber auch erst in geheiligten Momenten – das heisst: im von allen äussern Interessen geleerten Saal – möglich, dass die Künstlerin der Lebensbemeisterung, also die Seele, das Verlangen des Geistes durch die Stimme des Gewissens erhören kann. Und der Saalwächter steht dann plötzlich als Fremdkörper zwischen der Liebe der Seele und dem Gewissen, als der göttlichen Einsprache. Und dieses nur ganz zarte göttliche Wehen oder Einfliessen durch das Gewissen ist es auch, das andeutet, dass es nur durch längeres Verweilen der Liebe in der Wahrheit der Gottesnähe zu einem Austausch kommen kann, und dadurch bei der Künstlerin auch erreichte, dass sie sich setzte, das heisst entsprechend: dass sich die Seele zu erniedrigen und in dieser Erniedrigung (= Demut) zu ruhen begann, wonach erst der Saalwächter, als die äussere Ordnung, den geheiligten Ort verliess und der innern wahren göttlichen Ordnung den Raum überliess.
Das anfangs stockende Reden des Jünglings deutet an, dass zwar der Mensch vor allem durch ein Lob – das ihn aber wieder aus der Demut erheben und zum Eigendünkel führen könnte – zugänglich wird, und dass deshalb die Erkenntnis über eine gut ausgeführte Arbeit nur nach und nach kommen darf - aus dem Munde eines Jünglings gleichsam, dessen Erkenntnisse man nicht so hoch veranschlagt und seine Worte also nicht so ernst nimmt. Damit wird dann vor allem nur die Liebe und Zuneigung, anstatt der Eigendünkel erweckt. Und diese Liebe erst, als ein warmes Feuer, verbreitet in der Seele das Licht, in welchem sie erkennt, dass nicht das Lob der Zweck der Einsprache sei. Worauf erst dann das Gewissen fragt, ob das gute und gelungene Werk ein Bewusstes, also Selbstgewolltes sei oder nicht. Weil das Gute aber nicht im Menschen selber ist, sondern nur durch die Aufnahme der göttlichen Liebe wirksam zu werden beginnt, weiss die Seele nicht, wie sie zu dem Guten kam. Erkennt sie das und spricht es vor dem Gewissen, als der Stimme der Wahrheit, auch aus, so wird sie mit der Wahrheit völlig einig und diese kann in sie dringen und sie durch und durch erleuchten. Und erst in diesem hellen Lichte wird die Seele dann jene (göttliche) Liebe entdecken, die ihr alles zutragen will, aber nicht selber Hand anlegen darf, ihrer Willensfreiheit wegen. (Damit die Seele nicht durch einen ihr noch fremden Gotteswillen vollendet wird, sondern aus ihrer eigenen Einsicht und dem daraus resultierenden eigenen Liebewillen – freilich mit göttlicher Beihilfe –, weil schlussendlich nur der eigene Wille eines Menschen Eigentum sein kann, in welchem alleine er glücklich oder selig werden kann.) Und die Seele wird erkennen, dass der nur sparsame Lohn auf Erden eine Bedingung und ein Garant ist für eine von weltlichen Interessen möglichst ungetrübte innere Entwicklung der Liebe, hin zum Bilde Gottes. Der Knabe sagt auch, dass er bis zu dieser Stunde – der Leerwerdung des Saales von weltlichen Interessen – noch nie das Wahrhaftige so rein gefunden habe und deutet durch seine Tränen an, dass das Reine und Wahrhafte nur aus der Liebe kommt. Aber seine ihm von den Eltern (Liebe und Wahrheit) gesetzte Zeit ist um und er muss sich von der Künstlerin (Seele) trennen, damit diese durch seine Anwesenheit nicht zu sehr belohnt und eitel gemacht wird; und diese Seele ist wieder alleine in dem von Dunkelheit erfüllten Saal. Denn die erste wahrhaftige Erkenntnis durch die erste Begegnung mit dem göttlichen Geiste hat stattgefunden, aber verlangt nun auch, dass diese vorläufige, erstmalige Einigung im Lichte der Erkenntnis auch zu einer lebenswarmen tatsächlichen und dadurch bleibenden Wirklichkeit wird, welche alleine ein Wesen für bleibend selig machen kann. Oder mit andern Worten gesagt, ist das Samenkorn gelegt worden und die mühsame, weil durch das Dunkel der erdgebundenen Sorgen überschattete, aber durch die göttliche Beihilfe gesegnete Entwicklung kann beginnen und – wenn sie so verläuft, wie im Bilde beschrieben – wird die Seele am Ende ihrer Äusserlichkeit – bei ihrem Hinscheiden – erkennen, wie gut es war, auf den Rat eines vor der Welt als unmündig geltenden Knaben (auf das Gewissen) gehört zu haben und vor allem das Innere gepflegt zu haben, um in dieser Zeit, da sie vom Äussern endgültig in ihr eigenes Inneres den letzten Schritt ganz zu vollziehen hat, ein ihr schon Bekanntes und Vertrautes vorzufinden.
27.2.1984
nach oben
DER VOGEL UND SEIN FLUG  Es war einst ein Vogel, der liebte das Fliegen sehr. Und nichts bereitete ihm grössere Freude, als dahinzufliegen über Felder und Wälder und alles zu sehen und an allem teilzunehmen, ohne dass er dadurch von seiner Freiheit einbüssen musste. Es hatte aber dieser Vogel, der im Grunde eine Taube war, auch eine grosse Zuneigung zu den Menschen, um die er nicht wusste, aber der er stets nachgab, indem er immer wieder ihre Nähe aufsuchte, wohl wissend, dass er dadurch seine Freiheit, sich über diese Menschen erheben zu können, nicht verlor.
Da geschah es aber einmal, dass er sich einem Menschen näherte, der den Vogel genau erkannte und einsah, wie wohl diesem Vogel der Menschen Nähe tat; aber auch bemerkte, wie sehr sein Hang zur Freiheit, und sich über die Menschen zu erheben, ihn von der gar beseligenden Verbindung zu den Menschen abhielt. Und dieser fing den flüchtenden Vogel ein und beschnitt ihm seine Flügel und sperrte ihn in einen engen Käfig.
Nun wurde dieser Vogel aber sehr traurig und sann, wie er aus dem Käfig kommen könne, und in wilder Hast flatterte er – des Fluges nun unfähig -– in dem Käfig hin und her und fand dennoch kein Loch zum Entweichen. Erst mit der Zeit und der durch die übermässige Anstrengung eintretenden Schwäche wurde er ruhiger und ruhiger und eine stille Trauer und tiefe Verzweiflung bemächtigte sich seiner. Und sein Leid steigerte sich ins Unermessliche, wenn er andere Vögel über sich hinweg fliegen sah. Und die Einsamkeit wurde zu seinem zweiten Käfig und von Sinnlosigkeit war sein Herz erfüllt. Und er nahm am Ende nichts mehr wahr, selbst nicht einmal mehr das Hinwegfliegen seiner Artgenossen über seinen Käfig.
Wie völlig tot gebärdete er sich und stellte am Ende auch Trinken und Fressen ein. In dieser Betäubung aber geschah es einmal, dass er plötzlich merkte, dass derjenige Mensch, der ihn gefangen hatte, schon längere Zeit neben ihm sass und mit ihm sprach. Und es mutete ihn merkwürdig an; denn eines Teiles tat es ihm wohl und andern Teiles verstand er dennoch nicht, was dieser wollte. Aber das längere Sprechen öffnete dennoch sein Gemüt und je länger er zuhörte, desto mehr erweiterte sich in seinem Gefühle sein Käfig, sodass er ihm nicht mehr als Schranke vorkam, und er sich freier zu fühlen begann.
Und sein Zutrauen zum Menschen wuchs, wenn vielleicht auch nur deshalb, weil er sich in der langen Zeit seines Kummers voll bewusst wurde, dass es gar kein Entweichen gab. Dennoch zuckte er überrascht zusammen, als ihm sein Meister nun einen süssen Kern mit seiner Hand in den Käfig hielt und es brauchte noch längere Zeit bis er zu versuchen begann, sich beherzt der Hand zu nähern und den süssen Kern zu nehmen. Obwohl er zwar Hunger hatte, so war es vielleicht eher die Möglichkeit, die er wahrzunehmen begann, dass er anstatt flüchten und sich zu entfernen auch sich nähern könnte.
Und als der ihm angebotene Kern, den er endlich aufpickte, gar zu süss schmeckte, da erst bekam er eine richtige Freude daran, die Annäherung seines Meisters Hand nicht erst abzuwarten, sondern selber sich ihr zu nähern. Und dennoch prüfte er jedes Mal vor dem Aufpicken des Kerns, ob es vom Meister so gewollt und gedacht sei. Und das war gut so, denn sonst wäre er in seiner Art zu eigensinnig geworden und es wäre wohl einmal passiert, dass er von des Meisters Hand festgehalten worden wäre, wenn er zu selbstsicher den Kern genommen hätte, was ihn dann erschreckt hätte und sein Zutrauen und sein Verhältnis zum neuen Meister für längere Zeit zerstört und unterbrochen hätte. So aber, wie er es tat, ging er stets mehr auf seinen Meister ein und mit der Zeit erkannte er bald einmal, was dieser wollte und ging willig auf seine Wünsche ein.
Und in der Annäherung lag für ihn nun ein so schönes, unbenennbares Gefühl, welches sich seines ganzen Gemütes bemächtigen konnte, dass er nun schon bald einmal – eben bei der Annäherung nur – seinen Käfig, an den er sich im Übrigen schon längst gewöhnt hatte, als lästige und brutale Schranke empfand. Als das sein Meister bemerkte, da öffnete er ihm den Käfig und hiess ihn herauskommen.
Und wie er herauskam, bemächtigte sich seiner ein merkwürdiges Gefühl, das ihn äusserst drängte und beengte, sodass er wieder in den Käfig zurückwollte. Und dieses Gefühl bestand in der unbewussten Erkenntnis, dass eben nur die Schranke ihn so nahe zu seinem Meister brachte und also mit dem Wegfall der Schranke auch das ungewollte Muss fiel. Er war zwar freier, aber diese Freiheit beengte ihn, indem er sie sich selber erkämpfen musste, wenn er nicht der Versuchung erliegen wollte, in seine ihm angeborene Flucht zu verfallen, und er erkannte, dass darin – in der Flucht zur vermeintlichen Freiheit nämlich – eben eine viel grössere Schranke lag als in dem Käfig.
Natürlich konnte der Vogel das nicht so gesondert, wie hier beschrieben, empfinden; genau gleich, wie diese Gefühle auch ein Mensch bei seiner ersten Bekanntschaft mit dem göttlichen Meister nicht voll zergliedert erkennen kann; aber den Schluss konnte er genauso gut ziehen wie der erwähnte Mensch, und diesem Schluss zufolge ging er wieder in den Käfig.
Da aber der Meister eigentlich die volle Freiheit des Vogels im Auge hatte, nebst der grösstmöglichen Beseligung, so richtete er es nun so, dass er seltener zum Käfig kam, diesen aber hin und wieder offen liess. Und der nachlassende Kontakt mit seinem Meister verdross den Vogel sehr, und er war nicht mehr so munter wie zuvor. Und mit der Zeit wurde er gleichgültiger bei der seltener gewordenen Annäherung seines Herrn und Meisters. Da gab ihm der Herr die süssen Kerne nicht mehr mit der Hand, sondern legte sie in eine Schale und entfernte sich. Wie nun aber der Vogel die süssen Kerne aufzupicken begann, da erinnerte er sich seines ersten Kerns, den er aus der Hand seines Meisters genommen hat, und er empfand eine heftige Zuneigung zu seinem Herrn, liess das Fressen bleiben und floh aus dem offenen Käfig zu seines Herrn Füssen. Dieser bückte sich sachte und hob ihn auf, und der Vogel gewahrte zum ersten Mal, dass nun nicht er – trotz seiner Flucht – zu seines Meisters Händen kam, sondern des Meisters Hände zu ihm auf den Boden kamen und ihn aufhoben. Auch merkte er während des Aufhebens, dass er nun eigentlich auch seinem früheren Fliegen gleich erhoben war über alles, aber er empfand auch zugleich die Geborgenheit eines Jungvogels in seinem Nest.
Und er war glücklich in der Hand seines Meisters, die ihn nun ganz trug, während sie ihm bis anhin nur die Nahrung reichte. Aber erst später im Käfig – und damit in der Erinnerung – erkannte er die Seligkeit des Erhobenwerdens, das ein Fliegen und damit eine Freiheit war, die dennoch ebenso eine Geborgenheit war, sodass er die Freude seiner Kindheit mit der Freude seiner Freiheit verbunden sah und dem Urheber dieser Gefühle noch mehr Zuneigung entgegenbrachte, als er bisher für möglich hielt.
Nun waren stets mehr und mehr alle seine Gedanken bei seinem Meister und er ging oft aus seinem Käfig auf seinen Meister zu und er folgte diesem bei aller seiner Arbeit und allen seinen Handlungen. Dabei merkte er, dass die allerbesten und allersüssesten Samen nicht einfach wuchsen, sondern dass sie sein Meister zuerst in den Boden legte und dass dann über dieser Stelle längere Zeit später erst viele solcher Kerne zum Vorschein kamen; und er liebte seinen Meister darum, weil er erkannte, dass dieser absichtlich diese süsse Speise vermehrte, und nie mehr nahm er Kernen, ausser sie wurden ihm vom Meister gereicht. Dafür hatte er aber unter hundert auch nicht einen einzigen schlechten.
Und er konnte nicht mehr begreifen, wie alle seine Verwandten wahllos alle Körner zusammenpicken konnten, und in seinem Gefühle verband sich das vorsichtige Annehmen der Nahrung mit dem Eindruck seines neu empfundenen Glückes, das wir Menschen als Dankbarkeit bezeichnen. Diese Dankbarkeit aber führte zu äusserster Genügsamkeit, und diese wieder zu völliger Hingabe an seinen Herrn; und diese erst zu voller Einsicht in alle Dinge und zur Seligkeit.
Und diese wiederum wurde nur einmal noch ein wenig gestört, als der Meister ihn einmal auf einen hohen Gegenstand setzte und ihn dort längere Zeit sitzen liess. Als der Vogel dann nach ihm zu rufen begann, nahm der Meister einen Kern in seine Hand und forderte ihn auf zu ihm zu fliegen, denn er wusste, dass seine Flügel wieder nachgewachsen waren. Lange Zeit aber wollte der Vogel nicht, denn eines Teiles wusste er wirklich nicht, dass er wieder Fliegen konnte und andern Teiles war ihm das Fliegen, das ihn an seinen frühern Zustand erinnerte, zuwider. Da legte der Meister den Kern zu des Vogels, Füssen und dieser pickte ihn auf. Aber das Aufzehren erinnerte ihn an die erste Malzeit im Käfig ohne die Nähe seines Herrn; und ohne zu überlegen flog er zu des Meisters Füssen und dieser hob ihn wie gewöhnlich auf.
Und das war sein erster guter Flug; indem er die Freiheit des Fluges dazu verwandte, um zum Meister zu kommen und – in seiner Hand geborgen – erhoben zu werden, anstatt sich selber zu erheben.
Auf diese Art wurde der Vogel zu einem ganz besondern seiner Gattung, denn er konnte zwar wieder fliegen, benützte diese Gabe aber nur, um sich in Geborgenheit zu begeben. Er kannte auch alle Samen und Kernen, aber er hatte nur Lust und Liebe zu jenen aus der Hand seines Meisters. Kurz, er hatte alles und alles war ihm nichts, es sei denn, es kam von seinem Meister und so hatte er auch nichts ausser seinem Meister, aber in und mit diesem dennoch alles. Und so wurde er einer, der wie im Gleichnisse in der Schrift alle seine Perlen verkaufte zum Erwerb dieser nur einzigen Perle, die den Wert aller andern übertraf. Obwohl er dies Gleichnis nicht kennen konnte. Aber er erkannte, dass er nur durch seinen Meister zu diesem Tausch kam und das machte ihn nicht nur glücklich und liebeglühend, sondern bewahrte ihn auch vor Überhebung.
Darum sollte auch, wer sich im freien Flug der freien Willensentfaltung durch äussere Schranken jäh gehemmt sieht, bedenken, was diese bedeuten, und sollte seinen Käfig zwar nicht lieben aber annehmen lernen, und den Meister nur lieben, der ihn gestellt hat für eine Höherentwicklung zu seiner Beseligung, und zu einem Schutz errichtet hat vor Überhebung.
1.7.1983
nach oben
BILDBETRACHTUNG  (Betrachtungen über das Titelbild auf dem Deckblatt)
Wenn wir das von Rudolf Koller gemalte Ölbild, eine Bauernfamilie bei der Malzeit auf dem Felde darstellend, betrachten, so sind wir innerlich angesprochen und zugleich fast wehmütig berührt, dass solche Zeiten nicht mehr sind.
Solche Zeiten sind aber der entsprechenden, innern Wahrheit gemäss immer noch und werden es auch immer sein und bleiben. Denn das wird jeder Mensch in sich selber antreffen, dass der Geist – im Bilde durch den Vater dargestellt – in ihm sich ruhend verhält, ihn also nicht drängt. Erst wenn die durch das Fleisch des materiellen Leibes etwas schwerfällige Seele – im Bilde durch das Weib dargestellt – sich über ihre materiellen Interessen zu erheben beginnt und damit dem Geist zu dienen beginnt, indem sie seinen Anforderungen entspricht und durch diese neue Tätigkeit ihrem Geiste ähnlicher wird, den Geist also gewisserart zu ernähren beginnt, so wird dieser in der ihm immer mehr entsprechenden Seele immer freier und wird sich in dieser Freiheit endlich vollständig erheben und das ganze noch unbearbeitete Feld ganz alleine zu bearbeiten beginnen und diese Arbeit in kurzer Zeit auch vollenden. Und die Seele – durch das Weib dargestellt – wird dabei nicht viel mehr zu tun gehabt haben, als dass sie in sich tätig geworden war nach der rechten Ordnung des in ihr ruhenden Geistes, wobei sie durch die Werke der Liebe den Geist gleichsam weckte und nährte oder ihn frei machte. Dann aber wird sie stehend staunen über die grosse Tätigkeit und Wirkungsmacht des Geistes und es wird zutreffen – angesichts des grossen Feldes – , dass sie zu sprechen beginnt und aus tiefster Einsicht sagen wird, nachdem sie alles getan hat, was der Geist von ihr fordert, dass sie dennoch nur eine faule und unnütze Magd war (ganz ähnlich der Bibelstelle in Lukas 17. 7). Denn das Feld stellt ja ihr eigenes Gemüt dar, das – wenn es dem Geiste (Gottes) durch den Liebedienst nach seiner Ordnung zur Verfügung gestellt wird – aus seiner Kraft in der Seele vervollkommnet wird – zur grossen Freude und Seligkeit der Seele.
Ihre Kinder aber, die ja dann in Wirklichkeit die Kinder des Vaters sind, stellen die guten Werke dar, die ebenfalls nur Werke des göttlichen Geistes sind, da ja nichts Gutes im Menschen liegt, es komme denn vom Vater oder vom Geiste. Darum auch die Kinder, zusammen mit dem Vater, am Boden der Erde dargestellt sind, weil sie eben vom Vater herrühren und ihm also gleichen müssen, weil der Vater unter allen der Demütigste ist, da er sich in seinem Sohne von seinen eigenen Geschöpfen ans Kreuz nageln liess; darum er aber auch in seiner demütigsten und jedem Geschöpfe nur dienenden Liebesorge der Grund und Boden jedes Engels und endlich auch der ganzen Schöpfung ist. Die Kindlein aber werden auf dem vom Vater bearbeiteten Feld gute Zeiten haben und schnell wachsen können. Das heisst, dass die guten Werke in dem vom Vater von aller Selbstsucht gereinigten Herzensgrunde der Seele einen guten Boden finden und deshalb in ihrer Wirksamkeit schnell wachsen können, weil die Einsicht durch die wachsende Liebe stets vertieft wird.
Und darum ist und bleibt dieses Bild ein Bild der guten Ordnung und der Wirklichkeit des innern seelisch-geistigen Lebens und wird nie alt. Alt werden nur die Menschen, wenn sie sich zu weit von dieser Ordnung der väterlichen Liebe entfernen und sich dabei dann oft noch erfahrener und erwachsener vorkommen als zuvor - wo es doch anderseits geschrieben steht, dass den Kindlein das Reich Gottes gehöre (Markus 10. 14).
nach oben
|