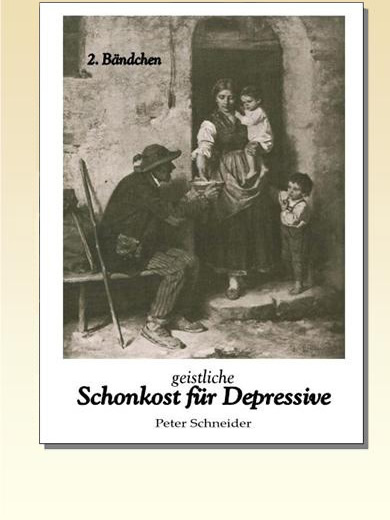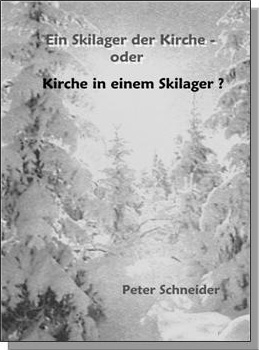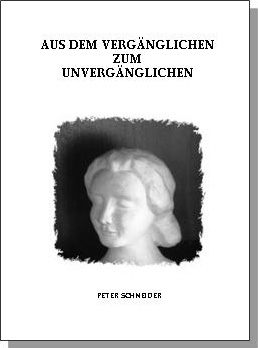Zum Verständnis über die folgenden Texte
Alles, was der Mensch von aussen her (über Worte) vernimmt, kann er glauben oder auch nicht glauben. Alles, was er hingegen selber erfahren hat, das weiss er bestimmt! Nur fragt es sich dabei, ob er es auch begreift, weshalb er etwas erfahren hat, das er nicht selber gesucht hat, zum Beispiel einen Unfall, eine Krankheit, eine Ausgrenzung oder ein inneres, seelisches Leiden. Ist seine Erfahrung gravierend, so bleibt er zumeist einsam, weil ihn alle andern Menschen ohne eine solche oder ähnliche Erfahrung gar nicht wirklich, das heisst in der ganzen Tiefe der Empfindung, verstehen können.
Es kann mit der Zeit zwar "Gras" über ein solch verwundendes Ereignis oder eine solche Erfahrung wachsen, aber für sich selbst bleibt die Erfahrung als etwas seinem Wesen Fremdes bestehen. Und schon ein kleines Vorkommnis ähnlicher Art reisst die Wunde – das Loch, das nicht zuwachsen will, sondern immer nur vom äussern Gang der Dinge leicht zugedeckt wird – wieder auf. Das ist eine Erfahrung, die viele schon gemacht haben und darum auch kennen. Nur ein jeder auf eine andere Art.
Die hier folgenden Texte sind so geschrieben, dass sie Menschen mit solchen Erfahrungen ansprechen. Wenn der Leser darauf achtet, wird er bald einmal merken, dass diese Texte ganz unvermerkt oder versteckt diese Wundnarbe durch ein aufkeimendes Verständnis und einer daraus hervorquellenden Hoffnung heilend zu beleben beginnen, wie eine wohltuende Salbe eine leibliche Wunde.
Gesunde spüren das viel weniger, denn wo keine Wunde vorhanden ist, da ist auch keine heilende Wirkung zu verspüren. Ob diese Texte einer tiefern Wahrheit entspringen, vermag nur derjenige zu beurteilen, den sie belebend berühren. Sie sind deshalb auch nur für ihn geschrieben – genau gleich, wie eine Wundsalbe auch nur für Verwundete hergestellt wird. – Und eine volle, das heisst innere, seelische Genesung wünsche ich allen, die sich ehrlich und vorzugsweise gerade darum bemühen.
|
|
VORWORT  Für alle innern, seelischen Vorgänge gibt es im Äussern, Materiellen entsprechende Bilder. Solche Bilder sind nichts anderes als eine sättigende Nahrung für eine hungrige Seele. Weshalb? Weil sich eine lichthungrige Seele immer in einer eingeengten Lage befindet und darum mit ihrem ganzen Gemüte nach Möglichkeiten zur Besserung ihrer Lage sucht. Was noch so fundierte Erklärungen in diesem Falle fast nicht mehr bewirken können, das können immer noch Farben und Töne, Bilder und Harmonien. Denn die durch Umstände geschwächte Seele hat zu wenig Kraft, mit ihrem Verstande tieferen Gedanken und noch so klaren Überlegungen zu folgen. Ein fertiges Bild jedoch kann sie sofort mit einer Ahnung erfüllen und dadurch beleben, dass sie wahrnimmt, dass es Antworten auf ihre Fragen gibt, was sie zuversichtlich stimmt. Wenn dann durch eine andeutungsweise Erklärung eines solchen Bildes eine solch empfundene oder erlebte Ahnung zu einer wenn vielleicht auch noch nicht völlig verstandenen Gewissheit wird, so stärkt diese Gewissheit die Zuversicht, beruhigt dadurch das ängstlich gewordene oder gar hoffnungslos bedrückte Gemüt und wird dadurch zu einer wahrhaften Speise der Seele, weil die Sättigung der Seele immer nur über ihren Geist erfolgen kann. In einem solchen Falle war die Ahnung gleichsam der Vorgeschmack der Speise, und die darauf folgende Erklärung die Bestätigung, dass in dieser Ahnung bereits die Kraft zur Stärkung liegt, sodass sie die Seele gerne in sich aufnimmt oder schluckt.
Was eine aufgehende Sonne einem nächtlichen Wanderer ist, das sind erklärte Bilder der nach Licht dürstenden und nach Liebe hungernden Seele. Denn wie der nächtliche Wanderer durch das allmähliche Hellerwerden seiner Umgebung stets klarer erkennt, wo er sich befindet und in welche Richtung er weiter schreiten soll, so ist die Ahnung und eine Erklärung über den Grund einer solchen Ahnung eine Erkenntnishilfe und ein Trost für den auf trübem und nächtlichen Lebenswege Wandernden, der seine weitere Umgebung etwas beleuchtet, sodass er wieder mehrere Möglichkeiten sieht, an einen sichern Ort zu gelangen.
Wenn wir anfangs festgestellt haben, dass sich eine lichthungrige Seele immer in einer eingeengten Lage befindet, so müssen wir hier auch den Grund dafür finden. Einem Menschen, dem alle Umstände hold zu sein scheinen, wird doch kaum in den Sinn kommen, nach Weiterem oder gar nach Besserem zu suchen. Darum sind alle Sucher nach Licht in einer für sie misslichen oder eingeengten Lage. Selbst solche, die gute Lebensumstände für sich haben, sind – sobald sie nach Licht suchen – in einer eingeengten Lage. Denn das innere Licht scheint nicht in vielen Menschen, und wer der Gerechtigkeit, der Ordnung und der Liebe zum Nächsten durch sein Empfinden verpflichtet ist, der findet das Gewünschte nicht so leicht. Bei solchen Menschen ist es bloss ihr Wunsch nach Gerechtigkeit und Ordnung, der sie am Bestehenden leiden lässt; selbst dann, wenn die Unordnung dieser Welt im Materiellen zufällig einmal zu ihren Gunsten ausfallen würde. Solche Menschen leiden viel in ihrem Innern ohne eine direkte äussere Veranlassung. Sie sind es aber auch, die das Licht der Erklärungen von äussern Bildern am ehesten aufnehmen können, weil sie frei von Selbstmitleid und vom Bedauern über ihre äussern Umstände sind, darum dankbarer und aufnahmefähiger bleiben als jene, die durch auf sie direkt einwirkende äussere Umstände erst zum Suchen des Lichtes kommen. Denn in den zuletzt Genannten bleibt zumeist ein Hader mit ihrem "Schicksal" zurück, der sie missmutig zur Aufnahme des Lichtes macht, weil sie im Grunde gar nicht das Licht (der Erkenntnis) suchen, sondern bloss die Wohlfahrt ihres leiblichen Seines.
Aber immerhin, nach vielen missglückten Versuchen, aus ihrem sie einengenden Tale heraus zu kommen, werden sie sich an "ihr" Tal ebenso gewöhnt haben, wie an die durch das stetige Suchen erhöhte Tätigkeit, sodass sie durch die Tätigkeit an sich schon eine gewisse Genugtuung erhalten und fortan durch diese auch stetig mehr Licht, das sie auch dann noch erfreuen wird, wenn es im allgemeinen nicht immer gerade zur Verbesserung ihres momentanen äusseren Zustandes Wege zeitigt. Dann werden auch solche dankbarer und aufnahmefähiger, ja sogar hungriger nach Licht um des Lichtes willen und der Wärme willen, die ein Licht in ihrem Gemüte bewirken kann, solange sie in ihm tätig verbleiben.
Und diese fortgesetzte innere Tätigkeit ist schon das eigentliche wahre und unvergängliche Leben, das mit dem Aufhören der Leiblichkeit (also mit dem Tode des Leibes) nicht aufhört, zu sein. Diese verstehen dann auch die Worte der Bibel aus eigener Erfahrung besser und richtiger, wenn es heisst, dass das Himmelreich nicht im Äussern zu suchen ist, sondern inwendig im Menschen ruht, bis er es durch seine stetige innere Tätigkeit zu wecken beginnt und die Seligkeit, die eine solche demütig sich hingebende Tätigkeit im Gemüte einer Seele erzeugt, immer wonnevoller einzuschlürfen beginnt, das heisst in sich als eine Kostbarkeit aufzunehmen beginnt. Das ist beim Lesen dieses zweiten Bändchens über die geistige Schonkost für Depressive leicht wahrzunehmen – wie es schon beim ersten augenfällig hat werden können.
Damit uns diese innere Schau aber bleibt, müssen wir willens werden, die uns in diesen Bildern dargereichte Kost auf dem grossen Gebiet der materiellen Erscheinungen dieser Welt selber zu suchen durch vertieftes Betrachten und Vergleichen des Betrachteten mit unsern inwendigen Gefühlen und dann vor allem auch durch unser dem Erkannten entsprechenden richtigen Handeln, auch wenn es einmal gegen unsere äussern Interessen geschehen müsste. Dann wird in uns eine Welt erstehen, die uns bleiben wird, weil der Schöpfer der materiellen Welt alles so gestaltet hat, dass es der uns eigenen innern Welt zur Grundlage dienen kann. Der Wunsch, dass das bei Vielen möglich wird, ist der Grund zur Entstehung dieser beiden Bändchen.
–––––––––––––––––––
17.4.2007
nach oben
ZUM TITELBILD  Was ist wohl ärmlicher in dieser Welt als der Verstand? Stets beschäftigt er sich mit äussern, vergänglichen Dingen; nichts ist sein Eigentum! Ist es darum verwunderlich, wenn er – alt und müde geworden – sich nach etwas Stärkendem sehnt, nach einem Zuhause und etwas Wärme. – Und wer sonst als die Liebe hätte die Kraft, ihn wieder etwas zu erwärmen für die innern Bilder und Vorstellungen der Seele und ihn damit zu lösen von den Verstrickungen mit der äussern, gesellschaftlichen und politischen Welt?
Sie – die Liebe – ist es, die ihm bessere Speise bringt und ihn mit Ewigem sättigt; die ihm mit ihren beiden Kindern – der Anhänglichkeit und der Vorsicht – entgegenkommt.
Wohl ist es oft dunkler in ihr als die Aussenseiten der Welt, aber es liegt die wärmende Kraft alles Lebens alleine in ihr.
–––––––––––––––––––
nach oben
EIN SKILAGER DER KIRCHE, ODER KIRCHE IN EINEM SKILAGER  Weil die Kirchen ganz im Allgemeinen keinen Zulauf mehr haben und um ihre Mitgliederzahl bangen müssen, lassen sie sich vieles einfallen, das sie ihrer Meinung nach attraktiver gestalten müsste. Da sind zum Beispiel Familien- und Diskussionsabende, Wanderwochen, Ferien- oder Skilager. Aber das bedenken die Verantwortlichen der Kirchen nicht, dass sie damit zugeben, dass solche Dinge für die Menschen interessanter sind als die Kirche selber und vor allem auch: dass sie ohne Kirche zu haben sind. Nur solche Menschen, die in sich noch einen Zug verspüren, auch im Alltäglichen das Religiöse nicht ganz ausser Acht zu lassen, begeben sich dann in solch kirchlich veranstaltete Weltvergnügen, die im Übrigen aber ganz denen gleichen, die nicht kirchlich veranstaltet werden - nur mit dem Unterschied, dass in den kirchlichen vielleicht einmal gemeinsam gesungen wird, vielleicht sogar auch gebetet, kurz gesagt: dass sie ein wenig kirchlich überzuckert werden.
Einmal besorgte ein jüngerer Pfarrer ein solches Skilager. Er kannte zwar die Problematik und war sich auch bewusst, dass es keine Aufgabe der Kirche ist, ein solches Lager zu betreiben; aber er sah sich durch den Mangel an Interesse an Kirchlichem – ja immer mehr an Christlichem ganz allgemein – dazu veranlasst, Interessantes aus der Welt in einem kirchlichen Rahmen anzubieten, um so wenigstens die äussere Institution der Kirche am Leben zu erhalten.
Eigentlich war er eine feurige und von Gott begeisterte Seele, nur hatte er in der Ausbildungszeit während seines Studiums nicht viel praktische Hilfe erhalten, Gott, den Lebendigen, zu finden, sondern eher nur die Gelegenheit gehabt, die Formen der Kirche zu erlernen. Aber weil er feurig war, witterte er überall herum, und wo er gottbegeisterte Menschen fand, da fragte er nicht viel nach kirchlicher Zugehörigkeit, sondern sonnte sich bald in der brüderlichen Einheit der nach Gott Dürstenden.
Er kannte durch seine ihm anvertraute Jugend auch den Vater eines ihm sehr angenehmen Schülers. Dieser ging zwar wenig in die Kirche, aber beschäftigte sich innerlich stark mit Gott und es war ihm gut anzumerken, dass er Gott – seinem Wesen nach – gut kennen musste. Mit diesem zusammen hätte er gerne das Lager geführt. Indessen war es diesem nicht möglich, zu der festgesetzten Zeit eine volle Woche Ferien zu nehmen. Und so freute ihn auch die Zusage für bloss einen Tag. Es war der Freitag.
Schon am Donnerstagabend traf der besagte Vater im Lager ein, was den Pfarrer sehr erfreute. Denn sie sprachen sich kurz, aber herzlich aus und der Vater des Zöglings machte ihm den Vorschlag, am Freitagmorgen früher als sonst üblich und auch als eigentlich geplant auf eine Skiwanderung zu gehen, und zwar auf einer Route, die er selber schon kannte und auf welcher er dann zu der vereinten jungen Schar auch sprechen wollte. Diese kurzfristig anberaumte Umstellung des Programms liess natürlich alle Jugendlichen, alle Teilnehmer des Lagers, in eine erhöhte Spannung geraten. Sie spürten, dass etwas in Bewegung geraten war, wussten aber noch nicht so recht, was.
Am Freitagmorgen früh waren alle nach einem guten Frühstück zum Start bereit und wurden von dem Vater des einen durch ein kleines, aber schön gestaltetes Seitental in die Höhe geführt. Die Stille in diesem Tal, sowie der Schatten der Berge, der noch auf dem Tal lag, nebst der Erwartungsspannung, liess einen gewissen Ernst spürbar werden, zumal der Führer dieser Partie – eben der Vater des Jungen – vorgeschlagen hatte, zu versuchen, bis zur Erklimmung der vollen Höhe kein einziges Wort zu wechseln, um möglichst tief die Stimmungen zu erfahren, die sich auf dieser Wanderung ergeben werden.
Anfangs war nur der Himmel hell. Das Tal und die verschneiten Bergflanken mit ihrem teilweisen Tannenbewuchs erschienen noch in dunklem Blau. Mit dem immer mehr aufkommenden Licht und einem gelegentlich direkten Sonnenstrahl, der durch den verschneiten Tannenbestand eines Bergeinschnittes bereits das Tal berührte, sah man jedoch bald einmal immer häufiger einzelne Schneekristalle da und dort herausglitzeln, je nach dem Lichteinfall und dem jeweiligen Standort der wandernden Betrachter. Die von der Schneelast niedergedrückten, hängenden Äste der Tannen ergaben im Gemüt der Menschen ein zwar schweres aber friedvolles Gefühl der Ruhe. Es war keine Starre, sondern eher ein sachtes Nachgeben, ein Dulden und Erdulden, das man aus diesem Naturbilde spüren konnte.
Längere Zeit durchwanderten sie schon dieses Tal auf ihren Skiern, als dann endlich die Spitze der einen Bergflanke von einem direkten Sonnenstrahl getroffen wurde. Ein herrliches, rotgoldenes Licht strahlte in die mittlerweile etwas höher gestiegene Menschengruppe von daher zurück und belebte ihre Gemüter. Der Schnee auf den Tannen wurde allmählich immer heller und schon hatten die obersten Partien der Bäume einen rötlich-goldenen Schein, während auch die tiefer gelegenen Bäume immer heller und weisser erschienen.
Als die Wandergruppe dann auf einem leichten Sattel einer Bergflanke ankam, befand sie sich bereits im direkten Lichte der Sonne. Leicht verhüllt durch einen nebligen Dunst waren nun die Spitzen der Berge zu sehen, aber so, dass sie noch gut wahrgenommen werden konnten. Nur die Details entzogen sich den Blicken. Da liess der Leiter dieser Wanderung die fast ein wenig ergriffen wirkende junge Schar anhalten und verschnaufen, bat sie aber, vorderhand noch immer nicht zu reden, sondern alle diese Bilder tief in ihr Inneres zu fassen, worauf er sie ihnen dann erklären möchte, damit sie sähen, wie tief begründet die bei solchen Betrachtungen aufkommenden Gefühle sein können. Nach einiger Zeit berief er dann die junge Schar zu sich in eine Gruppe weit stehender Tannen, die das Sonnenlicht durch die Schatten ihrer kompakten Gestalt etwas milderten, jedoch des Widerscheines ihrer Schneelast wegen nicht eigentlich verdunkelten. Da war weder die Kühle des Tales zu spüren, noch machten ihnen die vorher bereits spürbar ihre warmen Kleider durchdringenden Sonnenstrahlen zu schaffen. Und da begann er sie folgendermassen anzusprechen: "Wir haben nun schon ein gutes Wegstück zurückgelegt und wollen versuchen, uns über das dabei Erlebte und Empfundene Klarheit zu verschaffen. Irgendwie hat es uns angesprochen. Es hat uns zwar bewegt, aber ohne uns wehe zu tun, und hat uns anderseits gefreut, aber ohne dass wir dabei ausgelassen wurden. Es ist klar, dass wir das Dunkle im tiefen Tale unten eher bewegend und sogar etwas belastend empfunden haben. Merkwürdig bleibt allerdings, dass wir es dennoch zur schönen Seite des Lebens und Erlebens rechnen können, ja fast müssen. Wenn wir einmal den Grund dafür erfassen können, so können wir mit aufrichtiger Zuversicht erwarten und hoffen, dass uns auch die dunkeln Wegabschnitte auf unserem ureigensten Lebensweg nicht allzu viel ausmachen, ja, dass sie uns im Grunde wahrhaftig ebenso erfreuen können, wie dieses Wegstück bis dahin. Erstens war uns bewusst, dass der Tag einmal kommen wird, und zweitens spürten wir, dass er in der Höhe, auf die wir uns begeben werden, eher beginnt als in der Tiefe, oder - genauer ausgedrückt - eher wahrgenommen wird als in der Tiefe, dass er aber schon in der Tiefe nur erst jenen sichtbar verkündet wird, die sich ganz auf den kommenden Tag einstellen und nicht nebenher noch viele Weltgedanken haben und weltliche, belanglose Gespräche führen. Das Glitzeln einzelner Schneekristalle im weissen Mantel der Tannenbäume ist doch für den Aufmerksamen die Verheissung des kommenden Tages mit seiner Lichtfülle, aber auch mit seiner spürbaren Wärme – selbst im Winter. Aber solche Kleinigkeiten und kleine Verheissungen fallen nur dem stillen Betrachter auf, der ruhig seinen Weg geht und sich nicht mit Überflüssigem zerstreut. Dieses Versprechen (des anbrechenden Tages) würden wir Menschen auch in den dunkeln Abschnitten unseres eigenen Lebensweges immer wieder erhalten, würden wir uns mehr auf das Ziel – die Höhe, Gott – konzentrieren und nicht in Selbstmitleid ertrinken oder in weltlicher Hast das vorläufig Unabänderliche mit eigener Kraft ändern wollen. Wie manch schöner Gedanke würde uns dann auch in noch so misslicher Lage kommen! Aber warum tun wir ihn dann oft als "blossen Gedanken" ab? Wissen wir, wie viel in ihm einmal für uns zur Wahrheit wird, und wissen wir, von woher uns dieser Gedanke zugespielt wurde? Ja, wer auf die Sonne wartet, wie wir das anfangs unserer Tour getan haben, der weiss und spürt es auch wohl, dass es das Licht dieser Sonne ist, das so kleine Dinge wie ein Schneekristall vor uns so gross erleuchtet darstellen kann, selbst wenn die Sonne selber für uns auf unserem Standpunkt noch gar nicht sichtbar ist. Und wer auf Gott wartet, dass er ihn einmal erleuchten wird, der weiss dann auch, woher solche gedankliche Erleuchtungen kommen. Darum ist es gut, dass ihr alle heute einmal in der Stille eurer Gemüter ein solches Leuchten gesehen und tief empfunden habt. Dieses Bild hat sich in der Ruhe eures Gemütes hoffentlich so stark einprägen können, dass ihr es in der schwärzesten Nacht eures Lebensweges plötzlich wiederfinden könnt, wenn ein lichter Gedanke euer Herz für kurze Zeit erhellt, sodass die in Gott begründete Hoffnung wieder zunimmt und euren Willen stärkt, diesen Weg weiter zu gehen. 'Wir wissen, dass Trübsal Geduld bringt, Geduld aber bringt Erfahrung, Erfahrung aber bringt Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden.' Dieses schöne Pauluswort aus den ersten Versen des fünften Kapitels seines Briefes an die Römer ist uns von Gott durch das Bild der von ihm erschaffenen Natur so schön und plastisch und dadurch so unvergänglich vor unsere Augen gestellt worden, dass es jeder, der offenen Herzens ist, empfinden und seinen Trost daraus nehmen kann, selbst wenn er das geschriebene Gotteswort nicht kennen würde. - So reich sind die Gaben Gottes für jene, die sie achten, die ihre ganze Liebe und darum auch ihre ganze Zeit Gott weihen.
Aber noch etwas können wir aus der verschneiten Tiefe, in welcher wir unsere Wanderung begonnen hatten, lernen: Im Schnee stehen alle Tannen eines Waldes wie einzeln da. Wohl stehen sie zusammen wie im Sommer auch; aber sie erscheinen dabei nicht als Ganzes, als Einheit, so wie uns ein Wald im Sommer als eine Einheit erscheint, sondern sie erscheinen als einzeln, wie nahe sie auch stehen mögen. Das bewirkt die Last des Schnees, dieses Taues des Himmels in winterlicher Zeit. Wir wissen kaum, was schöner ist: die Einheit des sommerlichen Waldes, oder die Vielheit des winterlichen Baumbestandes. – Nachdenklicher stimmt uns sicher das winterliche Bild der Einzelstellung. Und nachdenken ist immer besser als gedankenlos geniessen, ohne sich zu fragen, wie dieser Genuss sich einmal auswirkt.
Ist nicht jeder Mensch so einmalig wie jede dieser Tannenformen hier?! Auf den ersten Blick sind das alles Tannen. Aber welche Unterschiede unter ihnen! Die eine schlank, die andere breit. Einseitig die einen, ausgeglichen die andern. Eine gerade, die andere gebeugt. Eine mit wenig Ästen, die andere mit vielen. Warum ist die einseitig gewachsene so einseitig? Warum die Ausgeglichene so ausgeglichen? War nicht etwa der enge Stand schuld an der Einseitigkeit? Aber dort stehen auch mehrere eng zusammen, und doch ergibt sich dort keine Einseitigkeit; warum? Alles Fragen, die uns erst im Winter kommen, der alle Individuen einzeln stellt, einzeln erscheinen lässt. Im Sommer des Lebens bilden die nahe stehenden eine Gemeinschaft, die nicht darauf achtet, wie sich der Einzelne entwickelt, sondern nur, wie die Gemeinschaft sich entwickelt. Der sommerliche Wald gleicht einem Staat oder einer Gesellschaft, die mächtig werden will ohne Rücksicht darauf, wie schwer der einzelne Bürger unter dieser Mächtigkeit leidet und wie dunkel es in einer solchen Gemeinschaft werden kann. In der zusammengefügten, sommerlich prosperierenden Gesellschaft erkennen wir darum weder die Unterschiede und noch viel weniger die Gründe dafür. Aber wenn wir uns im Winter tiefer mit diesen Einzelnen beschäftigen, so finden wir auch viel mehr der Gründe ihres Schicksals. So sind die Tannen jener Gruppe dort, die nicht einseitig geworden sind, solche, die ihre Äste oder - sinnbildlich - ihre Arme nicht weit hinaus in die Welt gestreckt und ihre Unternehmungen nicht zu weit ins Gebiet ihrer Nachbarn getrieben haben, sondern eher der lichten Höhe zustrebten, während die Individuen dieser Gruppe, die einseitig gewachsen sind, sich mächtig in die Welt hinein verbreitert haben, sodass sie einander in ihrer Entfaltung gegenseitig behindern mussten! Nun sind sie einseitig und der dadurch einseitig wirkende Schneedruck kann ihren jetzt noch geraden Stamm einmal schwer beugen, wenn nicht gar brechen. Und der Sturm wird ihre einseitige Krone einmal erfassen und ihren Stamm durch die Wucht dieser Einseitigkeit abdrehen, dass er krachend zersplittert.
Aber all das erkennen wir nur so augenfällig in der Einzelstellung des Winters. Wie aber kann denn der Winter eine Gemeinschaft derart auflösen? Es ist der sanfte, aber durch seine Stetigkeit schwere Druck des Schnees, dieses Taues des winterlichen Himmels, der ihre nach allen Richtungen sich streckenden Zweige unter seiner Last sammelnd eint und dabei den ganzen starken Ast sanft hernieder drückt zur Erde hin - wohin sie eigentlich, schlussendlich auch gehören, all diese kleinen weltlichen Freuden eines Baumes. Denn sie alle müssen einmal wieder Erde werden. Nur das gesunde und starke Holz ihres Stammes ist über ihre Lebenszeit hinaus zu einem weitern nützlichen Zweck verwendbar, wenn es zum tragenden Teile eines Hauses verwendet wird. Während ihrer ganzen Entwicklung aber bleibt einzig dem harzig würzigen Duft ihres innern Wesens die Bestimmung, überzugehen in die freien Lüfte des Himmels und diese damit zu bereichern, sodass sie dann alle Wesen stärken kann – und lungenkranke Menschen durch sie sogar gesunden können. Genau so verhält es sich auch bei uns Menschen!:
Die Widerwärtigkeiten des Lebens, die Bedrängnisse äusserer und innerer Art, also Krankheit, Armut und Depressionen sind nichts anderes als vom Himmel zugelassene Prüfungen der eigenen Gestalt der Menschen. Sie stellen die Menschen – zwar mitten in der Gesellschaft stehend – ebenfalls einzeln; verwehren ihnen ein allzu festes Sich-Verlieren in die Freuden der Welt und das Getümmel der Gesellschaft, sammeln sie um den Hauptstamm ihrer Liebe und lassen so ihre wahre Gestalt, ihre wahre Entwicklung, erkennen: ob sie sich strecken nach dem Guten hin, dem Licht des Himmels, oder eher sich verbreitern in die Welt hinein, andere dadurch in ihrer Entwicklung behindernd und selber einseitig werdend.
Solche Menschen wirken ihren äussern Konturen, das heisst ihrem äussern Benehmen nach dann oft auch ebenso mild und sanft wie die Formen dieser Tannen. Aber gehet nahe zu ihrem Stamme hin, das heisst: berühret ihren Hauptliebetrieb, erkennet ihre Wunschvorstellungen und ihr werdet sehen – wie bei den Tannen hier –, dass es in ihnen selber, also unter dem Mantel der ihnen durch äusseres Ungemach abgerungenen Erscheinungsform, noch ebenso wirr und völlig düster aussieht wie in den Kronen dieser Tannen hier. Aber – und das ist wichtig – solche Not, oder der Winter ihrer Lebenszeit lässt sie nicht nur einzeln und in ihrer wahren Gestalt erscheinen, sondern zeigt ihnen eben durch dieses für sie selber sichtbar werdende Erscheinungsbild an, wie es durch die Zulassungen (den Tau) des Himmels mit ihnen sehr viel bescheidener, ordentlicher und harmonischer werden könnte und wie sie dabei dem Nächsten sehr viel angenehmer und nützlicher sein würden. Bekommen solche Menschen dann Freude an dieser durch die einende Kraft des Himmels zustande gebrachten eigenen Form – wenn auch noch lange nicht im Gleichgewicht sich befindend –, so bleibt es fortan ihrem Willen überlassen, auch im wiederkommenden Sommer der vollen gesundheitlichen Freiheit für die Vergnügungen in dieser Welt freiwillig so zu bleiben, wie sie in der Not und durch die Not gestaltet worden sind, und damit dann beizutragen zu einer schönern, bessern Welt – und für sich selber auf alle Fälle aber auch zu behalten diese wahre, anmutig schöne Gestalt des himmlischen Wesens liebevoller Selbstbescheidung. Denn nur in dieser Gestalt finden alle Platz im Himmel! Wo sich hingegen die Gestalt eines Wesens in der Freiheit der äussern Bedingungen wieder ändert, da wird aus dem Himmel wieder wilde, leidenschaftliche Erde, wo Krieg und Eroberung und endlose Verbreiterung der eigenen Wünsche herrschen, anstatt liebevolle Rücksichtnahme und Freude über das Schöne und Nützliche. Darum wehret euch gegen eine winterliche Einzelstellung nicht, wenn sie euch einmal in eurem eigenen, irdischen Leben treffen sollte oder treffen muss. Sie ist als Zulassung eine wirkliche Segnung von oben – soweit sie nicht bloss ganz direkte Folgen eigenverschuldeter Verirrungen sind –, die euch innerlich stark und frei machen, wie sie einen Joseph, des Jakob Sohn, und König David, der Mann nach dem Herzen Gottes, frei und stark werden liessen: Der eine wurde verkauft von seinen eigenen Brüdern, der andere verfolgt von König Saul.
Gedenket auch der Juden beim Auszug aus Ägypten: Sie hatten damals in der Wüste auf wunderbare Weise alle täglich genug der Speise. Aber viele wollten mehr; sie alle mussten darum 40 Jahre lang zur Selbstbeschauung erst blossgestellt werden in den winterlich armen Verhältnissen einer Wüste, und die Unverbesserlichen gar aus der Gesellschaft vertilgt werden, wie jene, die dannzumal um das goldene Kalb der Welt getanzt hatten. Viele wollten wieder nach Ägypten zurück, in den Sommer ihres frühern Lebens – wie sie glaubten –, der ja aber gar nicht so schön war, wie er ihnen in der Wüste in ihrer Erinnerung erscheinen musste. Aber sich selber beschauen und sich bessern wollten viele nicht. Wer schuldet daran, dass sie unter der Last des befreienden Taues der Himmel zerbrechen mussten? Niemand sonst, als ihr unverbesserlicher Eigensinn!
Darum auch sind die Bilder dieser Tannenformen so ungemein erhaben zwar, aber auch gar so ergreifend und schwermütig wirkend schön, wenn wir sie in den Strahlen der göttlichen Morgensonne ersehen; aber beengend schwer, wenn wir sie mit den Augen der Unverbesserlichkeit oder des Leichtsinnes betrachten, oder mit den Augen allzu einseitiger Anteilnahme am Menschlichen und zugleich zu geringem Verständnis für das Wirken des göttlichen Liebewaltens. Damit haben wir in diesen Bildern göttlichen Schaffens in der Natur erkannt, wie Gott führt und wie wir ihn in unserer eigenen Führung finden können. Das können viele nicht, obwohl sie die Bibel kennen. Da hingegen, wo die Bilder augenfällig sind, können wir es besser und umfassender, jedoch auch da nur, wenn wir uns Zeit nehmen; wenn wir Gott lieben in allen seinen Werken, das heisst in seinen Führungen ebenso, wie in den Bildern der von ihm geschaffenen Natur.
Sehen wir uns noch einmal an, wie licht und ordentlich es im Winter in einem Walde aussehen kann. Wie hell er ist und wie deutlich das Wesen seiner Bäume zutage tritt, wenn jeder sich beschränkt zu Gunsten der Wirkung des Lichtes und der Wärme. Das alles will uns Gott mit den unendlich vielen und reichhaltigen Bildern seiner Werke – der gesamten Natur – zeigen. Und ich könnte euch über den rund geschliffenen Kieseln eines Baches dieselben himmlischen Gesetze erläutern wie hier, in diesem verschneiten Tal, oder in einem Geröllfeld einer Bergflanke. Überall predigen die Werke die Worte des Herrn denen, die auf ihn achten, anstatt auf den blossen Sinnenreiz dieser Welt. Das macht die Liebe zu Gott, unserem Vater im Himmel, dass die Dinge zu uns zu sprechen beginnen in unsern Gefühlen und dass wir sie auch verstehen! Und wer diese Gabe verliert, für den werden sie stumm und in ihrer unverstandenen Aussage sogar zur Verführung zu irdischem Besitz und irdischem Genuss.
Und das wollen wir hier, in einem kirchlich geführten Skilager, ja möglichst durch eine in der Praxis gewonnene Erkenntnis zu vermeiden trachten. Dass ich mit meinen Worten nichts Falsches gesagt habe, kann jeder leicht selber nachprüfen, wenn er sich nur ein wenig ernster mit dem Gesagten beschäftigt und es mit seinen Gefühlen vergleicht. Und damit kann und sollte es dann eigentlich jeden nur noch gelüsten, in der Welt und der Natur nur dasjenige zu sehen, was seinen Geist zu Gott erhebt. Denn damit verliert die Welt viel von ihrem Reiz und damit von ihrer verführerischen Wirkung auf unsere Seele, und wir wandeln schon auf dieser Erde in himmlischem Licht. Um wie Vieles sind doch solche verinnerlichenden Erlebnisse stärker, nachhaltiger und erhebender als der leere Sinnenkitzel oder Sinnenrausch weltlicher Betätigung. Damit ihr aber auch das noch an euch selber erfahren könnet, wollen wir nun – voll erfüllt mit der Sonne des Geistes und der Wärme aller Liebe zu ihm – die Bergesflanke noch ganz erklimmen und auf ihrer Gegenseite dann so stürmisch schnell ins Tal hinunter fahren, wie ihr das die vorigen Tage noch stets und völlig sorglos gemacht habt. Dann prüfet unten, was euch diese Abfahrt noch geben konnte – angesichts dessen, was ihr hier genossen habt. Das wünsche ich euch von Herzen, dass ihr diesen Vergleich ewig in euch frisch erhalten könntet. Nichts mehr kann euch dann so leicht verführen, wenn ihr das Wort des Herrn wenigstens auch in den Bildern der Natur verstehet oder doch erahnet, was euch dann lebendig und gar lieblich sanft an seine Worte in der Schrift erinnert. Das werde zu eurem wahren Tag, dessen Licht am Ende eures irdischen Lebens noch viel inniger über euch zu leuchten beginnt, wenn ihr ihm bis dahin treu geblieben seid."
Ein Letzter dieses Lagers, der zuhinterst gestanden hatte, konnte sich einiger Tränen nicht erwehren, denn er fühlte es, dass er nun in der Sonne des Geistes gestanden hatte wie nie zuvor, und ihm tat der Abschied davon und besonders die Fahrt ins Tal zum voraus schrecklich leid. Auch der Pfarrer war sichtlich beeindruckt und sagte nachher still zu jenem Vater, der hier gepredigt hatte: "Das war einmal Kirche in der Natur – während wir ja sonst immer öfters Natur und Sinnlichkeit in der Kirche betreiben". Diese beiden blieben Freunde.
28.10.2000
nach oben
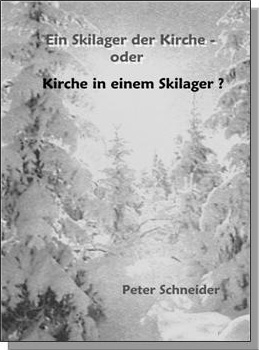 |
Diese Geschichte ist auch als
separater Druck erhältlich.
Zum Verschenken geeignet.
|
EINE KLEINE, ABER FAST UNERFÜLLBARE BEDINGUNG  Es begab sich einmal bei einem Weltfeste, dass sich ein berühmter Arzt unter den Gästen befand, dessen Erfolge bei der Heilung der schwierigsten, sogar auch als unheilbar geltenden Krankheiten weit herum bewundert wurden, ohne dass man herausfinden konnte, welches seine eigentlichen Mittel waren. Denn zur Heilung ein und derselben Krankheit liess er den einen bloss fasten, einem andern gab er allerkleinste Zuckerkügelchen in allergeringster Anzahl, und wieder einem andern empfahl er einen Tee, verbunden mit der Auflage, dass er ein Jahr lang ein anderes Zimmer bewohnen solle, ansonst der Tee wenig fruchte, und einem weitern gab er gar nichts, als die Aufgabe, ihn täglich einmal zu besuchen.
Kurz, er war ein äusserst interessanter Mensch, dem viele Erfolge nachgerühmt wurden. Und dennoch kam ausgerechnet dieser – als Einziger – ohne Begleiterin zum grossen Feste. Als aber nach dem grossen Mahl die Gäste sich in aufgelockerter Weise untereinander bewegten, da waren bald viele um diesen Arzt und bestürmten ihn mit Fragen aller Art und erstaunten immer mehr ob seinen Antworten, die er ihnen gab. Denn da war beinahe eine jede Antwort eine halbe Geschichte, die so viele weitere Punkte berührte, dass sich einmal einer seiner vielen Zuhörer dahingehend äusserte, dass das blosse Zuhören seiner Reden ihm mehr Genuss und Wissen zugleich verschaffe als eine halbe Weltreise, und dass er dazu noch ordentlich gestärkt und gesammelt werde, was bei einer Weltreise nicht der Fall sein könne, worauf ihm der Arzt erwiderte, dass seine Aussage ein sehr gelungener Vergleich sei, indem zweier Menschen Gemüt sich ebenso unähnlich sein können, als auf der Erde zwei sich entgegen gesetzte Erdteile. Wohl würde der äussere Mensch zumeist seinem Nächsten gleichen, ebenso wie ein Erdteil allen andern, die ja auch nur wieder – wie der eine – Berge und Täler, Flüsse und Seen, dann auch Pflanzen, Tiere und Menschen aufweise. Aber eben das Wesen all der vielen verschiedenen Erscheinungsformen sei so reichhaltig und vielgestaltig, dass man wochenlang nur über deren Eigenheiten nachsinnen könne, ohne je gelangweilt zu werden, und dass man dabei Einzelheiten in so detaillierter Art empfinde, dass sie vor dem Auge des Geistes wieder zu ganzen Welten würden. Und wenn man am Ende zum Beispiel bloss zwei Bäume ein und derselben Gattung betrachte, so seien sie sich alleine schon in ihrem äussern Aufbau – trotz der engsten Verwandtschaft – so verschieden, dass man über die Gründe dafür wieder lange Zeit zu denken hätte und dabei wieder die interessantesten Erfahrungen machen könne über die Wirkung des Baumes auf seine Umgebung einerseits und die Wirkung der Umgebung auf den Baum anderseits – und wohlverstanden, das alles nur in Bezug auf seine äussere Gliederung und Erscheinung. In seinem Innern sei dann der Gehalt aller seiner Stoffe und Essenzen wieder derart verschieden verteilt, dass man davon gar nicht alle Gründe erfassen könne. Aber all das sei im Vergleich zum Unterschied der Gemütsart zweier Menschen geradezu noch einfach zu begreifen. Und eben die Berücksichtigung des Unterschiedes aller dieser Eigenheiten, Umstände und Zusammenwirkungen im Wesen zweier Menschen begründe erst die rechte Medizin für den bestimmten Einzelfall, welcher ganz anders liege als ein scheinbar gleicher zweiter.
Solche Gespräche konnten natürlich die meisten der vielen Zuhörer fesseln, sodass sie stets in der Nähe des Arztes verblieben. Als dann aber ein später Nachtisch aufgetragen wurde, da nahmen all die vielen Gäste in ungezwungener Weise und Sitzordnung wieder an den langen Tischen platz. Dabei richtete es eine von diesem Arzte begeisterte Dame so ein, dass sie gerade diesem gegenüber zu sitzen kam. Und während dem Essen stellte sie – sich erstaunt gebend – fest, dass es doch merkwürdig sei, dass gerade er, der so interessante Mensch, ohne eine Begleitung zu diesem Feste erschienen sei, worauf ihr der Arzt erklärte, dass das nicht gar so verwunderlich sei, indem er an eine Begleitung zwar wenig Ansprüche stelle, aber offenbar doch solche, welche niemand zu erfüllen bereit sei. Und die Dame ihm gegenüber, die schon etwas mehr als blosses Interesse für den ihr immer liebenswerter Erscheinenden verspürte, fragte in einer Wallung von Verehrung und Liebe zugleich, ob sie wohl auch nicht fähig sein würde, seinen Ansprüchen zu genügen. Das müsste sie selber entscheiden, wenn sie seine Bedingungen hören würde, gab er ihr zur Antwort, und machte sie darauf aufmerksam, dass es keine Kleinigkeit sei, mit diesen konfrontiert zu werden. Denn er selbst sei ein grosser Freund der Wahrheit, ansonst er nicht so vieles erklärend aufzuzeigen vermöchte – und als solcher Freund der Wahrheit seien alle seine Bedingungen – auch jene für eine Begleiterin – derart konzipiert, dass sie nur immer wieder und überall der Wahrheit zum Durchbruche verhelfen würden. Aber die Wahrheit, besonders jene über sich selbst, sei denn doch für die meisten Menschen nicht gerade das Angenehmste, und diese hätten dann oft schwer, mit der einmal aufgefundenen Wahrheit über ihr eigenes Wesen zusammen leben zu müssen. Seine Gesprächspartnerin müsse es sich deshalb schon gut überlegen, ob sie diese Bedingungen kennen lernen wollte.
Sie wollte aber dennoch in einem in ihr erkeimenden Feuer der Begeisterung und der Liebe diese Bedingungen kennen lernen. Und so sagte ihr der Arzt, dass zur Bedingung lediglich gehöre, dass an erster Stelle nur die Liebe zur Wahrheit der Grund einer jeden Handlung seiner Begleiterin sein dürfe. Das sei zwar eine kleine Forderung, wenn man sie höre, aber eine riesengrosse, wenn man sie erfüllen wolle. Wenn sie es aber wolle und könne, so sei sie auf der Stelle seine Begleiterin, setzte er fast einladend hinzu. – "Ja – ich glaube – –, ja, wirklich – – ich glaube, diese Bedingung erfülle ich schon jetzt?" stammelte zwar etwas unsicher, aber freudig erregt und dennoch etwas betroffen die inzwischen Verliebte und hängte vorsichtig die Frage an, wie sie sich selber und ihn denn davon zu überzeugen imstande sein könne. – "Ganz einfach", sagte da der Arzt, "du legst nun als erstes all deinen Schmuck, der nicht der Wahrheit dient, sondern nur der Verschönerung eines an sich ganz normalen Leibes, nieder." Über diese Antwort war die eben erst verliebt Gewordene äusserst erschrocken und schockiert. Sie sah sich etwas verlegen im Saale um und sah all den geputzten Schmuck des Saales und der vielen Menschen glänzen, und peinlich berührt fragte sie sich, ob wohl die andern von diesem Gespräch etwas vernommen haben. Und zu ihrem Entsetzen merkte sie, dass es stille geworden war im Saale und fast alle Blicke auf sie gerichtet waren. Da stammelte sie verlegen die Frage, ob es denn gerade jetzt sein müsse. Sie wolle das ja gerne tun in alle Zukunft, aber doch nicht gerade jetzt. – "Wie verträgt sich dann aber die an erster Stelle sein sollende Liebe zur Wahrheit mit dem die Gewöhnlichkeit deines Leibes verdeckenden Schmuck, der diesem einen Schein gibt, der weit über das wahre Sein hinaustäuscht?" wollte der Arzt wissen. Aber sein Gegenüber blieb ihm die Antwort schuldig, und alle, die zuhörten, waren entsetzt über die Forderung des Arztes, wiewohl dieser ja etwas absolut Ungefährliches und Einfaches verlangte, das aber dennoch so unüblich war, dass seiner Forderung wohl kein weibliches Wesen im Saale nachgekommen wäre und jedermann Verständnis aufbrachte für die so "hart" geprüfte Verliebte.
Nur ganz am untern Ende des langen Tisches war Eine, der dieses Gespräch sehr tief gegangen war und die keine Ruhe mehr in sich fand. Sie ass den Rest ihrer Speise nicht mehr und in ihrem Herzen bewegte sich etwas; und sie sah einerseits die ungeheuerlich erscheinende Forderung und konnte doch anderseits mit ihrem lichtvollen Verstande ermessen, dass das Ablegen des Schmuckes denn doch wirklich gar keine Forderungsgrösse darstellte, angesichts des in Aussicht stehenden Gewinnes, denn auch sie bewunderte den Arzt und begann ihn stets mehr zu lieben, weil sie einsehen musste, dass ja auch er selber ohne jeden Schmuck (z.B. einer Begleiterin) auf das Fest kam und nur sein innerer Reichtum ihm alle zugetan gemacht hatte. Auch spürte sie das Entsetzen der Gesellschaft ob dieser an sich doch vernünftigen und schlichten Forderung und spürte die Einsamkeit, in welche der Arzt dadurch zu kommen schien. Und sie wog den Reichtum des Arztes gegenüber dem ganzen Schmuck des vollen Saales ab und erkannte, wie wenig dem Menschen all dieser Glanz nutzen konnte, wenn er nur traurig, oder etwa gar leicht krank werden würde, und wie reich die Kunst und Kraft des Arztes dagegen war. Und in stets grösserer Bewunderung des Arztes und stetig wachsender Verachtung des törichten und zu nichts nützlichem Schmuckes begann sie vorsichtig und von den andern zunächst unbemerkt all ihren Schmuck von ihrem Körper und ihren Kleidern zu entfernen. Erst, als sie den reich besetzten Gürtel ihres Kleides zu lösen begann, wurden die andern Gäste auf sie aufmerksam. Und eine grosse Verwunderung, und Verwirrung, nebst der immer mehr sich abzeichnenden Bestürzung der übrigen Gäste über die Forderung des Arztes liess alle Laute im Saal verstummen.
Diesen Moment erfasste der Dirigent der Musik und liess endlich zur erlösenden Überwindung der peinlichen Situation seine Kapelle zum Tanz aufspielen, und alles erhob sich zum Tanze. Auch des Arztes Gegenüber verschwand im Gedränge. Am Tische blieb nur der Arzt zurück und weit unten, am Ende des Tisches, noch eine junge, jeden äussern Schmuckes bare Frau mit gesenktem Blick und geröteten Wangen. Da stund der Arzt auf und ging zu dieser und fragte sie, ob sie mit ihm tanzen möchte. Sie aber sah verwundert zu ihm auf und fragte ihn, wie er denn mit ihr tanzen möchte, indem doch der Tanz auch nichts anderes als zierliche Schritte im Kreise herum seien, die keinen Fortschritt – weder in der Welt, noch weniger in der Erkenntnis brächten, sondern – wie es ihr nach seinen eigenen Worten, die er an seine frühere Gesprächspartnerin gerichtet habe, wenigsten vorkomme – nichts als Schmuck des Benehmens wäre. Da lächelte der Arzt und gab ihr recht, fragte sie aber dennoch, ob es ihr nicht bloss peinlich wäre, in ihrer Robe ohne Gürtel mit ihm tanzen zu müssen und ob nicht etwa das der eigentliche Grund ihrer Verneinung gewesen sein könnte. Auf diese Frage sah sie ihm mit einem liebeglühenden Blick in die Augen und sagte, wenn er wirklich nur diese Frage mit seiner Einladung zum Tanz habe beantwortet wissen wollen, so wolle sie gerne mit ihm tanzen, denn sie gäbe gerne all ihr äusseres Ansehen an seinen innern Reichtum her, denn das Urteil der andern berühre sie nicht mehr. Nie hätte sie sich gewagt, zu ihm sich zu setzen; nun, da er selber aber zu ihr gekommen sei, habe sie nichts zu verlieren, jedoch die Hoffnung, ihn zu gewinnen. Da küsste sie der Arzt auf ihre Stirn und führte sie aus dem Saale hinaus – unbemerkt von allen andern, ausgenommen von seiner ersten Gesprächspartnerin. Diese sah wehmütig die beiden den Saal verlassen, und in ihr bewegte sich viel und sie entsann sich der Worte des Arztes, dass es für einen von der Wahrheit Getroffenen und Betroffenen schwierig sei, mit dieser Wahrheit zusammen zu leben. Dabei entwanden sich einige Tränen ihren feucht gewordenen Augen und sie sagte sich: "Habe ich schon ihn selber nicht gewinnen können meiner törichten Eitelkeit wegen, so will ich wenigstens seine Wahrheit, die er mir entdeckt hatte, bei mir behalten, sollte sie mich noch so sehr bedrücken." Diesen Gedanken gab ihr ihre immer noch grosse Liebe ein, und als sie ihn bejahend in ihr Herz aufnahm, wurde sie sich plötzlich bewusst, dass derjenige, den sie so bewunderte und nun über alles zu lieben begann, Arzt ist. Und sie beruhigte sich und ihr Herz damit, dass sie wohl doch sicher einmal wenigstens als Kranke zu ihm kommen dürfe. Und sie spürte wieder seinen Reichtum in sich und wurde gestärkt durch den Trost, dass ihr nun Liebstes als Arzt ja allen zugänglich war. Das alles dachte sie, während sie das Fest getrost verliess.
Alle andern aber tanzten so lange, bis sie den Vorfall völlig vergessen hatten. Erst zuhause, wo es dem einen oder andern auffiel, wie viel zu viel er gegessen, getrunken und getanzt hatte, gedachten einige der Möglichkeit eines Arztbesuches, aber sobald ihnen dabei der soeben geschilderte Vorfall in den Sinn kam, wurde es ihnen wieder merklich besser, sodass sie den Arzt nicht aufzusuchen brauchten.
–––––––––––––––
Das Fest entspricht der äussern Welt. Die Herren entsprechen den vielen Lehren, welche die Welt kennt und die Damen versinnlichen die Seelen, die sich den verschiedenen Lehren hingeben. Darum jeder Mann, als Symbol der Lehre, eine Begleiterin, als Symbol ihrer Anhänger, hatte – mit Ausnahme des Arztes. Denn bei allen üblichen Lehren gibt es Schmuck und Ehre, die man sich erwerben kann, weshalb auch jede Lehre leicht ihre Anhänger findet, selbst dann, wenn sie schal ist. Der Arzt aber entspricht Gott, unserm Herrn, und hat kaum Anhänger, obwohl seine Lehre der einzig wahre Arzt für unsere Seele ist, weil ihre Bedingungen Liebe, Wahrheit und Demut fordern, was für alle Weltmenschen ein indiskutabler Preis – selbst für ihre Gesundheit – ist.
Wer diesen Arzt nicht liebt, und in seiner Liebe alles für ihn herzugeben bereit ist, wird nie mit ihm vereint zu einem Paar – er wird ewig sich selbst und seiner eigenen Schwachheit Partner sein. Wer aber vom so genannten Schicksal all seinen Schmuck, seine Ehre und seine Eitelkeit abgestreift bekommt, der kann und darf noch immer – als Kranker – zu diesem Arzte und dieser wird ihm auch helfen; aber sein Anteil wird er nie werden, solange die Armut keine selbst gewählte ist.
P.S. Auch weltgeläufige, glatte Reden gehören zu jenem Schmuck, der die Wahrheit der eigenen innern Leere verdeckt und darum seinen Sprecher nie Partner der Wahrheit werden lassen kann – und zwar auch dann nicht, wenn die äussere Aussage seiner Rede auch noch so sehr der Wahrheit entspricht! Und das ist darum so, weil der so Redende in seinem Gemüte (also in seiner innern Wahrheit oder Wirklichkeit) keinen Anteil an ihr nimmt.
5.2.1990
nach oben
AUS DEM VERGÄNGLICHEN ZUM UNVERGÄNGLICHEN  (Oder: wie die Liebe zur Wahrheit und Wahrhaftigkeit vor der Liebe zu bloss Äusserem schützt.)
"Wenn dein Inneres so ebenmässig und harmonisch sich verhält, wie die Züge deines Leibes, so bin ich ein stiller Bewunderer deiner Gestalt, sonst aber bloss ein Betrachter deiner Vergänglichkeit"
An einem Feste begab es sich, dass ein etwa 20-jähriges, geistvolles Mädchen bald einmal zu einem Mittelpunkte wurde. Seine unglaublich ausgewogen proportionierte Gestalt, seine weichen, fliessenden und dennoch flinken Bewegungen, sein offenes, Lebenskraft und Gesundheit verratendes Gesicht, das frische Haar und die schönen, grossen und ausdrucksvollen Augen waren sicher ebenso schuld, wie sein schön geschnittener, harmonisch sanft geschwungener Mund, den es zu geistreichen Bemerkungen eifrig benutzte und dessen Lächeln manchem "himmlisch" vorgekommen sein mag. Seine natürliche Offenheit und die Geradheit seiner Rede entzückte manchen zurückhaltenden Menschen ebenso wie das frische Wasser einen Dürstenden – ohne dass sich anderseits sogar die griesgrämigsten Pedanten und Befürworter einer höfischen Vornehmheit daran hätten ärgern können. In seinem Gemüte war das Mädchen zwar frisch und draufgängerisch, aber dabei dennoch äusserst behutsam in seinem Vorgehen, um niemanden zu verletzen oder ihm nur nahe zu treten. Nicht einmal seine Geschlechtsgenossinnen konnten ihm gram sein ob seiner Vorzugsstellung in dieser festlichen Gesellschaft. Natürlich genoss das junge Mädchen die viele Anerkennung – ohne, dass es diese allerdings extra suchte. Aber, stets etwas dafür zu tun, dass es so bleibe, war ihm eben auch nicht zu viel. Es war glücklich, wenn alle zufrieden waren, die mit ihm Kontakt hatten, aber es war ebenso glücklich, darin seinen eigenen Wert zu erkennen. Und darin paarte sich eine gute mit – sagen wir – einer nicht ungefährlichen Eigenschaft.
In einem etwas ruhigeren Augenblick des Festes fiel diesem Mädchen ein noch jüngerer Bursche auf, der zwar nicht eben verschlossen wirkte, aber bei dem es dennoch nicht die geringste Reaktion – weder auf sein heiteres, vordergründiges Wesen, noch auf seine Gestalt – zu erkennen vermochte. Nicht, dass es zu dieser Erkenntnis gerade durch die Eitelkeit kam, wiewohl es auch diesen Punkt in seinem aufgeweckten Gemüte sofort beleuchtet sah; sondern vielmehr noch aus einer echten, natürlich-jugendlichen Neugierde heraus verspürte es das Verlangen, den Grund zu diesem doch nicht ganz alltäglichen Verhalten dieses Jünglings zu erfahren. Und es näherte sich ihm in seiner unbefangenen Art und wollte von ihm wissen, ob er nicht Lust hätte, mit ihm ein wenig zu plaudern. "Doch, ganz gerne, warum denn nicht?" war seine Antwort, die das Mädchen denn doch stark überraschte indem es dachte, wenn er denn doch ganz gerne mit ihm reden möchte, warum dann diese absolute Unaufmerksamkeit seiner Person gegenüber – bis jetzt? – Erst nun merkte es, dass ihm an dem Jungen offenbar doch etwas mehr gelegen sein musste, als nur die Abklärung der Frage nach seiner bisherigen Unbeteiligtheit. Es wollte mehr wissen über ihn, indem er ihm in irgendeiner Weise sehr bestimmt erschien, ohne dass diese Bestimmtheit es hätte einengen können; eher dass sie ihm in seiner oft allzu losen Art einen Halt zu geben vermocht hätte. – "Ja, warum bist du mir denn bis dahin nicht näher getreten, wenn du Lust hast, mit mir zu plaudern?" forschte das Mädchen im Gemüte seines Gegenübers. – "Du hättest ja keine Zeit gehabt; denn man kann nicht gleichzeitig ernstlich mit Mehreren auf einmal reden", sagte der Jüngling und fügte die Frage hinzu, warum es denn erst nun auf den Gedanken komme, mit ihm plaudern zu wollen. "Weil du mir erst jetzt so richtig aufgefallen bist", gab ihm das Mädchen zur Antwort. – "Na also denn, da hast du ja auch die Bestätigung dessen, was ich gesagt habe: Du kannst nicht auf Mehrere gleichzeitig eingehen. Erst, seit du vom Gespräch und den Spässen mit den andern etwas abliessest, erkanntest du mich in deinem Wesen als ein dir sonderbar vorkommender Mensch. Sonderbar wohl deshalb, weil es mich nicht so wie die andern zu dir herzog, nicht wahr?" – "Ja, du hast wohl nicht so viel für mich übrig, wie die andern und du magst auch recht haben, aber ich verstehe es natürlich nicht und es würde mich wundernehmen, ob du mir das erklären könntest, wenn ich es wissen wollte", philosophierte das Mädchen – etwas nachdenklich geworden – vor sich hin. "Das ist schnell und leicht erklärt", meinte daraufhin mit einem Lächeln der Jüngling und zeigte dem Mädchen in einem Bilde die Situation, wie er sie vor sich sah: "Wenn du einem Menschen eine schöne Blume – etwa eine köstlich duftende Mandelblüte – zeigst, so wird er normalerweise in helles Entzücken kommen, er wird fasziniert sein und voll Begehrens, diese Blüte zu besitzen." – – "Ja, ist denn das nicht recht?!" warf die Fragerin ein. – "Sagen wir, es ist natürlich", nahm der Jüngling das Wort wieder auf, "ob es auch recht ist, wirst du sobald selber beurteilen können, wenn du meine Erklärung zu Ende vernommen hast. Ich selber kann mich zwar an der Form der Blüte ebenfalls freuen, aber ich erkenne auch, dass dieser Zweig vom Baume getrennt wurde, dass all die Pracht der Blüten zwar noch besteht, aber – niemandem zum Nutzen. Es werden daraus keine Früchte hervorgehen, und an diesem Zweige fürder auch keine neuen Blüten mehr. Das finde ich wieder traurig, verglichen mit einem Zweig an einem Baume, der noch voll Leben ist und die schöne Blüte auch mit seinem Leben ganz erfüllt, solange, bis aus ihr die reife und viel Gutes bewirkende Frucht hervorgegangen ist, aus welcher wieder ein ganzer Baum werden wird mit vielen neuen Zweigen, die wieder voller Blüten sein werden – oder welche Frucht auch fähig ist, den Hunger des Menschen zu stillen, oder viele seiner Speisen zu würzen, damit der Mensch durch sie eine Stärkung erfahre. So aber weiss ich – bei einem abgerissenen Zweig voller Mandelblüten – nicht einmal, ob es je eine süsse Mandel, oder nur eine todbringende Bittermandel aus diesen Blüten hätte geben können, oder gar auch überhaupt keine Frucht, weil es die Blüte eines Bastards gewesen war, der keine Frucht zu bringen vermag. Warum soll ich also enthusiastisch werden, wenn ich eine noch so schöne Blüte sehe, die mir noch so gefällt, wenn ich einsehen muss, dass diese so, wie sie vor mir ist, nur für die ewige Vernichtung bestimmt ist?" – – "Mensch, du sagst viel auf einmal", rief verwundert, überrascht und überfordert zugleich das sonst nicht auf den Kopf gefallene, schöne Mädchen aus. "Meinst du wirklich mich mit dieser Blüte? – Und weshalb soll ich denn für die ewige Vernichtung gemacht sein? Wer hat mich abgerissen, und wie und wodurch? – Meinst du wirklich mich mit dieser Blüte – und – wenn ja, – hätte sie dir wahrhaftig gefallen?" – -– "Ja, dich meine ich allerdings damit, aber das soll dich nicht so treffen, weder im Lob, das im Vergleiche steckt, noch in der Aussage, die du ihm entnehmen kannst. Siehe, dass du nicht ewig so jung, frisch und so schön verbleiben kannst, das wirst du, als ein geistreiches Mädchen, doch auch schon herausgefunden haben. Also ist diese äussere Form schon sicher einmal für die Vernichtung bestimmt. Den Eindruck aber, den diese Form auf alle Anwesenden macht, der bleibt zwar bei den Jüngeren noch eine Weile bestehen, bis sie eine Andere finden, die sie für sich haben können, und bei den Älteren vergeht der noch so gute Eindruck um vieles schneller – wahrscheinlich schon beim nächsten Geschäftsgedanken, deren sie stets voll sind – oder dann bleibt er jenen nur erhalten, die ihn, mit ihrer Partnerin vergleichend, benutzen, um jene dann in den zweiten Rang zu versetzen – was einer Bittermandel gleichkommt, die zweier Menschen Herzen vergiften würde. – Also: dem äussern Wesen nach, wie der äussern Wirkung nach ist all das Schöne deiner Form zur Vernichtung bestimmt. Frage noch: Wer sie abgerissen hat, und wovon und womit, oder wodurch. Siehe, diese deine allerdings äusserst harmonisch schöne Form hast nicht du selbst dir gegeben, und also bist du aus einem Andern hervorgegangen. Wenn du das nicht mehr wahrhaft verspürst, in jedem Augenblicke deines Lebens, dann bist du ja doch offenbar nicht mehr mit dem Grunde, aus dem du hervorgegangen bist, verbunden, sondern davon getrennt oder abgerissen. Und das tut der Mensch vorwiegend selber an sich, indem er sich selbst einfach so annimmt, wie er ist, und über sich selbst verfügt, wie es ihm gefällt – den äussern Sinnen nach. Denn es kann ja ewig nichts aus dir werden, wenn du deine jetzige Form selbstgefällig in deine Hände nimmst und tust mit ihr nach der Lust deiner äussern Sinne. Du müsstest aus dieser Form erkennen den Grund deines Wesens und die Absicht oder das Ziel, das sich in der Form verrät."
In diesem Augenblick kommt eine Bewegung in die Gesellschaft und einige Bewunderer kommen bald herbei und wollen das Mädchen wieder werben für Spiel und Tanz. Und es weiss das Mädchen in der Schnelle des Augenblickes nicht, wie es sich entscheiden soll und sagt in einer zweiten Überlegung zu, dass es bald kommen werde, aber es müsse zuvor noch etwas zu Ende bereden. Und mit neu erwachtem, fast brennendem Interesse wendet es sich wieder seinem Gesprächspartner zu und bittet ihn, ihm doch zu sagen, was es in dieser seiner jetzigen Situation denn tun solle. "Das musst du selber entscheiden", sagte der Jüngling "Wenn du das Gefühl hast, hier etwas Verlorenes wieder zu finden, so sage dich los und frei vom derzeitigen Spiel und dem nachfolgenden Tanz; wenn du aber das Gefühl hast, etwas zu verlieren am versäumten Spiel und am Tanz, dann sage dich los und frei von diesem Gespräch!" – "Ich verliere nur am Gespräch, wenn ich es unterbreche", sagt nun in einer gewissen Eile das Mädchen. "Aber ich kann doch nicht ohne Grund der Gesellschaft fern bleiben. Was wird sie von mir denken?" – – "Sie hat dir nicht das Leben, nicht deine Schönheit und nicht deine Erkenntnis gegeben. Was macht es aus, was sie denkt. Aber, was Der denkt, der dir alles gab, das wird bestimmt mehr ausmachen und wichtiger sein. Du kannst nicht zwei Herren dienen oder in zwei Gründen verwurzelt sein. Hast du dich doch früher losgetrennt von deinem Grunde, wie sollte es dir nun schwer fallen – da du des inne wurdest –, dich neu zu trennen von jenen, die dich durch Gesellschaftsgepflogenheiten in ihren eigenliebigen Händen halten, um mit dir ihre Lust zu befriedigen und sich die Zeit zu vertreiben. Was liegt dir an den Gedanken jener, die nicht viel denken – sind sie, so wie sie nun sind, nicht alle für die Vernichtung bestimmt? Wenn du ihnen nicht entsagen kannst, und damit gleichzeitig deiner dir selbst gegebenen Stellung bei ihnen, so können wir offenbar nicht weiterreden zur jetzigen Zeit." – Das Mädchen erkannte den tiefen Grund der Rede zwar nur ahnungsweise, aber dennoch fing es in seinem Herzen zu glühen an, und es bat den Jüngling, auf es zu warten; es wolle sich lossagen und dann wiederkommen, und der Jüngling sagte ihm zu, worauf sich das Mädchen eiligst entfernte. Bei der Gesellschaft angelangt, sagte es, dass es wisse, dass es sich nicht schicke, was es nun tun werde, aber es habe dem Jünglinge versprochen, dass es mit ihm das begonnene Gespräch zuerst zu Ende führen wolle, ehe es wieder kommen werde, obwohl es ihm klar sei, dass es nicht wisse, wann das sein werde. Es mögen ihm aber alle sein Vorgehen verzeihen und sie sollen sich dadurch in ihren Spielen nicht stören lassen. Diese Bitte wurde zwar mit Kopfschütteln aufgenommen, aber man vermutete eine sich anbahnende Beziehung und ging wieder zu Fest, Spiel und Tanz über, wodurch das Mädchen auf eine günstige Art frei wurde für das ersehnte Gespräch; und es ging voll echter Neugierde, aber auch voll erwachten inneren Eifers, zu seinem Jüngling zurück. – "Da bin ich wieder!" sagte es eilig und voller Erwartung und bat um die Erklärung, wie es denn zugehen könne, dass es nicht für die Vernichtung bestimmt sein bliebe. "Ganz einfach, indem du diese äussere, allerschönste, aber vergängliche Form auf dein inneres, ewiges Wesen überträgst, anstatt dein Wesen an deine vergängliche Form zu binden", meint ganz ruhig, aber dennoch eine gewisse Begeisterung vermittelnd, der Jüngling. "Betrachte beispielsweise deinen schönen Mund, wie er – edel geformt – durch eine zierlich geschwungene Linie begrenzt ist. Besagt die Zartheit deiner geröteten Lippen nicht, dass alles, was aus ihm herauskommen soll, in der Liebe deines Herzens begründet sein soll – in der weichen, rücksichtsvollen Sanftheit deines Gemütes gereift und zum Wohle und zur Erbauung deines Nächsten gegeben? Die harmonische Begrenzungslinie zeigt oder deutet an, dass du wohl, dem einen oder andern etwas nachgebend, deine Rede färben kannst, aber nie über eine gewisse Wahrheitslinie hinaus, damit sie zwar einerseits leichten Eingang findet in die Herzen deiner Nächsten, dort aber nur das Gute der Wahrheit und der Harmonie verbreiten kann, nie aber Verwirrung stiften könnte durch einen noch so kleinen Bruch mit der Wahrheit. Deine rosigen, zart gerundeten Wangen zeigen, dass du die Speise (des Geistes), die du zu dir nimmst, in aller Sanftheit und Geduld zerkauen sollst, um aus ihr das Beste zu machen für dich und deine Nächsten (geistig genommen). Die schöne, gerade Nase, welche dennoch in allen ihren Details weich gerundet ist, zeigt dir, wie du veranlagt sein solltest: Ein geradliniges Wesen, welches in seiner Strenge dennoch nicht verhärtet, sondern diese mit Nachsichtigkeit für die andern sänftet. Die beiden grossen, licht- und seelenvollen Augen deuten dir an, dass du mit offenen Augen aus den Dingen der Natur, das Licht, als die Nahrung für deinen Geist, suchen sollst, und dass Liebe der Grund deiner Erkenntnisse sein soll. Die hohe, schön gewölbte, strahlende Stirn soll verdeutlichen, dass nur hohe, reine Gedanken dein Wesen erfüllen sollen, welche leicht überstrahlen auf deiner Nächsten Umgebung, weil sie von der Liebe und dem Lichte aus ihr gekräftigt worden sind, sodass sie das Gute, das sie beinhalten, auch zu schaffen vermögen – in dir selbst, wie in deinen Nächsten. Das schön gelockte und gewellte Haar verdeutlicht in der Lockung, dass du alle deine niedern Kräfte mit der Kraft der Liebe überwinden kannst und sich ihre Widerwärtigkeiten ordnen lassen in eine neue, schöne Ordnung; und verdeutlicht im Glanz, dass diese Ordnung mit Kraft ausstrahlen soll auf deine Umgebung, um diese mitzuordnen, damit sie deiner Erkenntnisse teilhaftig werden kann und in der Liebe zu wachsen beginne. Die volle, sanft anschwellende Brust zeigt dir, dass du in der Liebe und ihrer Kraft wachsen sollst durch eine reiche, innere Betätigung und Beschäftigung deines Herzens mit deinem Urgrunde und mit allem, was du in dir, aus ihm kommend, findest. Schliesslich erinnert dich deine senkrechte Gestalt daran, dass du erschaffen wurdest, um vom Natürlichen der Erde dich zu erheben in das rein geistige Licht der Himmel, was eben dadurch geschieht, dass du deinem ganzen innern Wesen eine solche Gestalt verleihst, wie sie dir von deinem Schöpfer – als äusseres Mass – deinem Leibe gegeben wurde. Dann wirst du erkennen, dass du einen Vater hast, der dir alles das vorgegeben hat, was du zu deiner Vollendung, – die im Gleichwerden deines Wesens mit deinem Vater besteht – brauchen wirst. Wenn du dann so und derart mit deinem Munde zu deinem Nächsten redest, so ist deine Rede so sanft und dennoch so bestimmt, dass sie ins Herz deines Nächsten eingeht und auch tief haften bleibt, sodass du auch in ihm das beginnen kannst, was du in dir vollenden sollst. Und dazu verhilft dir – nicht nur in der äussern Form, sondern noch viel mehr im innern Erkennen der Liebe – derjenige, der dich aus Liebe und für die Liebe erschaffen hat – und zwar für ewig, weil auch er ewig ist. Wenn du dann irgend etwas tust aus Liebe zu der Liebe, die dich schuf, so wirst du Ewiges tun, in dir wie in deinem Nächsten; du wirst Früchte tragen, und die Schönheit deiner Blüte wird den Schöpfer ehren und preisen und nicht dich selbst, und du wirst dadurch mit Ihm verbunden bleiben als eine reif werdende Frucht an seinem Zweige. Dann erst will ich voll Freude deine Schönheit sehen und mich sättigen an der Liebe, die sie schuf und an der Wahrheit, die dann in ihr liegen wird."
P.S. An dieser Stelle die Geschichte zu beenden, mag vielen als abrupt oder gar als hart erscheinen. Ging es doch für so urteilende Leser darum, ob und wie sich das Mädchen und der Jüngling finden werden und was aus ihnen wohl werden wird. Das alles aber ist nicht der Sinn, noch der Grund dieser Geschichte, sondern einzig der in ihr voll aufgezeigte Weg, wie aus den Bildern des Vergänglichen für das Ewige geschöpft werden kann durch das rechte und liebevolle Verstehen der Aussagen des so genannt Natürlichen, das ein Geschaffenes und somit etwas Gerichtetes ist und darum noch lange nicht jene Freiheit beinhaltet, die zur endlichen Seligkeit eines jeden Menschen unabdingbar erforderlich ist. Es ist beim Erkennen dieses Weges aber nicht wichtig, wie und ob das Mädchen ihn beschritten hat und ob es sich mit dem Jüngling verband, sondern viel wichtiger ist, ob wir selber ihn beschreiten und uns dadurch mit unserem Schöpfer wieder verbinden, der doch – als Vater – durch das Beispiel seines Sohnes uns diese Forderung nicht nur gab, sondern sie durch den Erdenwandel Jesu auch vor- und ausleben liess bis hin zur Überwindung des Todes.
24.7.1988
nach oben
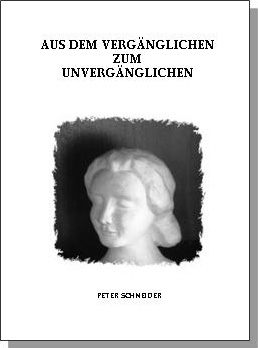 | Diese Geschichte ist auch als
separater Druck erhältlich. Zum Verschenken geeignet. |
DAS BILD DES HIMMELS  Es wuchs einmal ein tief empfindendes und in seinem Geiste früh erwachtes Kindlein in einem kleinen Häuschen am Rande einer unbedeutenden Siedlung auf. Sein Zimmerchen, in welchem es gerne spielte und aus dessem kleinen Fensterchen es so gerne schaute, lag auf der Talseite des relativ steilen Berges, an welch unterstem Teil das Häuschen, stand.
Am Morgen schaute das Kind gerne hinaus in das schöne, reine Blau des Himmels und sah den Vögelein zu, die ihn emsig durchkreuzten mit ihrem Fluge von Baum zu Baum. Das kleine Kind sah aber zufolge der hohen Fensterbrüstung nur die ferneren Baumwipfel jener Bäume, welche in der Talsohle standen; aber jene des Gartens sah es nicht, da sie mehr seitlich des Zimmerfensters standen. Auf diese Art hatten alle Dinge eine gewisse Distanz zu ihm. Selbst wenn die Vögelein auf es zu flogen, um in einem nächsten Gartenbaum oder auf dem Dachfirst zu landen, bekam es diese nie richtig zu Gesichte. Trotzdem freute es sich jeden Tag herzlich darüber, umso mehr, als sehr oft die Sonne so mütterlich warm über dem schönen, blauen Himmelszelte prangte und die Blätter der fern stehenden Baumwipfel, sowie das Gefieder der Vögel mit einem goldenen Glanz überzog.
Aber auch dem Zuge der Wolken sah es gerne zu. Besonders gefielen ihm die grossen weissen, die so herrlich und erfrischend sich in den blauen Himmel türmten und dann langsam davon glitten. Natürlich sah es dann und wann – im Sommer – auch ein Gewitter heraufziehen und sah dabei die Gewalten des Himmels furchtbar toben, was es wohl stark beeindruckte, aber es nicht ängstigte in seinem freien und Gott wohl vertrauenden Gemüte.
Auf diese Art wuchs das Kindlein heran – in der Umgebung des Himmels, und wenig auf dem Boden der Erde spielend –, behütet von frommen Eltern, die es frühe den Vater im Himmel kennen lehrten zu seiner Freude, aber auch zum Schutze in der selbst erlebten Not. Und des Kindleins Gemüt war frei, unbekümmert, aber nicht teilnahmslos. Nein, es schlürfte die Eindrücke der Stille und der Freude an dem Wenigen, das es sah, in sich hinein, sah stets über allem den Himmel und die Sonne, oder – sinnbildlich – Gottes Walten aus seiner Liebe.
Es siedelten sich aber mit der Zeit talseits andere Leute an und wurden zu Nachbarn. Anfangs veränderte das zwar des Kindes Aussicht und Ansicht der Welt nicht, wenn es aus seinem bescheidenen Fensterchen blickte. Aber mit der Weile und der Länge der Zeit bekam es dann die ersten Zweige jener Bäume zu erblicken, welche seine Nachbarn auf ihrem Grunde gepflanzt hatten, und die ihre Äste aufwärts, gen Himmel zu, streckten. Das war sowohl durch das Wachstum der Nachbarsbäume so gekommen, wie auch durch das eigene Wachstum des Kindes, sodass die ehemals hohe Fensterbank stets niedriger wurde im Verhältnis zum heranwachsenden Kinde, und ihre Schranke deshalb auch stets überschaubarer. Und hie und da kam es vor, dass bereits die Vögelein des Himmels auf diesen Zweigen absetzten, sich vom Fluge ausruhten, ihr Gefieder putzten oder ihr Liedchen in den blauen Himmel sangen, so wie die Kinder ihre Erlebnisse vor dem Angesichte ihrer sie liebenden Eltern erzählen.
Mit der Zeit waren dann allerhand Bäume und dementsprechend viele Zweiggattungen vor dem Fenster des heranreifenden Kindes zu sehen. Und in jener Zeit, in welcher es auch immer regeren Verkehr mit seien Mitschülern hatte, war es um das Fenster seines Zimmerchens herum von lauter Zweigen so verwachsen, dass die Sonne nur noch zwischen den Blättern hervorzublinzeln vermochte; und in den Zweigen herrschte ein Lärm der darin sich tummelnden Spatzen, die dort ihre Versammlungen abhielten und ihre Speise verzehrten. Herrlich kühl war da der Schatten an warmen oder gar heissen Sommertagen vor dem Fenster des heranreifenden Jünglings. Nur war natürlich die Sonne nicht mehr ganz sichtbar wie früher. Er musste sie mit dem Gezweige und den Vögeln zusammen teilen. Dennoch war es eine herrliche und erfüllte Zeit für den Jüngling, der in dieser Zeit auch vom Lehrer in der Schule, aber auch von seinen Schulfreunden so manches Neue vernahm; vom Lehrer über die Dinge und Gesetze in der Natur und von den Mitschülern so manches über das Geschehen um ihn herum, sodass er mit den andern Schülern und den Kindern der Nachbarn in gleichem Masse verwachsen wurde wie das Geäste der Bäume vor seinem Zimmerfenster untereinander, und er sich ebenso geborgen fühlte in der Gesellschaft der andern wie in der Zweigwelt vor seinem Fenster, sodass er sich daselbst immer freier zu bewegen begann, bis er einmal, als er bereits volljährig war, angesichts eines Mädchens, für sich eine Sonne aufgehen sah, welche jene vor seinem Fenster, die schon lange hinter den Blättern der vielen Zweige verschwunden war, zu ersetzen versprach. Und er ging dieser Sonne nach und vergass dabei den Blick aus seinem Zimmerfenster und erhob, die neue Sonne in den Himmel seiner Vorstellungen und Träume.
Als er dann heiratete und selber eine Familie gründete, fügte es sich gerade so, dass er in einem Hause an einem Südhang eine Wohnung mieten konnte, welche ihr drittes Zimmer – das spätere Kinderzimmer – wieder auf der Talseite hatte und dessen Fenster wieder hoch über aller Umgebung lag. Weil sich aber der Himmel seiner Ehe – wie in allen anderen Ehen auch – nicht immer nach seinen Vorstellungen entwickeln und entfalten wollte und also seine neue Sonne oft umdüstert war, so begann er ernstlicher in sich zu gehen und sich nach dem tieferen Sinne des Lebens zu fragen. Wohl hatte er diesen aus der Lehre seiner gläubigen Eltern schon früh erfasst, aber noch lange nicht ernstlich genug sich bemüht, diesem entsprechend sich zu verhalten, sodass er mit der Zeit vom tiefern Sinne des Lebens eine eigene Vorstellung entwickelte, die vielleicht nicht ganz jener des Schöpfers entsprach, und deshalb noch einer Läuterung und Verbesserung bedurfte.
Als er einmal aus dem Grunde der tieferen Sammlung – weil ihn wieder einmal ein Problem zwischen ihm und seiner Frau bedrängte – an einem Sonntagmorgen im Kinderzimmer sass, da er das Wohnzimmer in diesem Momente nicht mit seiner Frau zusammen teilen mochte, und die Sonne so ganz alleine am wolkenlosen, hellblau strahlenden Frühlingshimmel stand und er von draussen hie und da das Zwitschern eines Vögeleins hörte, ohne den kleinen Sänger sehen zu können, weil keine Bäume vor dem Fenster standen, da erinnerte er sich wieder seiner schönen Jugendzeit, wo der liebe Gott, die leuchtende Sonne, der blaue Himmel und die fliegenden Vögelein des Himmels sein ganzer Reichtum war. Dabei verbreitete sich in seinem Gemüte eine riesige Wiedersehensfreude – aber kurz danach auch eine tiefe und schwer lastende Wehmut ob der Vergangenheit solcher Zeiten.
Er besann sich, wie er die ersten Zweige der Bäume seiner Nachbarn zwar zuerst als Fremdkörper in seinem Himmel empfand, sie aber nach kurzer Zeit als willkommene Abwechslung zu begrüssen begann. Er stellte in seinen Gedanken die Sonne des Himmels vergleichend zu der neuen seines Herzens, die seine Frau einmal war, und erkannte dabei, dass es ja damals sein Wunsch gewesen sei, eine neue Sonne im eigenen Himmel begrüssen zu können. Diese aber könne ja doch niemals so beständig sein wie jene grosse des allgemeinen Himmels – wie er sich nun eingestehen musste. Aber damals hat sich der grosse, weite Himmel des himmlischen Vaters von seinem eigenen kleinen Herzenshimmel dennoch getrennt, so dass für beide zusammen nicht mehr ein und dieselbe Sonne scheinen konnte.
Erst nach vielen, langen Jahren der innern Einsamkeit und der Erforschungen des Sinnes des Lebens und des Willens des Herrn gelang es ihm, seine Wege wieder in die Hand des Herrn zu legen und alles von ihm zu erwarten und anzunehmen. Auf Grund dieser Änderung seiner innern Haltung verlor er zwar seine alten Freunde, gewann aber einige neue hinzu – wenn auch nur ganz wenige – und gewann mit der Zeit vor allem auch die Herzen seiner Frau und seiner Kinder für den grossen Himmel mit der bloss einen einzigen Sonne, die für alle zusammen zur Genüge scheinen konnte. Es gelang ihm, sie alle in der Stille – gleichsam im tiefen, treuen Blau des grossen Himmelszeltes – zu sammeln, in welcher uns Menschen die Gefühle wieder zu berühren vermögen, wo gleichsam die Stimme des Vaters im Sensorium des tief empfundenen Liebegewissens wieder hörbar und vernehmbar wird und uns nahe kommt.
Aber just in diesem Moment waren auch wieder von neuem Zweige der Bäume neu zugezogener Nachbarn in den sonst unberührten, reinen Himmel vor dem Fenster des dritten Zimmers gewachsen. Diese zwar bloss äussere Tatsache störte und beengte den Mann, weil er darin das Bild seines früheren Fehlens wieder erkannte. Längere Zeit war er darüber beunruhigt, wiewohl er einsah, dass das ja nur eine äussere Wiederholung sei. Dann aber begann er zu spüren, dass er in seiner Familie tatsächlich wieder Gefahr lief, eigene Sonnen zu haben, und dass andererseits auch alle seine Getreuen durch ihre Ansprüche an die Welt, von welcher sie sich noch nicht so ganz zu lösen vermochten, stets neue, nach dem Weltglück schielende Zweige in den Himmel seiner ruhigen Einkehr schoben. Und das musste ihn natürlich in der Hingabe an diesen Himmel der reinen Einsicht und der Liebe zum himmlischen Vater auch immer wieder stören. Aber er erkannte, dass er jeden Morgen neu – wie in den ersten Jahren seiner Kindheit auch – die grosse Sonne des Herrn in sich selbst suchen und betrachten solle, wie sie am weiten Himmel seines Vaters, in welchem viele Wohnungen sind, so herrlich pranget. Und er besann sich auch, dass wenn er trotz der vielen Wohnungen dieses Himmels nur die eine Sonne betrachte und nur ihr nacheifere, diese ihm in seinem Innern nie mehr entschwinden kann, weil nur seine eigenen, vom Wege des Herrn abweichende Wünsche es sein konnten, welche Zweige in die Reinheit seiner Liebe zum Vater und Schöpfer – und damit in seinen Himmel – zu treiben vermochten. Von da an war sein innerer Himmel ungetrübt und rein geblieben von Materiellem, wie sehr er sich auch um das Wohl der Seinen kümmern konnte. Denn er tat es nur noch aus der Ordnung und dem Auftrage des Herrn, und nicht mehr aus eigenem Wollen und Wohl- gefallen, welches fortan sich bloss noch an den liebevollen Führungen seines Vaters orientierte und erfreute.
Dabei erkannte er, dass er stets von neuem neue Menschen kennen lernen musste, und diese auch ihn, damit ein steter Austausch der Erkenntnisse und Erfahrungen bestehen bleibe, dass aber all dieses das Verhältnis zwischen ihm und seinem Herrn nicht trüben oder auch nur berühren dürfe. Damit wurde er zu einem wirklichen Kinde, das stets nur bei und mit seinem Vater war, auch dann, wenn es mit seinen Nächsten verkehrte, die eben durch solchen Verkehr mit ihm ebenfalls die Sonne seines und ihres ewigen Vaters im Himmel so ungetrübt und so erlebnistief mitempfinden konnten, dass in ihnen oft förmlich der Wunsch erkeimte, selber einmal einen eigenen Ausblick und zugleich Einblick in den wahren Himmel haben zu können.
Von da an sah er in sich selber fast allezeit wieder den reinen, blauen Himmel vor den innern Augen seiner Seele und sprach nur mit der Sonne in ihm, auch wenn er äusserlich zu den Andern sprach, weil er alles nur aus dem Lichte der Erkenntnis aus seiner Liebe zum Vater redete und tat.
10.6.1992
nach oben
DIE ENTDECKUNG  (Erwachsene nennen es Pubertät)
In einer grösseren Stadt wohnte eine Familie mit drei Kindern, wovon das älteste ein Knabe war. Der spürte seit seiner Kindheit, dass er es seinen Eltern nie so ganz recht machen konnte. Nicht, dass er ein Ausbund an Tugend gewesen wäre, aber er hatte einen guten Helferwillen und verspürte in sich oft den Drang, anderen das Leben zu erleichtern, über das die Menschen so gerne seufzen. Aber wie er es auch anstellen mochte, er erreichte nie oder selten nur sein Ziel.
Stets hörte er aus den Gesprächen seiner Eltern, wie schlecht die Welt sei und wie hart das Schicksal zuschlagen konnte, wie mühselig das Leben sei und wie ungerecht. Wenn er aber seiner Mutter unaufgefordert eine Arbeit abnahm, manchmal täglich – ein, zwei oder drei Wochen hindurch – so war diese weder glücklich noch dankbar darüber, noch spürte er etwa bloss eine innigere Liebe oder Zuneigung, was alleine für ihn den grössten Dank ausgemacht hätte. Aber auch ein Aufatmen seiner Mutter wäre ihm Lohn genug gewesen; aber statt dessen konnte seine Mutter – oft nach einer von ihm freiwillig verrichteten Arbeit – sich noch beklagen über die viele Mühe, die sie habe, auch über die Mühe mit ihren Kindern. Kurz, der Knabe erreichte nie, was er wollte und wünschte, nämlich den Menschen ihr Los zu verbessern, vorab bei seinen Eltern nicht. Darunter litt er manchmal schwer.
Obwohl er mit zunehmendem Alter sich an diese Tatsache mehr gewohnt hatte, also nach dem Sprachgebrauch der Erwachsenen älter und einsichtiger geworden war, blieb in seinem Innersten dennoch der Wunsch, andern helfen zu können. Als er 16 oder l7 Jahre alt war, durfte er mit seiner Mutter einmal ins Theater gehen, dessen Eintrittskarte er freilich mit seinem äusserst kargen Lehrlingslohn sich erstehen musste. Es war eine Oper von Verdi; "Die Macht des Schicksals" war ihr Titel. Wohl gerade der rechte für ein Kind, das von seiner Mutter stets wieder über die Härte des Schicksals klagen hörte, ohne dass es jeweils Gelegenheit gehabt hätte, die Schicksalsfälle genauer überprüfen zu können, welche ihm seine Mutter oft aus ihrem Bekanntenkreis darstellte. Denn erstens kannte er viele Bekannte seiner Eltern nur von der Begrüssung her, weil er dem Gespräch zumeist nicht beiwohnen konnte, und zweitens kein Recht, dazwischen zu fragen, hatte, falls sich dennoch einmal die Gelegenheit ergab, zuhören zu können, wenn eine Bekannte bei seiner Mutter ihren Kropf zu leeren begann.
Von der Dramatik dieses Operngeschehens wurde er von Anfang an sehr gepackt und erstmals erkannte er, wie und durch welche Fehler der Menschen das Unglück unter sie kam. Und er merkte sich alle Umstände und glaubte nun zu erkennen, wodurch das Schicksal oft so hart würde und wer seine Schläge provozierte. In der Pause wollte er mit seiner Mutter darüber zu sprechen beginnen. Diese aber traf in der Pause, im Foyer, eine Bekannte und der beiden Gespräch drehte sich um den neuen Hut der Mutter. "Wie viel Unglück, Leid und Elend muss denn kommen, dass es euch Menschen einmal so packt, dass ihr an dem Schicksal, das ihr selber gestaltet, mehr Anteil nehmt als nur durch eitel töricht dumme Klage?" fragte sich erstaunt, empört und überrascht zugleich der Knabe. Eine ganze Viertelstunde lang vernahm er das Geplauder über Mode und andere Banalitäten des Alltags, das seine Mutter mit ihrer Bekannten führte. Er war sehr verwundert, dass sie sich nun plötzlich nicht mehr der Härte des Lebens bewusst war, nun, wo sie doch so nahe dem Unglück in der Oper beigewohnt hatte. "Hat die Mutter wohl nur ein Gefühl für das eigene Unglück?" fragte er sich, während er sich nach dem Glockenzeichen wieder mit ihr zusammen in den Zuschauerraum begab.
Während der Aufführung war er ganz Aug' und Ohr und so sehr gespannt – ohne es zu wissen –, dass er bei dem Schuss, der auf der Bühne überraschend fiel, in den Sessel zurückfiel und erst dadurch merkte, dass er nicht ganz und wirklich gesessen hatte, sondern dass er in seiner Anspannung eher halbwegs in sitzender Stellung stand, als wirklich auf dem Sitze sass.
Als die Oper beendet war, wollte und konnte er kaum aufhören, die Interpreten zu beklatschen. Er wollte ihnen danken für die Aufklärungen, die sie ihm über das Schicksal haben zukommen lassen. Aber die Mutter drängte zum nach Hause gehen. Auf dem Heimweg wollte er mehrmals versuchen, ob nicht ganz zuinnerst in seiner Mutter etwa doch ein weiches und empfängliches Örtchen wäre, das etwas von dieser Oper begriffen hätte; aber die Mutter gab ihm stets wieder zu verstehen, dass das in Opern eben so sei und dass er sich daran gewöhnen werde, wenn er mehrere gesehen haben werde.
"Wieso siehst du sie denn an? Um dich daran zu gewöhnen?" fragte er sich, ohne es freilich laut auszusprechen. "Was wohl spricht dich denn an? Nur das eigene Leid – und davon interessiert dich nicht einmal der tiefere Grund?!" dachte er sich, und in seinem Innersten beschloss er, einmal ein Drama zu schreiben, das so schrecklich sein würde, dass es keinen Zuschauer ruhig nach Hause gehen liesse.
Er dachte sich eines aus, in welchem einem unschuldigen Menschen, als Strafe für ein nur scheinbares Vergehen, die Augen ausgestochen werden müssen, und zwar auf der Bühne – wenn auch durch umstehende Schauspieler verdeckt, so doch mit einem grossen Aufschrei des Geblendeten akustisch genug wirksam dargestellt. Aber er kannte von diesem einen Mal durch seine Mutter und ihre Bekannte alle Menschen derart gut – hatten doch alle, die im Foyer an ihnen vorbeigegangen waren nur banale Gespräche geführt – , dass er sich klar darüber wurde, dass diese Handlung keinem Zuschauer, ausser vielleicht im Augenblick des Ausstechens der Augen an einem wehrlosen und gefesselten Menschen, einen grösseren oder gar bleibenden Eindruck hinterliesse, so dass er deswegen tiefer nachzudenken begänne. Und er beschloss darum, in dem zu schreibenden Drama jenen Darsteller mit den ausgestochenen Augen, der ja fürderhin als Blinder auftreten musste, auch nach der Vorstellung als Blinden – also von den andern geführt – vor den Vorhang treten zu lassen, sodass es den Anschein habe, dieser sei nun wirklich blind. Das würde dann eine Unsicherheit im Publikum bewirken und dadurch wenigstens zu einer Empörung Anlass geben, welche doch immerhin einmal der Ausdruck einer Regung beim Zuschauer wäre.
Zwar schrieb er das Drama nicht so geschwinde, weil er zu beschäftigt war mit den Gedanken über seine Mutter, die er nun stets besser zu erkennen vermochte und von der er nach und nach lernte, wie das Harte und Herbe unter die Menschen kommt: Durch die Weiber, die ihre Kinder nicht zu erziehen verstehen, weil sie selber nicht in eine gute Richtung erzogen worden sind und sich selber nicht aufraffen können, das Bessere zu suchen, zu finden und zu schaffen. Wenn doch eine Mutter kein Mitgefühl hat für das Leiden anderer, höchstens ein Gespür für das eigene Leiden, woher soll es dann dem von ihr erzogenen und von Natur aus härter urteilenden Manne kommen?
Einmal, etwas später, traf der Knabe oder Jüngling einen schlechten Bekannten. Der war in den Augen seiner Mutter schlecht, weil er anders war, als die andern, weil er über anderes sprach, als die normalen Menschen und sich wenig an die Formen hielt. Nun aber – nach diesem Erlebnis im Theater – erkannte er in ihm einen guten Bekannten, indem er das übernommene Urteil seiner Eltern in sich selbst zurückwies. Und er erzählte diesem, was er vorhatte und wie gestaltig er sein Drama schreiben würde. Dieser lächelte ihn aber nur warmherzig an und sagte zu ihm: "Wenn es nur darum geht, den trägen Menschen einmal einen Eindruck zu machen, so lasse das Drama-Schreiben bleiben. Was leidet doch ein Mensch an seiner Uneinsichtigkeit und durch sie an Schicksalsschlägen, wie er es nennt und an scheinbarer Ungerechtigkeit! Glaubst du, wenn ihn der eigene Schmerz und Verdruss nicht zum Denken, Suchen und Fragen bringt, so würde es das Leid eines anderen vermögen? Das wird es ebenso wenig vermögen, wie ein Drama, das er schon zum vornherein nur Schau- Spiel (also ein Spiel zum Anschauen) nennt. Glaubst du, wenn der Mensch im Leben keinen Ernst kennt, er würde ihn beim Spiel, beim Schauspiel, finden? Siehe, ich gebe dir dazu etwas anderes zu bedenken: Einmal, vor fast zweitausend Jahren, kam der Vater aller Menschenkinder in seinem Sohne, Jesus Christus, zu uns Menschen, zeigte uns allen ausführlich und liebevoll die rechten Wege, die zu einem innerlichen Reichtum führen und erst noch die Härte der äussern Umstände mildern, ja fast gar aufheben würden. Und er ging, als unser aller Vorbild, selber auf ihnen einher. Er tat nur Gutes, erlöste die Gefangenen, stärkte die Schwachen, machte die Kranken gesund und erntete, nebst nur ganz wenig Anerkennung, sehr viel Hass. Diesen Hass glättete er zuletzt mit der Hingabe seines Lebens auf die schmerzlichste Art, am Kreuze, und bat dabei noch den Vater um Vergebung der Sünden seiner Widersacher. – Hast du schon einmal bemerkt, dass die Menschen davon Notiz genommen haben, oder gar einen Anteil?! Was du vielleicht glauben könntest, es würde an Sonntagen Seiner gedacht, ist nicht der Wirklichkeit entsprechend. Denn an Sonntagen gibt es nur das christliche Theater, das deine Eltern freilich Gottesdienst nennen würden. Hast du aber noch nie hingehört, wie nach diesem Theater die Leute reden und urteilen und über was? Du lächelst, also kennst du die Urteile und auch die Beweggründe ihres Herzens beim Reden. Um diese zu erkennen, sagte Jesus einmal: "Wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über." Behalte, was du gesehen oder entdeckt hast, in deinem Herzen verschlossen und liebe Jesum, der kein Drama schrieb sondern durchlebte, um unserer Seligkeit willen –, so wirst du in ihm, in seinem Wirken und in seinen Verheissungen Ruhe und Friede finden, und dich nicht mehr durch die Teilnahmslosigkeit all der vielen Unverständigen in deiner Hingabe an seine uns vorgelebte Wahrheit stören lassen, weil sich bei einer solchen Beschäftigung in dir nach und nach auch alle seine Verheissungen zu erfüllen beginnen, derweil die Menschen immer noch wie Verrückte durcheinander rennen, als suchten sie etwas und fänden es nicht. Sie suchen aber in Wirklichkeit nichts und finden auch nichts, als ihr eigenes, sie gross dünkendes Selbst, das stets kleiner wird und ihnen – kurz vor dem Grabe – oft äusserst hohl vorkommt.
August 1988
nach oben
DIE SÄNGERIN  Es lebte einmal in einer kleinen Stadt, an deren äusserstem Rande eine aus einem fremden Land zugezogene Familie. Armut und Verfolgung brachte sie dorthin, wo sie zwar Ruhe hatte, aber zum Leben kaum das Nötigste fand. Dennoch waren alle ihre Glieder recht fröhlich und beinahe unbekümmert, angesichts der dürftigen Verhältnisse. – – Vielleicht mit einer Ausnahme: der ältern der beiden Töchter nämlich, die dort mit drei Brüdern und ihren Eltern zusammen lebte. Diese ältere der beiden war zwar sanft in ihrem Gemüte und auch von Herzen dankbar für jede Kleinigkeit, aber fröhlich, im eigentlichen Sinne des Wortes, war sie nicht. Sie besass ein weiches, tief empfindendes Gemüt, war allem Schönen zugetan, aber sie war stets wie fremd in dieser Familie. Wohl sprach sie mit allen und half auch überall, wo Hilfe nötig war, aber stets hatte man das Gefühl, dass sie nicht alles sage, dass sie um Dinge wisse, über die sie nicht sprach. Anderseits konnte sie manchmal über Dinge reden, die zwar allen gefielen aber die dennoch niemand so richtig verstehen konnte. Die jüngere Tochter hingegen war äusserst lebendig und fröhlich, jedermann zugetan, und nichts konnte ihre gute Laune verderben. Wenn sie am Herd stand oder am Tische das Essen rüstete, sang sie stets dabei und ihre helle, reine Stimme war oft bis weit ausser Hauses hörbar.
Einmal, an einem frühen Sonntagmorgen, spazierte ein Gesangslehrer durch diese Gegend, gerade in dem Momente, als die muntere Sängerin die Fensterläden öffnete und ihre helle Stimme dabei in die reine Luft des taufrischen Morgens drang. "Mädchen!" rief da ganz überrascht und ohne weiteres Bedenken der Gesangslehrer, "Nimmst Du Gesangsstunden – und seit wann und bei wem?" Das Mädchen lachte und gab ihm zur Antwort, dass es keine Stunden nehme, sondern einfach so aus Freuden singe. Das weitere Gespräch durchs offene Fenster bildete dann den Anfangspunkt zu einer grossen Karriere, indem der Gesangslehrer dem Mädchen anbot, seine Stimme auszubilden und es fähig zu machen, in Konzerten oder auch Theatern aufzutreten. Das natürliche Talent des heranwachsenden Mädchens war so gross, dass es bereits nach zwei Jahren eine konzertreife Stimme hatte und auch ein beachtliches Repertoire an ausgesuchten und teils recht schwierigen Arien.
Weil sein Gesangslehrer einen weltberühmten Dirigenten kannte, der die junge Sängerin nach Anhörung sofort verpflichtete, hatte sie ihren ersten Auftritt in einer grossen Weltstadt und er wurde ein voller Erfolg. Nach nur wenigen Jahren war die äusserst schöne und vitale Sängerin bereits weltberühmt. Sie hatte hohe und höchste Gagen und genoss die Sympathie aller Zuhörer. Ihre Stimme hatte einen Klang und eine Reinheit, die bezaubernd waren und sie trug ihre Lieder mit einer seelenvollen Innigkeit vor, dass kein Herz ungerührt bleiben konnte.
Später heiratete sie einen Pianisten und hatte auch Kinder. Aber sie selber war stets auf den Bühnen der Welt und hatte kaum Zeit für ihre Familie und noch weniger für sich selbst. Dabei und damit verdarb sie ihre Gesundheit derart nachhaltig, dass sie bald einmal nicht mehr auftreten konnte, was sie äusserst schwer belastete. Zwar hatte sie sich einen Reichtum ersungen, den ihr ganzes ferneres Leben nicht mehr aufzuzehren imstande war und ihr Mann spielte ja unentwegt weiter und verdiente zu dem vielen Gelde ihrer früheren Gagen noch weiteres hinzu, aber sie wurde, trotzdem sie sich alles leisten konnte, stets unzufriedener und am Ende unglücklich.
Und was so leuchtend, so früh und so hoffnungsvoll begann, hatte mit 35 Jahren schon das Ende – ein langes Verhallen – gefunden. Wohl ergab sich die so bald Gealterte in ihr Schicksal, sodass die Unzufriedenheit sich legte und sie ganz ruhig dahinlebte, hin und wieder mit den spärlich einsprechenden frühern Freunden die alte Zeit des Erfolges hochleben lassend und dann und wann auch sehr gerne das Gespräch ganz gewöhnlicher Menschen suchend und schätzend. Aber alles das glich einer warmen Asche in einem Herd. Diese ist zwar recht schön warm, ja zuweilen noch ordentlich heiss und es geschieht einem unter Kälte leidenden Menschen noch recht wohl in der Nähe dieser Asche. Aber Licht gibt solche Asche nicht mehr, die all ihre Lebensgeister zuvor verbraucht hatte und lebendig geht es deshalb nicht mehr zu auf einem solchen Herd, sondern das Grau des Alltages legt sich stets dichter um die letzte Glut, je kälter diese zu werden beginnt. Wohl kann ein leiser Luftzug die Verbrauchte in ihrem Innersten noch einmal zum Erglühen bringen, aber sie verzehrt sich dabei selbst und die Wärme erlischt bald danach ganz. Das Fehlen eines Luftzuges aber lässt die Asche in der sonst angenehmen Ecke des Herdes noch lange wohlige Wärme ausstrahlen, aber über das Grau der Asche täuscht trotzdem nichts hinweg. Ja, die einst so hoch gefeierte Künstlerin ist zu solcher Asche geworden. "Warum auch muss denn Asche werden bei einem Feuer?!" Das fragte sich die verbrauchte Sängerin des öftern, aber eine Antwort darauf kannte sie nicht.
Als eines Tages ihre Schwester zu einem ihrer eher seltenen Besuche kam, stellte ihr die Sängerin ihre ungelöste Frage: "Warum auch muss stets Asche werden, wenn ein Feuer brennt?" – "Es muss ja nicht unbedingt!" widersprach ihre Schwester mit ihrer leichten und sanft verhüllten Stimme; "Eine Kerze zum Beispiel verbrennt ohne einen kleinsten Rest von Asche. Und auch bei allen andern Feuern gibt es zuvor Licht und Wärme, oft würzigen Rauch der ins Blaue des Himmels aufsteigt und sich dort sichtbar mit ihm vereinigt. Nur ein zurückbleibender kleiner Teil wird zu Asche dabei."
"Aber, warum muss denn gerade ich zu Asche werden?" fragte die Unglückliche fast beklommen.
"Nicht alles ist geeignet, bei einem Feuer sich mit der Himmelsluft zu vereinigen und was nicht fähig ist, sich zu verändern, das wird bleiben und muss im Bleiben seinen Trost finden, wenn es zuvor nicht in der Hingabe eine Seligkeit gefunden hat!"
"Wie meinst Du das?"
"Du warst doch, gleich mir, ein glückliches Kind im Hause unserer Eltern. Du erkanntest gleich mir die Vorzüge des Standes unserer Familie und der Bedingungen in welchen wir lebten. Einfachheit und ein wenig häusliche Enge, das gab unseren Seelen den nötigen Halt und eine schöne und geschmeidige Form, die vielen wohlgefiel. Wenn Du nun über diese Umstände, die uns werden liessen, was wir waren, eine grössere Freude gehabt hättest, als über deine Form und deine Talente, so hättest Du dich mit dem Grund und Gründer dieser Umstände vereint, also mit Gott, unserem Herrn und Beschützer, und wärest also als ein feines, würziges Räuchlein empor gestiegen, dem Himmel entgegen, der unsere Heimat ist, und hättest dich mit seiner Luft in seiner Ordnung vereint. Und die ewige Sonne würde dich wärmen und der Wind der Liebe Gottes würde dich erfrischen.
Aber Du hattest eben mehr Freude an der Form, als am Former – mehr Freude an der Gabe, als am Geber – und das ist nichts anderes als Liebe zu sich selbst. Du bist mit deiner Liebe also an Dir und deinen schönen innern und äussern Formen hängen geblieben, anstatt Du dich an den Formgeber gehängt hättest und von Ihm aufgenommen hättest die weitere, wahrhaftige Vollendung, die stets nur in Ihm ist und nie in Dir selbst, als nur insoweit Du mit Ihm eines wirst in Seiner Vollendung, durch die Liebe zu Ihm.
Auf diese Art bist Du zwar dich Selbst geblieben, zur gründlichen Beschauung deines wahren Selbst, damit Du erkennen mögest, wie dieses aussieht, wenn es nicht mehr gehalten und verbunden ist von und mit der Liebe und der Vollendung deines Schöpfers.
Aber siehe – ein wenig Wärme ist Dir noch geblieben, ansonst Du mir nicht eine solche Frage gestellt hättest. Dieser Wärme wegen trieb es mich auch zu Dir. Denn: wenn Du nun in diesem deinem jetzigen Zustand es zulassest, dass deiner Asche schweres Holz kreuzweise aufgeschichtet und dergestalt auch aufgebürdet wird, so kann der nächste Liebewind des Herrn, unseres Schöpfers, diese kleine, noch vorhandene Glut noch einmal entfachen, sodass die Liebesflamme, die dann erstehen wird, das schwere Holz erfassen kann und es völlig in Brand zu setzen vermag und in dieser mächtigen, neuen Hitze wird sich der bessere Teil der Asche zu rühren beginnen, sich reinigen und endlich frei werden und gen Himmel schweben, dahin, wo dich deine neu erwachte Liebe dann hinziehen wird."
Diese Worte waren Balsam auf das müde Herz der Sängerin und in ihr begann sich etwas zu regen. Sie erkannte, wie falsch begründet ihre Freude damals war und wie beinahe unschuldig scheinend sie in diese schwere Not kam, in der irrigen Meinung, stets das Gute geliebt zu haben; aber sie liebte es eben dort, wo es sich zeigte – also an sich selbst –, anstatt dort, wo es wahrhaftig ist, in ihrem Schöpfer nämlich. Und ein leiser Windzug zog – an ein frisches Frühlingslüftchen erinnernd – durch ihr Gemüt und entfachte ein wenig ihre matte Glut.
13.11.1988
nach oben
LIEBE UND VERSTAND  Während eines Gespräches zwischen einem Arzt und einem so genannten Heiler, die beide an einen fürsorgenden Gott glaubten, fragte der Arzt den Heiler, wie denn die Bibel anders auszulegen sei, als sich Gedanken zu machen über das geschriebene Wort Gottes. Sein Kollege, der Heiler, beantwortete seine Frage mit dem Hinweis, dass sich Gedanken aus zweierlei Gründen bilden können. Zum einen, indem der Verstand die ihm gegebenen Worte erwäge und probiere, sie in seine eigene, bisherige Ordnung einzubeziehen, denn nur, wenn das gelingt, können neu empfangene Worte zu einem brauchbaren Eigentum werden, das dann auch in der Praxis des täglichen Lebens brauchbar und anwendbar wird. Die andere Möglichkeit bestehe darin, dass die Liebe zu jenem Wesen, von dem die Worte gekommen sind, so gross ist, dass sie – die Liebe selber – sich in diesem Wesen heimisch zu fühlen beginne und aus dieser Übereinstimmung der beiden Wesen dann ein einziger grosser Gedanke, eine einzige grosse Ordnung wird, in welcher dann alle andern Gedanken und Worte aufgehen können – oft noch, bevor sie ausgesprochen würden. Darin erkenne man die grosse Kraft der Liebe, welche alle äussern Formen oder Worte sofort löse und aus ihrer durch das Ausgesprochen-Sein bedingten Isolation befreie durch die Aufnahme in ihre eigene Kraft und damit in ihr eigenes Leben. Zum bessern Verständnis des Gesagten erklärte er das in einem Gleichnis folgendermassen:
"Es sagte einmal ein Vater zu seinen beiden Kindern, die ihm in allem immer helfen wollten und ihm in ihrer Hilfe womöglich noch zuvorkommen wollten, ehe er sie wirklich hätte brauchen können: "Ich kann eure Hilfe nicht gebrauchen, sie ist mir zuwider." Das wirkte wie ein Donnerschlag auf das Gemüt der beiden, sodass sich ein jedes der beiden entfernte, ein stilles Plätzchen aufsuchte und in sich ging, um das strenge Wort des Vaters besser verstehen zu können. Das eine, das mit all seiner Liebe am Vater hing, wurde sehr traurig, denn es sah sich durch dieses Wort von seinem geliebten Vater getrennt. Und es überlegte in einem fort, wie es sich dennoch die Nähe seines Vaters verdienen könnte. Lange Zeit kam ihm keine gute Idee und in seinem Herzchen klammerte es sich stets fester an seinen Vater, so stark zwar, dass es sich unwillkürlich bei ihm stehen sah, und in seiner von der Liebe erwärmten Fantasie ihm bei der Arbeit zuzuschauen begann. Und es erfuhr in diesen Bildern eine Beruhigung seines aufgewühlten Gemütes und eine Lösung des schweren, fast wie bannend wirkenden Ausspruches seines Vaters. Und als es so recht ruhig sich sonnte in der sich vorgestellten Gegenwart seines Vaters, da fiel ihm plötzlich auf, dass es ja nun bei seinem Vater verweile, zwar nur in sich, in seinem Gemüte. Aber es erkannte dabei dennoch, dass ihm der Vater das Verweilen in seiner Gegenwart nicht verboten hatte, sondern nur das unzeitige Helfen-Wollen. Zwar sagte der Vater schon, dieses sei ihm zuwider, aber das müsse ja nicht unbedingt sicher heissen, dass auch ich selber ihm zuwider bin, so dachte es bei sich und eine leise Hoffnung begann sich in seinem Herzchen zu regen und vorsichtig näherte es sich nach und nach dem Wirkungsfeld seines Vaters wieder und sah ihm von weitem zu, wie er gleichmässig und unablässig seine Arbeit verrichtete und Ausgeglichenheit sein ganzes Wesen prägte. Es freute sich, seinen Vater wieder sehen zu können – und wohl auch zu dürfen? – Mit der Zeit kam es ihm immer näher, bis es einmal so nahe kam, dass der Vater seinetwegen etwas innehalten musste in seiner Arbeit, aber er nahm bald die Dinge anders in die Hand, sodass er trotz der etwas zu grossen Nähe seines Kindes weiterarbeiten konnte; und das seinen Vater betrachtende Kind glaubte, im Gesicht des Vaters ein Lächeln gesehen zu haben. Um sicher zu sein, dass es seinen Vater bei der Arbeit nicht störe, ging es aber dennoch zwei oder drei kleine Schritte zurück und betrachtete dabei seinen Vater. Da sah dieser zu ihm hin und sagte zu ihm: "So ist es recht, so kannst du bleiben." Und im Herzen des Kindes wurde alles wieder frei. Es atmete erleichtert auf und seine Augen leuchteten, seine Wangen wurden heiss und färbten sich rot und eine grosse Seligkeit verbreitete sich in seinem Gemüte. Den ganzen Tag schaute es seinem Vater zu, und die Zeit verging ihm so schnell, dass es gar nicht gewahrte, wie es Abend wurde, bis der Vater sein Werkzeug beiseite legte, es ansah und ihm seine Hand entgegenstreckte, um es an derselben nach Hause zu führen. Und so stand das Kind fortan viele Tage bei seinem Vater und schaute ihm bei seiner Arbeit zu. Dabei begann es vieles tiefer zu begreifen von dem, was sein Vater tat, ohne dass es jedoch mit ihm sprach. Denn es wollte seinem Vater in gar nichts mehr zu wider sein. Und da es nicht wusste, ob ihm das Fragen auch zu wider sei, wie das Helfen, so wollte es mit einer Frage nichts riskieren. Und es schwieg aus diesem Grunde. Aber je länger es schwieg, desto tiefer drang es ins Wesen und teilweise auch in die Gedanken seines Vaters, sodass es mit der Zeit sogar zu erkennen begann, wo und wie es seinem Vater mit seiner Hilfe zuwider geworden sein musste. Denn bei manchen Stellen der Arbeit seines Vaters erkannte es, dass es an dieser früher eben diese oder jene Hilfeleistung erbracht hätte, die dann aber falsch oder zur Unzeit gewesen wäre. Und die Liebe zu seinem Vater wuchs dabei. Stunden-, ja tagelang konnte es so seinem Vater zusehen und ihn stets mehr lieben; und in seinem Gemüte war es dabei rege; es sah dieses und jenes und sah auch manches ein, das es früher nie so recht begreifen konnte. Und als es einmal nach vielen Tagen und Wochen seit jenem zurechtweisenden Worte seines Vaters in der Liebe so feurig wurde, dass es seinen Vater des Abends, als er ihm die Hand darbot, damit es an seiner Hand mit ihm nach Hause zöge, ansprechen musste. Es sagte zu ihm, dass es nun immer besser einzusehen anfange, dass und wie seine Hilfe ihn bei seiner Arbeit habe stören müssen. Da zog der Vater sein Kind zu sich, drückte es an sich und erhob es zu sich an seine Brust, herzte es und sagte zu ihm: "Weisst du, kleiner Kerl, du hast schon recht mit dem, was du mir nun gesagt hast, aber ich habe dich zu sehr lieb, als dass die Behinderung, die meine Arbeit dabei erlitten hatte, der Grund dafür sein könnte, dass mir deine Hilfe zu wider war. Siehe, dich kleinen Kerl weiss ich schon noch in seinen Fehlern zu umgehen. Aber du hast mir bei deiner Hilfe stets deine eigene noch völlig unreife Art aufdrängen wollen und hast dadurch meiner eigenen Art verwehrt, in dein kleines, zartes und noch aufnahmefähiges, aber noch etwas ungeordnetes Herzchen zu fliessen und es dabei zu ordnen und zu stärken. Und das hat dich und mich dann einer gewissen Seligkeit beraubt, die du doch nun in der Fülle bei mir haben kannst. Das alleine war meinem Sinne zuwider. Verstehst du das nun, da du doch erlebst, wie schön wir es zusammen haben können?" Das Kindlein begriff und drückte seines Vaters Haupt an seine Brust. Es nahm bald zu an Kraft und Weisheit, und voller Bescheidenheit und grossem Dank nahm es die ihm bald darauf hin und wieder von seinem Vater aufgetragenen Arbeiten an, und führte sie voll Liebe und voller Hingabe an des Vaters Wunsch aus, sodass ihm diese stets besser gelingen mussten zu seiner eigenen und seines Vaters Freude.
Das andere Kind aber dachte in seiner dunklen Ecke, in welche es sich zurückgezogen hatte, folgendes: Meine Hilfe ist meinem Vater zuwider, dann muss ja auch ich selbst ihm zuwider sein, denn mein Herz ist voller Hilfe. Wer mag da bestehen können bei einem, dem man zuwider ist. Ich will ja meinen Vater nicht belästigen, deshalb will ich ihm künftig aus den Augen gehen und mehr bei meinen Schulkameraden verweilen. Diese lachten, als sie hörten, dass er seinem Vater geholfen hatte, und sagten zu ihm: wer wird auch so dumm sein, und seinem Vater, der ja stärker ist als wir alle, helfen wollen. Wir haben später einmal genug zu arbeiten; was wollen wir uns die Kindheit versäuern. Und sie spielten miteinander und eines hielt dabei das andere von dessen Vater ab. Als es dann bei fortwährendem und stets waghalsigerem Spiel einmal einen Unfall gab, da freilich musste der Vater kommen. Er trug drei verletzte Kinder davon und sie kamen ins Spital. Dort erlebten sie unruhige Zeiten. Denn es waren Knochenbrüche komplizierterer Art auszuheilen, und grosse Schürfwunden frassen mit ihrem brennenden Schmerz tief in ihre Seelen, sodass das Essen und Trinken nicht mehr schmecken wollte und ihnen vorkam, wie fader Schweinefrass. Und die starre, tote Ruhe ihrer eingegipsten Glieder war so grässlich, dass sie sich in ihren Gipsverbänden wie bereits im Grabe vorkamen und sie verzweifelten ob der Unmöglichkeit, sich rühren zu können, wie es dem Bedürfnisse ihrer Seele und zeitweise auch ihres Leibes entsprochen hätte. Als sie geheilt waren, und jedes nach seinem Zuhause gehen konnte, da kam der eine, abgemagert bis zum Skelett zu seinem Vater heim. Seine Glieder waren zwar nun wieder frei, aber er hatte zufolge der langen, durch den Gipsverband aufgezwungenen Ruhe keine Kraft mehr in ihnen, denn seine während dieser Zeit untätigen Muskeln waren bis auf ein Minimum geschwunden. Der Vater freute sich dennoch mächtig, aber der Knabe war in sich zerknirscht und sagte zum Vater: "Wenn ich nur wenigstens wieder hier zu Hause bei dir, lieber Vater, in meinem Bette liegen darf – anstatt im Spital – und du nur wenigstens am Abend nach deiner Arbeit zu mir kommen und mir ein gütiges Wort geben möchtest, so bin ich glücklicher, als ich je war". Diese Rede erfreute den Vater tief und er hatte über dieses wieder gefundene Kind eine grosse Freude, weil es ihm zugänglich geworden war." –
Mit diesen Worten endete der Heiler seine Gleichnisgeschichte, mit der er ersichtlich machen wollte, welche Art von Auslegung des geschriebenen Wortes die bessere sei: jene über die Abwägung mit dem Verstande, oder jene über eine mächtige Liebe zum Guten und Wahren, das jenseits menschlicher Berechnungen und jenseits aller Verstandesvernünfteleien liegt, und darum nur mit der Liebe gefunden werden kann, weil es in Gott alleine liegt, der wieder nur pur Liebe ist. Aber er zog daraus noch einen Schluss, den er folgendermassen formulierte: "Damit haben Sie zwar fast das Gleichnis des verlorenen Sohnes. Aber Sie haben dazu auch noch gerade den Grund dafür ersehen, wie und weshalb es zu diesem Drama in der Menschheitsgeschichte stets von neuem kommen muss. Es ist der Verstand nämlich die Amme, und die Auslegung der Bibeltexte aus dem Verstande ist die fade Ammenmilch, welche den Vater zu einem unaushaltbaren Unding verkommen lässt, während doch dieselben Worte im liebeerfüllten Wesen eines andern zu einer grossen Erkenntnis und Erleuchtung über die wahre Grösse des Vaters führen kann, die sich von den Menschen nicht erzürnen lässt, die aber wohl die Menschen erzürnen machen kann, sodass sie denn nach ihrem (Un-)Fall die Korrektionen als Hölle und Zorn empfinden müssen – was sie in Tat und Wahrheit zwar auch sind, jedoch nicht Zorn Gottes, sondern Zorn seiner Kinder gegen das unverstandene Gute im göttlichen Walten.
Sehen Sie, es war ja die Schlange schon bei Adam bedacht, ihn über seinen Verstand zu packen und zu verführen. So ist auch eine jede Krankheit ein "Wort Gottes", wenn es schon heisst, dass alles was gemacht ist, aus dem Worte Gottes gemacht sei (Joh. 1, 5) – also auch die Einrichtung des Leibesorganismus der bei Fehlverhalten krank werden muss, um die Seele etwas "handgreiflicher" auf die Ordnung Gottes aufmerksam werden zu lassen. Und wir Ärzte täten gut daran, dieses Wort Gottes mit der Liebe unserer Herzen und aller Tat daraus auszulegen, anstatt mit unserm Verstande daran herumzukritteln, die Lage des Patienten verbessern wollend, ohne vorher seines Herzens Kräfte, durch die Lenkung in die richtige Richtung hin, zu verbessern, damit dann eine gesunde und kräftige Seele ihren Leib auch fernerhin gesund und tauglich dafür erhalten kann, den andern zu helfen und zu dienen, damit der göttliche Geist in ihr erweckt wird, dem ohnehin jede Krankheit des Leibes zu heilen möglich ist."
nach oben
DER REICHE UND DER ARME  Es war einmal ein Armer, der hatte – irdisch genommen – das Glück, neben einem Reichen zu wohnen, der in allem recht freundlich war und kein borniertes Wesen hatte, so wie es vielen Reichen sonst eigen ist. Seine ärmliche Hütte hatte er von seinem Vater geerbt, und sie stammte aus einer Zeit, da ringsherum noch keine Häuser erbaut waren. Aber die Lage war günstig und schön gelegen, sodass sich mit der Zeit viele Reiche daselbst niederliessen. Und dennoch war der Arme nicht etwa durch das Grundstück reich geworden. Denn es lag ausserhalb der Zone, in welcher gebaut werden durfte. Sein reicher Nachbar bewohnte denn auch mehrere hundert Meter von ihm entfernt das letzte Haus der "Reichen-Siedlung". Trotzdem trafen sich die beiden öfters, denn es hatte der Reiche viel auf den Feldern zu tun, und der Arme konnte dem Reichen in vielem behilflich sein, sodass er trotz seiner Armut nie hungern musste. Aber wenn er jeweils bei seinem Nachbarn arbeitete, so verspürte er wohl dennoch, wie so bitter arm er war. Denn für alles, was er zu Hause von Hand machen musste, hatte der Reiche Maschinen. Alles war ordentlich, sauber und grosszügig angelegt. Wenn er manchmal an seinem Tische speisen durfte – wenn er gerade bei ihm tätig war –, so empfand er seine Armut nicht nur an seinen Kleidern, sondern auch an seinem etwas wortkargen und unsicheren Benehmen. Wenn er hörte, was alles die Familienangehörigen am Tische besprachen und teils berieten, so konnte er nur immer von neuem erkennen, wie schrecklich arm er war. Denn erstens wussten diese über alles Mögliche Bescheid, kannten alle vorhandenen Mittel und hatten stets das nötige Geld, sich diese auch zu beschaffen. Sie kannten aber auch alle Verhältnisse und konnten so mit der grösstmöglichen Effizienz ihre Geschäfte tätigen. Woher hätte er selber auch die Zeit hernehmen sollen, so vieles zu kennen und zu wissen?! Er musste arbeiten, um nur zu seinem dürftigsten Unterhalt genug zu verdienen. So gerne er bei seinem Nachbarn war, da dieser wirklich ein umgänglicher, ja in gar manchem ein rücksichtsvoller Mensch war, so beengte ihn stets seine Armut, die in allen Vergleichen, die er immer wieder anstellte, auch immer wieder hervorleuchtete. Auch im Sprechen, im Benehmen in der ganzen Erscheinung, waren die Angehörigen des Reichen so ganz natürlich, ungezwungen und selbstsicher, auch vergnüglich ohne Hast, ohne Kummer und ohne irgendwelche drückende Sorgen, sodass ihre Freiheit eine beneidenswerte Selbstverständlichkeit hatte. Sie waren ihm gegenüber auch entgegenkommend, gaben ihm manches, das sie nicht mehr brauchten, oder fuhren ihn manchmal gar in die Stadt, wenn er dort irgendetwas zu besorgen hatte. Das machte den Armen aber in seinem Gefühle nur noch ärmer. Denn er musste es ja spüren, wie sehr sie ihm gegenüber doch grosszügig waren, auch in der Zeit, die sie für ihn hatten, denn er hatte so Vieles auf so beschwerliche Art zu besorgen, dass er nie so spontan und jederzeit für den Reichen Zeit hatte, wenn dieser ihn hin und wieder besuchte.
Der Arme wurde dadurch vom Reichen stets abhängiger, ohne dass dieser es aber je ausgenutzt hätte. Freilich: mit einem einmaligen Darlehen zu niedrigem Zins hätte der Arme sein Los um vieles verbessern können, aber daran dachte er nicht einmal, und wäre es ihm auch in den Sinn gekommen, so hätte er sich dennoch niemals dafür gehabt, den reichen Nachbarn darum anzugehen. Die kleinen, alltäglichen Entgegenkommen liessen ihn in seinem Gefühle schon zu sehr in seiner Schuld dem Reichen gegenüber erscheinen.
Manchmal war er ganz zerknirscht, wenn er sich wieder mit dem Reichen verglich. Dieser war stets so sauber, freundlich und in aufgeräumter Stimmung, während er selber oft beim besten Willen nicht so unbeschwert freundlich erscheinen konnte, wenn ihn die Sorgen gerade wieder so recht drückten. Für immer weniger Wert kam er sich vor, sodass er bei seinen steten Vergleichen manchmal beinahe verzweifeln konnte. Dabei war es nicht etwa so, dass er dem Reichen hätte gleich sein wollen, um ihm gleich zu sein, sondern nur, um ihm auch einmal etwas zurückzugeben zu vermögen.
Da kam eines schönen Morgens einmal ein Fremder von der freien und offenen Landseite her zu ihm und fragte ihn, ob er für einen Tag bei ihm ruhen könnte, denn er komme von weit und möchte, ehe er sich die Stadt ansehen wolle, einen Tag in aller Stille bei ihm Ruhe nehmen und da wäre sein etwas abgelegenes Haus gerade günstig. Wenn er nur im Garten verweilen könne, so würde ihm das genügen. Der Arme verwunderte sich, dass der Fremde nun gerade zu ihm kam, entschuldigte sich ein wenig und riet ihm, er solle doch nur zu seinem Nachbarn gehen, da würde er bestimmt alles bekommen, was er nur wünsche und brauche. Der Fremde aber sagte zu ihm, er komme nicht darum, um zu nehmen, sondern um zu geben, und da habe er doch bestimmt mehr nötig als sein reicher Nachbar. "Ja, nötig hätte ich zwar vieles, aber mir gibt ja glücklicherweise der Nachbar stets das Nötigste, darum muss und will ich ihm dankbar sein und mich mit dem begnügen." – Der Fremde aber, der dem Armen irgendwie bekannt und vertraut vorkam, sagte zu ihm: "Ja, da hast du recht, wenigstens darin, dass du nur das Nötigste von ihm erhältst. Ich aber will dir mehr geben, damit auch du den noch Ärmeren einmal geben kannst nach deiner Weise. Denn du wirst ihnen mehr als nur das Nötigste geben." – Der Arme fühlte sich getroffen, denn er spürte plötzlich, dass er einem noch Ärmeren wahrhaft gerne mehr gegeben hätte als nur das Allernotwendigste, und er sagte: "Ja, das mag wohl sein, aber was willst du mir denn geben, das über meine Not hinausgeht? Wahrlich, deine Zeit, die du mir zuwendest, ist schon recht viel für mich." Da sagte der Fremde: "Das verstehe ich nicht. Wendet dir doch der reiche Nachbar oft sehr viele Zeit zu, wenn du bei ihm bist, sodass ich noch recht viele Tage bei dir bleiben müsste, wollte ich ebenso viele Zeit mit dir verbringen wie dein reicher Nachbar." Diese Antwort verwunderte den Armen sehr. Kannte er doch den Fremden nicht, wiewohl er ihm stets bekannter vorkam. Woher also konnte er das wissen? Und doch, sein Verhältnis zu ihm war ohne viele Worte ein so offenes und trauliches, dass er plötzlich einen ungemeinen Unterschied festzustellen glaubte zwischen derjenigen Zeit, die ihm sein reicher Nachbar zuwandte und jener Zeit, die der Fremde für ihn hatte. Der Fremde war irgendwie alleine seinetwegen da. Dass er bei ihm ausruhen wollte, wie er sagte, empfand er plötzlich wie einen blossen Vorwand, während er erstmals zu spüren oder wahrzunehmen glaubte, dass sein reicher Nachbar – wiewohl er ihm in allem entgegenkam – denn doch nur vor allem geniessen wollte, wie in gar allem er ihm überlegen war und wie sehr er, als sein armer Nachbar, in seine Schuld fiel, schon nur durch seine Aufmerksamkeit ihm gegenüber. Und je mehr er darüber nachdachte, desto mehr schien er sicher zu werden, dass es für seinen reichen Nachbarn ein ordentlicher Spass war, ihm gegenüber so freigiebig und mildtätig zu sein, und wie sehr er ihm immer nur das Nötigste gab und ihn um alles bitten liess. Natürlich empfand er es auch als nichts mehr, als nur richtig, dass er für alles bitten musste, was ihm ja nicht gehörte, aber dennoch empfand er nun plötzlich gemütstief, wie sehr ihm der Fremde gewogen war, vieles, ja vielleicht gar alles zu geben. Das verwirrte ihn, und in seiner Hilflosigkeit begann er zum Fremden eine tiefe Liebe zu empfinden, und er merkte, wie sehr diese Liebe verschieden war von seiner bisherigen, förmlichen Dankbarkeit den Gaben des Reichen gegenüber.
Der Reiche brauchte die Armut seines Standes zur Bestätigung seiner selbst, und dieser Fremde nutzte sie – so kam es ihm jedenfalls vor –, um ihn so recht tief glücklich zu machen. Und er sagte darum zu ihm: "Du gabst mir mit deinem Wohlwollen schon jetzt mehr Zeit als mein Nachbar, der ja eigentlich nur meine Zeit für sich selber nahm." – "Das hast du nun aber ganz gut herausgefunden", antwortete ihm der Fremde, "aber dadurch hast du ja noch keine deiner äussern Nöte gelindert bekommen". – "Oh doch", sagte nun der Arme, "ich habe meine Zeit für mich wieder gefunden! Ich sehe nun, dass ich vieles mehr zur Linderung meiner Not tun könnte, wenn ich sie nicht zu sehr mit meinem Nachbarn teilen würde. Wohl geschieht mir nichts dabei und ich werde dem Äussern nach auch erhalten, aber ich bin in mir selber zunichte geworden, während du mich nun ohne etwas zu tun wieder aufgerichtet hast mit deiner Liebe zu mir und deiner Zeit für mich. Ich spüre nun tatsächlich, dass auch in mir noch etwas ist – freilich noch in tiefer Ruhe sich befindend –, das ich gerne erwecken würde, um es dir entgegenbringen zu können. Du hast mich reich gemacht, indem du mir den Schatz in meinem Herzen zeigtest, den du berührtest, als du zu mir sagtest, du kommest nicht, um zu nehmen, sondern um zu geben. Beim reichen Nachbarn bekam ich wohl einen ordentlichen Lohn, aber er war natürlich – meiner bescheidenen Fähigkeiten wegen – viel geringer, als er seine Stunden wohl verrechnen wird. Bei dir aber habe ich einen vollen Lohn, indem du mir alles erschlossen hast, was bis jetzt unerkannt in mir geruht hat – und das ohne, dass ich zuerst gearbeitet hätte.
Nur möchte ich dir nun alles geben, was ich nur habe; aber dazu wird die Zeit ja nie reichen, weil ich ja erst nach und nach innewerde, was ich alles noch habe und wie ich es freibekomme, um es dir geben zu können. Wahrhaft, wenn du jetzt nicht gleich für ewig bei mir bleibst, so wirst du mir auch nicht dasjenige geben können, das ich nun plötzlich so dringend brauche: einen, dem ich geben kann." Da lächelte ihn der Fremde herzlich an und sagte: "Wohlan mein Freund und Bruder, du hast mich ja mit deinen Worten förmlich genötigt, zu bleiben, und so bleibe ich für so lange bei dir, bis du mir alles gegeben hast, was du mir geben willst und aus deiner Liebe heraus auch wohl geben musst – und soll es ewig dauern. Denn ich sehe, dass sich nun fort und fort alles bewegt und mehrt in dir, sodass ich wohl noch einen ordentlichen Sturm zu gewärtigen habe. – Aber nun komme, wir wollen zusammen ein Mittagsmahl halten." – "Ich habe nur altes Brot", entschuldigte sich der Arme, aber der Fremde sagte: "So bring es. Ist es dir recht, so soll es auch mir recht sein". Als sie beide das Brot assen, kam es dem Armen auch gar so gut schmeckend und sein ganzes Wesen so stärkend vor, sodass er am Ende gestand, er habe wohl noch nie eine so stärkende und ihn über alles erheiternde Mahlzeit gehabt! Wie denn das auch käme? Und der Fremde antwortete ihm: "Das kommt daher, dass wir das Vorhandene dankbar annahmen und daraus das Beste machen wollten. Und so ist es denn nur natürlich, dass es auch so gut herausgekommen ist. In dieser Weise können wir fortan noch manches tun." – Von da an gingen dem Armen alle Arbeiten gut vonstatten. Was er brauchte, fand er stets irgendwie und irgendwo in seinem Hause. Und alles, was er fand, konnte er gut gebrauchen. Vor allem machte er dem Fremden eine schöne Kammer bereit, denn er fand in seiner aufflammenden Liebe zu ihm viel mehr in seinem Hause vor, als er vermutet hatte und auch mehr, als er vorher für sich selber brauchte, weil der Überschwang seiner Liebe seine Fantasie beflügelte und ihm so alles reicher und zweckdienlicher erscheinen liess, als er es vorher empfunden hatte. Dadurch kam er bald einmal – wenn auch nur nach und nach – zu immer grösseren Möglichkeiten, sodass letztlich auch sein Verdienst zunahm. Einzig ein kleiner Schatten bildete sich in dem neuen, wärmenden Lichte, das in ihm wach wurde, seit der Fremde bei ihm eingezogen war: Das war der Umstand, dass sich der reiche Nachbar nicht mehr so viel sehen liess und auch nicht mehr so erfreut war, wenn er ihn traf. Denn durch keine Gabe mehr konnte er sich bei ihm interessant, bewundernswert oder gar unentbehrlich machen.
Dennoch blieben sie lange Zeit gute Nachbarn. Nur verspürte der Reiche stets vermehrt, wie wahrhaft, weil grundursächlich, der Arme jetzt reich war. Reicher als er! Denn er brauchte keine Armen, um ihnen gegenüber reich zu sein, sondern er brauchte Arme nur, um sie so reich zu machen, wie er selber war. Je mehr sich dann der Reiche mit der Zeit mit der Art des Reichtums des Armen beschäftigte, desto kostbarer kam ihm dieser Reichtum vor. Aber es brauchte sehr lange Zeit, bis er sich dann doch als so arm vorgekommen war, dass er beim reich gewordenen Armen einmal betteln ging. Und dabei war es noch ein ordentliches Glück für ihn, vorher ein so festes Verhältnis mit dem früheren Armen gehabt zu haben. Denn alle andern Reichen dieses Ortes hätten es für immer unter ihrer Würde gefunden, beim ehemals Armen betteln zu gehen. Sie blieben darum auch arm inmitten ihres äussern Reichtums bis dieser endlich zu schwinden begann. Danach aber waren sie dann doppelt arm. Denn ihr Reichtum und das Gefühl, das er in ihnen entstehen liess, schloss den ehemals Armen für immer aus ihrem Kreise aus – und damit natürlich auch seinen neu erwachten und auch neuartigen – weil geistigen – Reichtum.
Wird es wohl schwer zu erraten sein, wer der Fremde war, der gleich für ewig bei dem Armen verbleiben wollte, und dessen Liebe ihn so reich gemacht hat? Wohl kaum! Wer aber war der Arme, und wer sein reicher Nachbar, und wer die vielen andern Reichen? Der Arme ist zunächst ein jeder Idealist. Denn er hat für alle und für alles Zeit. Er bewundert das Ideale, wo es ihm nur vorkommt, zollt ihm seine volle Anerkennung und gewährt ihm Unterstützung. Nur erkennt er anfangs oft etwas Falsches als ein Ideal. Findet er aber einmal das rechte Ideal, oder erschliesst es sich ihm eines Erkenntnismorgens im Garten seiner Liebe, so wird er überschwänglich reich. Dem reichen Nachbarn entspricht zunächst jedermann in guten äussern Verhältnissen, der in direktem und ständigem Kontakt zu einem solchen Armen steht. Die übrigen Reichen aber entsprechen zunächst allen Menschen in geordneten, äussern Verhältnissen, welche die Gediegenheit und Fortdauer solcher Ordnung bloss geniessen und dabei nicht in sich selber gehen und sich fragen, ob mit dieser Ordnung auch wirklich allen gedient ist.
In einem etwas spezielleren Gebiete – der Geschlechtlichkeit – gibt es dann freilich auch speziellere äussere Reichtumsunterschiede. Da entsprechen den Armen die Männer, und den Reichen entsprechen die Frauen. Wobei die angetraute Frau ein 'Nachbar' zum Armen wird. Worin aber sind die Männer arm, und die Frauen reich?
Das wird doch etwa nicht so schwer zu ermitteln sein. Sind es doch im Allgemeinen nur die Männer, die die Frauen aufsuchen und zuweilen auch recht ordentlich bei ihnen (um ihre Gunst) betteln gehen. Was also haben diese denn, das den Männern abgeht? Haben sie nicht eine schöne, gediegene Form – also gute und geordnete äussere Verhältnisse? Damit aber haben sie schon die Gunst der Männer, und diese bringt ihnen Zeit, Aufwendungen und Bewunderung entgegen. Dadurch aber werden sie für den Einzelnen stets noch teurer und damit für sich selber reicher. Denn wie der Bankier lieber dem Reichen sein Geld leiht, der es ihm mit satten Zinsen wieder zurückerstatten kann, als dem Armen, der es zwar nötig hätte, bei dem es aber fraglich ist, ob er es auch nur schon wieder zurückerstatten kann, geschweige denn gar einen Zins bezahlen, so ist es auch bei den Frauen der Fall: Sie geben ihre Sympathie auch lieber einem, der noch viele in seinem Gefolge hat, und der ihre Stellung dadurch noch erhöht, als einem, der ihnen nichts bietet als seine anerkennende Bewunderung. Und dennoch gibt es unter ihnen auch solche, die mit der Anerkennung ihres Wertes alleine schon zufrieden sind. Während die zuerst Beschriebenen zu den übrigen Reichen zählen, die nur unter sich Gesellschaft pflegen, nicht aber mit Armen, werden diese Zweitgenannten Nachbarn – oder eben Nachbarinnen – der Armen (durch eine ordentliche Ehe). Sie sind nicht hochnäsig, sondern offen für jedermann, der ihnen Anerkennung zollt. Sie haben aber, gleich dem reichen Nachbarn, dennoch so viele Vorzüge, deren sie sich immer wieder genüsslich bewusst werden können, sodass ein sie Anerkennender neben ihnen leicht noch ärmer erscheinen kann, als er es in Tat und Wahrheit eigentlich wäre. Denn schon ihre äussere Gestalt ist nicht nur rundlicher, dabei dennoch zierlicher und weicher in allen ihren Teilen, und ihre Haut ist fein und füllig, samtweich und rein und völlig offen – ohne schäbigen Haarwuchs. In ihrem Gesicht hat es keine Bartstoppeln. Ihre Bewegungen sind oft grazil und der Reichtum ihrer Formenfülle ist – in jeder Pose sich verändernd – von verwirrendem Eindruck auf den sie bewundernden Mann. Sie muss sich solcher Fülle wegen nicht mit dem Erwerb ihrer Anerkennung abgeben. Sie hat sie von Natur aus. Sie ist auch oft sehr flink, und – weil sie sich nicht mit Erwerbssorgen nach weiterer Anerkennung beschäftigen muss – auch schnell von Begriff, was äussere Belange angeht. Sie strahlt, als Mittelpunkt allgemeiner Anerkennung, stets eine Fülle aus, die ihr ja eben von den Armen entgegengebracht wird. Sie versteht sich aus diesen Eigenschaften heraus als einigermassen vollendet – wenigstens ihrem Gefühle nach, das stets auf sie einwirkt –, wenn vielleicht auch nicht dem Verstande nach, dessen Resultat sie jedoch nur erhielte, wenn sie ihn darüber sehr ernstlich befragen würde. (Das war auch in frühern Zeiten so, denn – oft nur scheinbar – keinen Einfluss zu haben, benimmt dem Menschen noch lange nicht den Eindruck seiner Vorzüglichkeit, welche sich letztendlich darin bestätigt, dass die Frau auch ohne gesetzliche Rechte noch immer fast unbemerkt den Mann bestimmt hatte.)
Es ist leicht begreiflich, dass die scheinbare Bescheidenheit, die schon mit einer einfachen Anerkennung zufrieden ist, nicht grosse Probleme zu wälzen bekommt und dass darum die ganze Kraft zur Entwicklung eines möglichst unkomplizierten und problemlosen Tätigkeitsflusses eingesetzt werden kann. Das aber erhöht noch einmal die Wertschätzung. Denn zu der schönen und begehrenswerten äussern Form des Leibes gesellt sich damit eine schöne, ungestörte und damit harmonische Form der äussern Tätigkeit, die so leicht vonstatten geht, dass sie auch noch für viele Belange eines Armen ausreicht.
Dem gegenüber hat der Mann gar nicht viel, ausser seiner Kraft der Liebe. Aber,– – wer sucht schon eine nicht schaubare Kraft? Alle suchen nur die Formen! Sei es in Gegenständen des täglichen Bedarfs oder in Werken der Kunst oder eben bei Frauen – besonders wenn sie mit beneidenswert grazilen Bewegungen und in unkomplizierter Art ihre Arbeiten verrichten. Überall entscheidet der äussere Eindruck! Ist der gross, wie beim glänzenden Gold, so steigt auch der Wert. Der Mann hat aber durch seine Liebe bedingt auch den Zug, die Wahrheit zu suchen. Dabei spürt er wohl auch seine Kraft, aber er erkennt auch gleichzeitig, wie wenig er damit zuwege bringt für das Urteil der weiblichen und der weibisch gewordenen Welt. Zudem ist die Wahrheit zu suchen und zu finden, die sich ja nach dem jeweiligen Standpunkte eines suchenden Wesens immer wieder ganz verschieden zeigt, sodass sie in ihrer äussern Erscheinlichkeit fast unauflösliche Widersprüche bietet, für viele weder eine angenehme, noch erfolgreiche Tätigkeit! Die offenere und gerade Art der Liebe des Mannes, mit der er nicht nur die Wahrheit angeht, sondern auch seine Mitmenschen, und mit der er auch auf Probleme losgehen kann, macht sein Gemüt auf der einen Seite wohl etwas zugänglicher, aber in ihrem Ernst ist sie dann auch oft etwas abstossend und die Nebenumstände übersehend. Das weiss und spürt der Mann und sucht diese Schroffheit auch zu mildern, wenn anfangs oft auch ohne viel Erfolg. Dieser Umstand wird dann zum Grund der Bewunderung der Frau, die auf indirekten, sozusagen idyllisch verschlungenen und romantischen Weglein geht, damit wohl zierlicher und harmonischer in ihren Äusserungen und ihrer Äusserlichkeit wirkt, aber dafür auch nicht die Kraft aufbringt, am Ziel der Wahrheit und der Wahrhaftigkeit so unbedingt festzuhalten. Sie findet, dass die Form nicht leiden darf; der Mann findet, dass der Inhalt, nicht leiden darf. Und weil er nicht so schnell erkennt, wie sehr der Inhalt unter einer ihm nicht entsprechenden, äussern Form zu leiden hat, sofern an der Form festgehalten wird, und dadurch für sich selber auch immer unvollkommener und immer schwächer wird, so bewundert er in der dadurch erworbenen Schwäche seiner inhaltlichen Kraft ahnungslos die Vollkommenheit der äussern Form sowohl des Leibes wie der Bewegung und der scheinbaren Bewältigung der Widerlichkeiten äusserer Vorkommnisse bei der Frau. Er verliert dadurch nicht nur wertvolle Zeit, sondern oft auch gar sein Ziel aus seinen Augen. Und so bleibt er wirklich immer arm! Hat er dann eine Reiche (Frau) als Nachbarin, so freuen sich darüber beide. Endlich kann er irgendwo sein, wo es besser ist, und endlich hat auch sie eine bleibende Anerkennung gefunden. Sie tut vieles für den Armen. Teils wohl, weil sie es sieht, wie nötig er es hat; dann aber, nach vollbrachter Tat, freut sie sich denn doch mehr darüber, dass sie selber es hat und man es bei ihr auch finden kann, als darüber, dass endlich auch der Arme an ihrer Seite etwas hat! Gewiss, das ist in keiner Weise schlechte Absicht. Das ergibt sich ja zwangsläufig so. Nur eben, wer das zwar erkennt und dabei trotzdem ruhig bleiben kann, der hat ja eben das Fundament zur so viel bewunderten Selbstsicherheit und Eleganz gelegt, mit welcher er sich durch all die Gefilde menschlichen Seins und seelischer Empfindung bewegen kann. Darum auch erhöht ja jede Bewunderung den Reiz dieses Reichtums. Aber selbst wenn diese Einstellung auch noch so unbefangen sein mag, so geht sie doch an der Armut des Nächsten – sich selbst bereichernd – vorbei und gibt sich mit dieser Ordnung zufrieden – den eigenen Reichtum mehr fühlend als das Unbehagen der Armut im andern. Und das zementiert nicht nur die äussern Verhältnisse, sondern verbaut auch die völlige Einigung mit dem Armen in gemeinsamem Reichtum und mit einbezogen dann auch die Möglichkeit, als selbst einmal arm geworden, durch den bisher noch unbekannt gebliebenen Fremden im bisherigen Armen dann direkt beschenkt zu werden. Und bei dieser Sachlage braucht es dann zumeist eine recht lange Zeit, bis dann der Arme endlich einmal in sich geweckt wird durch die innere Wahrnehmung, welche ihm aus der ausharrenden Liebe zur Wahrheit einmal werden kann in seinem Herzen. Und diese Wahrnehmung wird dann durch den bis dahin Fremden bewirkt, der da eines Erkenntnismorgens plötzlich im Garten seiner Ideale und Liebesbemühungen steht und ihn fühlen lässt, wie so zu gar nichts aller äusserer Schaureichtum taugt, und wie viel Vollendung anderseits auch in ihm selber – und zwar in seinem ewig lebendigen Gemüte – zu erreichen möglich würde, würde er endlich seine Kraft in ihrem Wirken vollenden, anstatt bloss die Vollendung in der äussern Form zu suchen. Dann erst wird er völlig erwachen und sein bisheriges Verhältnis zum reichen Nachbarn (seiner Frau) erkennen, wird nicht mehr verliebt sein in ihre äussern Verhältnisse der Scheinfülle, sondern wünscht sich von Herzen, wahrhaft reich zu werden für die Ewigkeit, und ist bestrebt, die innern Verhältnisse des bis jetzt als so reich Erschienenen mehr zu beleuchten und zu betrachten als die äussern. Das wird aber dann dem Reichen (seiner Frau) nicht so recht gefallen und sie wird eher Distanz zu wahren beginnen, so sehr auch der Arme seinerseits ehrlich bemüht sein kann, das Licht seiner neu gewonnenen Erkenntnis nur deshalb auf ihr ärmliches Innere zu richten, um es möglichst zu beleben und damit bereichern zu können. Dabei wird er dann allerdings erkennen müssen, besonders wenn seine Liebe zu seinem Erwecker, den er gleich für ewig zu sich eingeladen hat, übermässig gross ist, wie schnell das Verhältnis zum reichen Nachbarn kühler werden kann. Nicht, dass dieser ihm böse wäre, aber enttäuscht ist er allemal, dass er und sein Reichtum nicht mehr so gebraucht werden und nicht mehr so angesehen sind wie bisher. Und der ihm bis dahin noch völlig fremde Reichtum der Wahrheit und der Liebe, nach welchem man mit grosser Kraft und innerer Anstrengung suchen muss, wird darum dem im Äussern immer noch Reichen (der Frau) noch lange fremd verbleiben müssen, weil er bald einmal spürt und erkennt, dass man sich im Lichte dieser Wahrheit aus der Liebe nicht mehr so gut ausnimmt wie im Weltlicht der an sich toten Formen und Gegenstände.
Und dennoch mag sich mit der Zeit das Verhältnis ändern, sofern der Arme beständig bei seinem neuen Reichtume bleibt, sodass er den Reichen nicht mehr braucht. Sicher ist das aber keineswegs! Alle andern Reichen hingegen werden das bleiben, was sie sind. Es sei denn, sie werden von andern überfallen und all ihres Reichtums beraubt. Dann haben sie als selbst Arme dieselbe Chance wie diejenigen, die schon arm zur Welt kamen. Wann aber und wie wird das möglich sein?! Nicht alle Männer wollen dem Vollkommenen dienen. Sie erhöhen daher durch ihren verkehrten Sinn den Wert der Scheinvollkommenheit noch, die ihrerseits viel leichter zu erwerben ist für den, den die Liebe zur Wahrheit nicht daran hindert. Viele gibt es unter den so gearteten Männern, die nutzen die innere Ungeschicklichkeit der von der Natur so reich beschenkten Frauen aus und bringen ihren Reichtum in ihre eigene Gewalt (zu ihrem Nutzen). Solch übervorteilte und ihren ursprünglichen Reichtum verpfändet habende Frauen haben nicht mehr viel von ihrem Reichtum für sich. Immerhin aber können fremde Männer sie erkennen lassen, dass sie noch etwelche Kostbarkeiten haben. Solange auch sind sie nicht allen Reichtums beraubt, damit nicht wirklich arm und dadurch auch kaum umkehrfähig. Werden sie dann aber alt und schwindet damit ihr natürlicher Reichtum und damit auch die Gunst des ihr überdrüssig werdenden Mannes, so können sie dann eher tiefer in ihr Inneres dringen. Sofern sie dann nicht zu sehr dem Vergangenen nachtrauern, finden sie dort, wenn sie angestrengt und ausdauernd suchen, in der Armut und Leere ihres Seins einen kleinen und bescheidenen Garten neu erwachter Liebe, in welchen dann einmal auch der Fremde treten kann, der sie dann neu, und diesmal wahrhaft reich machen wird.
Ferner gibt es – wenn auch nur verschwindend wenige – Frauen, die achten ihres Reichtums nicht, sondern suchen und graben unablässig nach dem innern, bleibenden Reichtum. Durch diese anstrengende Tätigkeit verlieren sie allerdings oft die äussere, scheinbare Kostbarkeit ihrer Fülle, weil das Suchen nach Wahrheit durch die tiefen Schluchten und Klüfte führen muss, die in einer jeden Seele vorhanden sind, was die Kräfte aufzehrt und der dabei aufgewühlte Schmutz sich erst noch gar schnell im Gesicht und auf der Haut bemerkbar macht, sodass der äussere Glanz damit befleckt wird in jenem Masse, in welchem innerlich Schlechtes los gepickelt und ausgekehrt wurde. Diese sind dann selber arm und zählen zu den Armen, die zur rechten Zeit alle von dem Fremden besucht werden. Wohl darum einem jeden, der sich nicht zu sehr vom Äussern gefangen nehmen lässt, sodass er noch frei bleibt, den Fremden einzuladen, wenn er einmal kommt. Wohl auch einem jeden Reichen, der nicht hart ist zu den Armen, der auch dann noch gerne in der Nachbarschaft eines Armen verbleibt, wenn dieser reicher wird. Aber noch besser wäre für ihn, sich seines Reichtums nicht zu achten; ihn lieber ganz dem Armen zu übergeben, so würde er dadurch so arm für sich selber, dass der Fremde durch seine auf diese Weise geöffnete Türe direkten Eingang zu ihm fände.
19.2.1997
nach oben
EINE GROSSE ENTSCHEIDUNG  Die Sklavin eines gar grossen und mächtigen Herrn wurde einmal zu ihrem Herrn gerufen. Das war etwas ungewöhnlich für sie. Denn zeit ihres Lebens war sie seine Sklavin gewesen, also schon von Geburt an. Und in all dieser Zeit hatte sie ihr Herr noch nie rufen lassen. Schon viele Arten von Begegnungen hatte sie mit ihm gehabt, aber rufen hat er sie nie lassen. Auf vielfache andere Arten liess er sie seinen Willen erfahren. Eine lange Zeit sah sie ihn nur während ihrer Arbeit gelegentlich einmal, konnte ihn aber auch manchmal aus der Nähe sehen und ihm sogar zuhören, wenn er mit seinen Dienern sprach, ohne dass sie aber je einmal mit Ihm selber sprechen konnte oder von ihm direkt angesprochen wurde. Dabei aber empfand sie stets eine grosse Liebe zu ihrem Herrn. Sie fühlte es, wie er für alle seine Sklaven, Diener und Bediensteten nur stets das Beste wollte; wie er trotz seiner Machtfülle diese nie missbrauchte, und wie er sogar gegen Widerspenstige eine grosse Langmut hat. Wohl strafte er sie oder liess sie strafen, aber er verwarf sie nicht. Später erlebte es auch sie, dass ihr Herr –wie zu so vielen andern auch – zu ihr selber sich begab und ihr manche Arbeit selber auftrug, nicht ohne sie vorher zu belehren, wie sie die gebotene Arbeit, am besten verrichten konnte. Mit der Zeit führte er auch manches Gespräch mit ihr und über sie, sowie er es früher schon mit andern tat.
Alles musste sie, als Sklavin, zwar tun, aber alles tat sie mit grosser Freude, weil sie ihren Herrn seiner Gerechtigkeit wegen, seiner Milde und grossen Herablassung wegen über alles liebte. Natürlich hatte sie zu solcher Liebe auch allen Grund. Denn ihr Herr liess sie in allem und jedem voll und gut ausbilden. Da gab es kaum eine Beschäftigung, kaum eine weibliche Handarbeit, ja selbst kaum ein Kunstzweig, in welchem er sie nicht hätte tätig werden lassen. In letzter Zeit schickte er sie gar als seine Gesandte ausser Hauses zu Geschäften, was früher nie der Fall war.
Eines Teiles schätzte sie diese jetzige Vorzugsstellung, weil sie spürte, dass sie durch die alleinige Liebe und Fürsorge ihres Herrn zu so einem nützlichen und brauchbaren Menschen hatte werden können und dürfen, aber anderseits fühlte sie sich dann während ihrer Mission fast selber wie eine Herrin, denn die Achtung, die man ihrem Herrn entgegenbrachte, fiel natürlich auch ihr, als seiner Gesandten, zu. Und dieses Gefühl behagte ihr wieder gar nicht so recht. Denn sie sah und verstand sich selber als ein Teil des Hauses ihres Herrn, und wollte darum auch bei ihrem Herrn verweilen – sein Haus voll machen helfen, sich an seiner Macht und Grösse freuen und seiner Vollkommenheit dienen.
Wohl gab es da so manches fremde, aber auch schöne Erlebnis draussen, das ihre Gefühle in einer ganz andern Weise anzusprechen vermochte als die Begegnungen und Vorkommnisse innerhalb des Hauses und Hofes ihres Herrn; und das gefiel ihr auch. Aber es verwirrte sie auch zuweilen, sodass sie nicht mehr so genau wusste, was ihr wohl besser gefiel: das alte Gewohnte oder das neue, noch Unbekannte. Aber sie sah und empfand im Neuen und Unbekannten auch immer eine Gefahr und eine gewisse Isolation; und so wollte und entschied sie sich in ihrem innersten Gemüte immer wieder für den häuslichen Dienst – das heisst: in ihrem Wollen und Wünschen; denn gefragt wurde sie ja nicht.
Nun aber liess der Herr sie zu sich rufen, was noch nie geschehen war. Etwas unsicher, aber durchaus nicht ängstlich begab sie sich zu ihm in seinen Saal und sagte zu ihm: "Herr, du hast mich gerufen". Der Herr aber sass oder stand nicht mitten im Saale, wie es bei Herrschern sonst Brauch und Sitte ist, sondern war ihr, als sie an die Türe pochte, selber entgegengekommen und hatte sie zu einer Sitzgruppe geleitet, wo er sie aufforderte, sich zu setzen, worauf er sich ihr gegenüber setzte. Er sah sie freundlich an und sagte zu ihr: "Bis jetzt habe ich dir alle meine Anordnungen, alle meine Wünsche auch, zur getreuen Ausführung aufgetragen, und du hast dir auch Mühe gegeben, alles so genau, als dir möglich war, zu erfüllen. Heute nun wünschte ich etwas von dir, das ich dir nicht auftrage, sondern um das ich dich ersuchen möchte: Ich möchte in dir erwecken eine Frucht zum Leben. Aber ich kann und will mir nicht in Fremden eine Frucht erwecken. Solange du mir aber eine Sklavin warest, solange auch warest du mir trotz deiner Zuneigung und deiner Liebe zu mir noch immer in einer gewissen Hinsicht fremd, weil doch der äussere Zwang dich bei mir gehalten hat, und fremd ist dir – und teilweise auch mir – dein Wollen, wenn es wirklich einmal völlig frei ist. Darum auch liess ich dich in letzter Zeit als meine Gesandte oftmals in die freie Welt und liess dich Dinge ausführen, die du dann in ihrem weitern Ablauf schon nach deinem eigenen Ermessen vollenden musstest. Dergestalt hast du einmal erleben können, wie es ist, wenigstens teilweise sein eigener Herr und Meister zu sein. Und ich habe dabei gesehen, dass du all die Arbeiten und Missionen gut und richtig ausgeführt hast, sodass du ganz gut selber eine Herrin werden könntest. Aber eben darum verlangt es mich nun, in dir auch eine Frucht zum Leben völlig zu erwecken. Damit wärest du aber dann für ewig mein – durch meine Frucht in dir –, darum du selber dann so etwas wünschen müsstest; denn gegen deinen Willen tue ich dir das nicht, weil ich nicht in Fremde mein Eigentum legen will. Möchtest du aber lieber auch einmal ganz frei sein, so gebe ich dich auch völlig frei, zu tun nach deiner von mir dir zugekommenen Erkenntnis.
Du kannst es freilich nicht in so kurzer Zeit abmessen, was dir eher liegt, und so warte ich auf deine Antwort, bis sie in dir vollkommen ausgereift ist. Darum lasse dir Zeit und überlege es wohl. Wohl kannst du auch als Freie in meiner Nähe sein, aber in meinem Hause nicht. Wir können uns als Freunde wohl treffen und uns besprechen, aber dabei verbleibst du bei deiner Ordnung und deinem Willen und ich in meiner Ordnung und meinem Willen. Als Sklavin aber kannst du in deinem jetzigen Stande nicht mehr verbleiben. Denn nun musst du dich entscheiden, entweder völlig und für bleibend mein Eigentum zu werden oder dein Eigentum zu bleiben."
Diese Worte ihres Herrn trafen die Sklavin sehr. Sie bebte vor der Tragweite ihrer Entscheidung. Nicht wusste sie, wie ihr geschah. Es war, als bräche ihr das Herz. Denn nie zuvor hatte sie ja auch nur die schwächste Möglichkeit gehabt, einmal völlig frei zu sein und sich selber zu bestimmen. Wohl wollte sie das im eigentlichsten Sinne nie; ja die längste Zeit ihres Lebens kamen ihr nicht einmal im Traume solche Gedanken oder sogar Wünsche. Erst in letzter Zeit begann sie das als eine Möglichkeit zu empfinden – wenn sie jeweils für ihren Herrn draussen in der weiten Welt tätig war. Wohl gefiel ihr auch das nicht unbedingt schlecht. Aber sie empfand auch, dass es niemanden gäbe, der ihr so viel entgegenzubringen vermöchte als ihr einstiger und noch jetziger Herr. Was soll sie auch mit all ihrer Freude und Lust, die sie in einem völlig freien Leben empfinden könnte und würde?! Mit wem möchte sie diese dann wohl eher teilen, als mit dem Wertvollsten, das sie je erkennen und empfinden gelernt hatte – mit ihrem Herrn?! Niemandem sonst würde sie es so gerne geben. Immer müsste es ihr versagt sein, ihren Reichtum teilen zu können mit einem, der ihres eigenen Wesens völlig inne wäre.
Und wie sie so dachte und empfindend abwog, da plötzlich merkte sie, dass es ja eigentlich auch ihrem Herrn gerade so ergehen müsse: Nicht kann er dasjenige von ihr nehmen, das er von ihr geschenkt bekommen möchte. Und plötzlich empfand sie stark und tief, dass ihr so mächtig reicher Herr in dieser einen Hinsicht denn doch ein Armer war. Und ihr kam die Erinnerung an alles, was er ihr angedeihen liess, an alles, was sie an seiner Seite in seinem Hause erleben und erfahren durfte, an all ihre Fertigkeiten, die sie alle allein nur aus seiner Fürsorge gewinnen konnte; und sie spürte, wie sie eigentlich im Grunde nur so recht für ihn da war und er für sie.
Daneben bemass sie wohl auch, was das heissen würde: ein wirkliches Eigentum ihres Herrn zu werden, der noch unzählige weitere Früchte in ihr erwecken möchte. Aber wieder empfand sie dann, dass ja sie selber schon eine Frucht all der Bemühungen und all der Sorge ihres Herrn sei, und alles Bangen und Beben verliess sie. Denn sie sah und empfand es, dass vielleicht schon möglich gar vieles dazugehörte, in ihr eine lebendige Frucht zu erwecken, aber dass sie als selber eine Frucht nur grosse Freude, Zuneigung und Friede dabei empfand. Und dieses wieder zu empfinden bei der Werdung einer Frucht aus ihr, und das im Verbande mit ihrem Liebsten, weil Vollkommensten – ihrem Herrn – und das erst noch zu des Herrn eigenster, grösster Freude, die ja auch für sie selber die grösste Freude und Genugtuung bedeutete, das bewegte sie tief, und sie blickte ihren Herrn an und gab sich ihm hin zu seinem Eigentum.
6.2.1997
nach oben
DIE BEIDEN BÄUME IM OBSTGARTEN DES VATERS  In einem Obstgarten standen im hintersten Teil, auf einer kleinen Terrasse über dem Tale, zwei kleine, eher strauchartige Obstbäume. In ihrer Grösse waren sie sich täuschend ähnlich, auch darin, dass beide sozusagen keinen Stamm hatten, sondern ihre Äste sich mehr – den Sträuchern gleich – vom Boden her verzweigten. Darin kamen sie den Kindern des Obstgartenbesitzers sehr gelegen, weil sie von diesen beiden ohne Mühe und vor allem ohne Leiter, welche die jüngeren unter ihnen noch nicht besteigen durften, Früchte bekommen konnten.
Und dennoch war ein grosser Unterschied der beiden, sowohl in der Ordnung oder Unordnung ihrer Zweige und der Harmonie ihrer Verhältnisse zueinander, als auch bei den Früchten, welche beim einen, harmonisch gestalteten, stets voll, saftig und süss waren, während sie beim anderen stets durchmengt waren mit steinichten und holzfaserigen, sauren und dadurch ungeniessbaren Teilen. Höchstens ein Fünftel war einigermassen geniessbar, alle andern ungeniessbar und wertlos.
Einmal fragte nun der eben zwölfjährig gewordene Sohn seinen Vater, weshalb denn auf diesem bevorzugten Platze zwei so verschiedene Bäume stehen, die sich zwar äusserlich so gleichen und dennoch aber einer davon praktisch wertlos sei, während der andere die besten Früchte habe.
Da erklärte ihm sein Vater Folgendes, indem er ihm erzählte, dass schon sein eigener Vater diese beiden "ungleichen Zwillinge" – wie er sie nannte – gepflanzt habe. Dabei habe er eigentlich zwei ganz gleiche Bäume gepflanzt, habe sie dann auch zu ein und demselben Zeitpunkt veredelt und sie auch in aller übrigen Pflege, wie Schnitt, Düngung und Wässerung gleich gehalten.
"Der Grund aber, weshalb zwei so verschiedene Typen daraus geworden sind", so fuhr der Vater in seiner Rede fort, "liegt in der Eigenart oder dem Wesen der beiden Wildlinge oder der Unterlage, wie man die unveredelten Bäumchen manchmal nennt.
Der eine von ihnen hatte sozusagen seine Freude an den aufgepfropften Ästen, trieb alle seine Kraft nur stets in diese und achtete seines eigenen Stammes wohl kaum, während umgekehrt der andere vor allem auf seinen Stamm achtete, die aufgepfropften Äste aber – als seinem eigenen Wesen fremd – nur ganz schlecht und soviel wie nur gezwungenermassen ernährte. Etwa so, wie es auch bei den Menschen der Fall sein kann, wo einerseits eine arme Amme sich voll Liebe dem ihr anvertrauten Kinde hingeben kann, während andererseits eine adelige Stiefmutter die Kinder ihres Mannes unter Umständen nur dazu missbraucht, ihre eigene Unfruchtbarkeit – sowohl des Gemütes als auch ihres Leibes – zu verbergen, um ihr Ansehen zu vergrössern. Das Stammvolumen des letzteren Baumes vergrösserte sich durch seine eigenliebige Wuchsart zwar sehr, aber seine Krone war dafür schwach und arm an Zweigen, und wohl noch ärmer an Früchten. Das ging so mehrere Jahre fort, wobei beide auf ihre eigene Art gediehen. Der eine in seiner ihm aufgepfropften Krone, der andere in seinem eigenen Stamme.
Nun kam aber einmal eine strenge Prüfung über beide in Form eines kalten und äusserst schneereichen Winters, nach welchem dann schon deutlich wurde, was für Folgen der Wesensunterschied zwischen den beiden hatte. Denn die grosse Last des reichlich gefallenen Schnees prüfte beide und liess an beiden ihre schwache Seite offenbar werden, und zwar noch offensichtlicher, als es der bisherige, ungleiche Wuchs schon zeigte. Denn bei beiden wurde ihre schwache Seite so sehr mitgenommen, dass sie in ihrem Wesen fast zerstört worden wäre.
Des Schwachstämmigen Krone lag am Boden auf, weil sich der Stamm unter der Last des Schnees so stark krümmte, dass er beinahe in eine waagrechte Richtung kam, sodass sein Kronengrund auf dem ansteigenden Terrain aufzuliegen kam. Des Starkstämmigen Krone aber war fast vollständig zerstört. An manchen Orten brachen die gepfropften Äste bei der Pfropfstelle ab, weil dieser Stammbewusste Baum alle seine Kräfte möglichst ferne von der ihm verhassten Pfropfstelle hielt. Jene wenigen Äste aber, die nicht in ihrem Grunde oder bei ihrer Pfropfstelle gebrochen und damit zerstört wurden, brachen oberhalb dieser dennoch entzwei.
Der darauf folgende, nasse Frühling aber brachte der Krone des Schwach-stämmigen die Gelegenheit, in die stets feuchte Erde neue Wurzeln zu schlagen, während welcher Zeit sie aber dennoch durch den zwar gebogenen, aber zum grösseren Teil noch unversehrten Stamm weiterernährt wurde. Dem Starkstämmigen aber brachte dieselbe Frühjahrsfeuchtigkeit nur Pilze in die Wunden der gebrochenen Kronenbasis und damit dann auch Krankheit und Siechtum von daher in den stolzen Stamm herab.
Und so kam es, dass nach wenigen Jahren der Schwachstämmige seine ehemals schön und harmonisch geformte Krone am neuen Auflageort wieder aufrichtete und neu ordnete und ihr durch kräftige Wurzeln eine zusätzliche Nahrung verschaffte, während des Starkstämmigen Stamm von Pilzen so sehr zerfressen wurde, dass er zwar langsam aber doch schon bald sehr merklich zu zerfallen begann, sodass das Baumwesen in aller Eile und aus förmlicher Lebensangst geschwinde noch einige Wildtriebe aus der Stammbasis oder – wie man ebenfalls sagen kann – aus dem Wurzelhals heraus zu treiben begann.
Als mein Vater das sah, reute ihn zwar die Mühe mit dem einen der beiden, aber er beschloss dennoch, die stärkeren Wurzelhalsausschläge erneut mit edlem, gutem Reis zu pfropfen. Zwar gelang die Pfropfung – wie alle Arbeit meines Vaters stets gelang –, aber in den stärkern Trieben wurde bald wieder die Freude am Stamm dadurch erkenntlich, dass sich alle Kraft nur in die Erweiterung der neuen Pseudostammgefässe ergoss und dadurch diese erneuten Pfropfreiser erwürgt und ausgehungert wurden, und nur in den schwächern der gepfropften Ausschläge war die Freude am Stamm soweit geschwächt, dass die Pfropfreiser genügend Nahrung erhielten. Dafür aber wurden diese Ausschläge selber schon von der Wurzel her schlechter versorgt, als jene stärkern, welche in ihrer Freude am eigenen Stamm die Pfropfreiser erwürgt hatten und eigene, wilde an ihrer Stelle aus den stammähnlichen Ästen trieben.
Mittlerweile aber war der eigentliche Stamm dieses Baumes schon lange ganz verfault, während der am Boden aufliegende Stamm des andern von guter Erde bereits völlig zugedeckt war, sodass nun beide Bäume – wie du siehst – so aussehen, als ob es Sträucher wären. In Wirklichkeit aber ist der eine wohl noch ein richtiger Baum, wenn auch sein Stamm nicht mehr sichtbar ist, der andere aber ist als Strauch nichts anderes als ein zerstörter Baum, wenngleich er nun das Aussehen eines trotzigen und wirren Strauches hat.
Beide aber sind in ihrer Art – sich äusserlich als Buschform gleichend – so verschieden und so leicht sogar für euch Kinder zugänglich, dass im wahrsten Sinne des Wortes sogar die kleinsten Kinder zu erkennen vermögen, welchen Wert ein jeder der beiden hat.
Zwar ist die Form der Früchte bei beiden ziemlich ähnlich, aber wenn du sie versuchst und von ihnen dabei einen Bissen nehmen möchtest, so verspürst du bald das Herbe, Zusammenziehende und Bittere, das in der Frucht des einen stets verborgen liegt, während du in der Frucht des anderen nichts mehr von der Bitterkeit des ursprünglich gleichen Wildlings verspürst. –
So, nun kennst du die Geschichte der beiden Bäume und damit auch den Grund ihrer derzeitigen Verschiedenheit im Aussehen der Krone und noch mehr in Inhalt und Wesen ihrer Früchte. Es hat der eine – stammfreudige – wohl noch eine beinahe straffere Ordnung in seinen unbeugsamen Ästen, aber er vermittelt in dieser Ordnung eher Kälte, während der andere mit seien leicht gewundenen Ästen ein warmes Gefühl im Betrachter aufkommen lässt. Und merkwürdigerweise empfindet man bei ihm dennoch eher sein Bestreben, dem Lichte entgegen zu wachsen, obwohl doch seine Äste nicht so geradewegs himmelwärts streben wie beim andern, bei welchem darin eher der kalte Starrsinn hervorleuchtet, als das innerste Bestreben nach dem Lichte. Es hat denn auch der Edle durch die nicht so starre Richtung seiner Äste eine breitere Krone, welche dadurch dem von oben her kommenden Lichte mehr Einlass gewährt, als das starre Astgewirr des andern. Fast könnte man sagen, der eine suche nur das Licht und öffnet ihm deshalb seine Krone, während der andere eher die Höhe sucht – wo zwar das Licht herkommt; aber suchete er das Licht wirklich, so müsste er sich ihm öffnen. So aber sucht er nicht das Licht in der Höhe, sondern die Höhe des Lichtes. Und das ist es wohl, was ihn unfruchtbar macht – vor allem unfruchtbar zur Empfindung, dass die ihm aufgepfropften Reiser besser wären als seine eigenen, eben darum, weil sie den Drang nach dem Lichte in sich tragen wie man es am andern Baume sieht, der ganz in seinen Pfropfreisern aufgegangen ist; und das so sehr, dass sein einstmaliger eigener Stamm, dem oberflächlichen Betrachter nicht mehr sichtbar, dabei aber dennoch wohl erhalten ist, während der Eigenstammliebige seinen wirklichen Stamm schon längst verloren hat und trotzdem sein Wesen in seinen neu gebildeten Ästen starr und uneinsichtig, sich selbst verratend, dem Betrachter zur Schau stellt.
Weisst du nun aber auch etwas mit dieser Geschichte anzufangen", fragte der Vater abschliessend sein Kind. Und dieses, durch die längere Geschichte etwas in Eifer geraten, antwortete: "Ich weiss zwar im Momente nichts mit der Geschichte dieser beiden Bäume anzufangen, aber ich verspüre eine grosse Freude darüber und finde, dass darin die Wahrheit liegt, obwohl sie doch sicher und bestimmt in allem liegt, was du mir sagst. Aber zumeist empfinde ich es dennoch nicht als eine Wahrheit, obwohl ich mir sicher bin und fest überzeugt bin, dass alles von dir Gesagte eine Wahrheit ist. Warum empfinde ich das wohl so stark in mir, dass das eine Wahrheit ist, und weshalb erfreut und erfrischt mich diese Wahrheit derart, während viele andere aus deinem Munde mich nicht mehr oder tiefer im Gemüt berühren, als dass ich sie einfach zur Kenntnis nehme – zwar wohl auch dankbar, aber nicht mit solcher Freude?" –
"Das ist schon recht so, und es freut mich, dass du so empfindest", ergreift der Vater von neuem das Wort. "Denn das hat seinen tiefen Grund: Diese Geschichte fasst in sich mehr als nur das Leben dieser beiden Bäume. Sie erfasst auch einen Vorgang, der sich in jedem Menschen abspielt und der deshalb eigentlich ein jeder auch kennen oder doch zumindest spüren müsste. Wenn er ihn spürt, so empfindet er genauso wie du jetzt, wenn er auch nicht weiss, weshalb. Aber dieses immer wieder auftretende Verspüren belebt die Seele und nötigt sie durch den Druck, den sie loswerden möchte, in ihren Geist einzugehen, der durch diesen Druck und die Bewegung der Seele zu erwachen beginnt.
Siehe, jeder Mensch gleicht in seinem Leibe und durch ihn auch in seiner Seele einem Wildling, der begierig ist, nur sich selbst zu vergrössern, möglichst über alle andern hinaus. Dabei gibt es unflätige Seelen, denen es leicht anzukennen ist, dass sie nur sich selber dienen. Es sind jene, welche in allem und jedem zu faul sind, etwas zu tun, ausser in dem Punkte nicht, dass sie nämlich möglichst für alle sichtbar im Lichte der Bewunderung und Anerkennung durch die andern glänzen möchten. Sie gleichen in ihrem Bestreben jenen Pflanzen, welche für die Veredelung ihrer Gestalt und ihres Wesens nichts aufbringen wollen, sondern nur möglichst ein sonniges Plätzchen geniessen wollen, wie es Winden, Wicken, Waldreben und Efeu tun, die dabei bedenkenlos andere wohlgeordnete Pflanzen überwuchern und sie dabei erdrücken, wie es Winden tun, oder auch ersticken, wie es das Efeu den Bäumen tut. Sind sie etwas anderer Natur, so erschleichen sie sich zwar nicht einen Halt aus der Kraft von andern, aber dennoch ist ihnen jede Lage bald einmal recht, wenn sie nur zur Erscheinung vor andern gelangen können.
Solche Seelen oder Menschen gleichen dem Dorngestrüpp, welches seine Zweige haltlos und wirr sogar über seine eigenen vorher gebildeten legt und sich selber damit teilweise erstickt. Solche Sträucher sind dann also hohl und leer in ihrem Innern, wachsen zumeist auch nur auf Steinen und Geröll und beherbergen in ihrem Dickicht vorzugsweise Schlangennester unter ihren oft bedornten Zweigen.
So geht die Artung weiter fort. Stets findest du eine noch etwas bessere Wesensartung, bis du dann zu solchen kommst, die ein gerades und edles Aussehen haben und bei welchen du dann leicht anzunehmen geneigt bist, dass es edle Wesen mit guten Zügen sind. Sie können recht schön, ja sogar anmutig sein und machen oftmals sogar einen erhebenden Eindruck auf dein Gemüt. Diese könntest du mit Bäumen und Sträuchern des Waldes und des Feldes vergleichen. Und diese können dir und andern sogar dienen, wie es die Bäume des Waldes tun, die dich vor den Unbilden der Witterung schützen, also vor zu grosser Sonnenglut, vor Sturm und Wind, und die sogar in ihrer Vielzahl das Wasser im Boden zu sammeln und zu halten vermögen, welches dann weiter unterhalb ihres Standes als muntere Quelle an die Oberfläche sprudelt und als Bächlein wie ein helles Band die Fluren durchzieht und ihnen durch sein Wasser und seine Feuchtigkeit Fruchtbarkeit verleiht.
So nützlich solche Menschenwesen oder in der Entsprechung auch die Bäume sind, sie bilden das Gute im Menschen nicht, wohl aber vermögen sie den äussern Menschen zu schützen. Es sind vor allem Erzieher und mehr oder weniger gute Mütter, die alle die Aussenform und die Aussenerkenntnisse heran reifender Menschen bilden helfen, aber nicht den eigentlichen Menschen, der im Innern als Geist wirksam ist, nähren und wachsen machen können. Das kann nur die Liebe Gottes! Und diese liegt im Äussern des Menschen nicht. – Sie ist also nicht mehr des Menschen Anteil, denn sie wurde durch Eigenmächtigkeit und Starrsinn schon im ersten Menschen – dem Adam – durch seine Handlungsweise zerstört. Der heutige Mensch ist zwar wohl ein Aufnahmegefäss dieser Liebe geblieben, aber er muss eine solche Liebe zuerst empfangen, bevor er sie ausbilden kann und mit der Zeit so in sie hineinwachsen kann, dass am Ende der ganze Mensch zu einem Ebenbilde Gottes wird.
Und eben weil dieses Liebeleben, oder die gute Ordnung der Liebe, nicht mehr im natürlichen Menschen vorhanden ist, so muss sie ihm von aussen auf- oder eingepfropft werden durch gute Lehre nach dem Worte Gottes.
Wenn nun aber ein Mensch trotz dieser Lehre seine ureigentlichsten Wünsche und Vorstellungen, als das Seine, das nicht in der Ordnung Gottes liegt, mehr liebt als das göttliche Bild, so gestaltet er sich ohne es extra zu wollen eben nach seiner Unordnung, anstatt nach der Ordnung und dem Lichte der Erkenntnis Gottes in ihm. Und solche sind es, die den Pfropfreis der guten Lehre Gottes in sich erwürgen, oft ohne es eigentlich zu wollen.
Ich will dir dafür zuerst ein allgemeines Beispiel geben. Betrachte einmal die Liebe einer Mutter, wenn sie so ganz ihrem Säugling zugeneigt ist. Siehe, diese Liebe nimmt alles auf sich, um nur ja dem geliebten Säugling alles nur erdenklich Mögliche zukommen zu lassen. Manche Nacht durchwacht eine solche Mutter in Sorge um ihr Kind. Manchen Bissen spart sie sich von ihrem eigenen Munde ab, nur um ihn ihrem geliebten Kinde zukommen zu lassen. Allen Dreck seiner Windeln putzt sie tausend und abertausend Male. Immer denkt sie an ihr Kind, fragt sich, wo es ist und ob es ihm wohl ergehe.
Wenn du das alles so betrachtest, so könntest du doch wohl der Meinung werden, dass eine solche Mutter geradewegs nur die besten Früchte für das Wachstum des innern Menschen hervorbringen müsste und dass ihre Liebe ganz der göttlichen Ordnung gemäss sei, welche doch Liebe für den Nächsten fordert. Wie weit gefehlt aber diese deine Meinung ist, könntest du schon sehr frühe feststellen. Dann nämlich, wenn du zu merken begännest, dass die Mutter denn doch manches Mal die Ordnung dem Wesen des Kindes anzupassen beginnt, anstatt das Kind an die göttliche Ordnung. Beispielsweise dann, wenn sich das Jüngste etwas vergisst und dabei ein Spielzeug eines Grösseren ergreift, welches dabei sogar kaputt geht. Nun entschuldigt eine solche Mutter die Handlung mit der Unwissenheit ihres Jüngsten und bedenkt dabei zuwenig oder noch öfters überhaupt nicht, dass auch der Jüngste so früh als möglich lernen muss, dass andere ebenso wie er selbst eine Freude an und eine Liebe zu dem Ihren haben, und diese Freude und Liebe nicht gestört werden darf. Würde sie das bedenken, so würde sie ihren Jüngsten nicht entschuldigen, sondern ihm klar machen, was er falsch gemacht und wo er gefehlt habe. Sie würde, wenn es schon öfters vorgekommen wäre, entweder des Beispiels wegen eine Lieblingsspielsache ihres Jüngsten wegnehmen, um ihn den Schmerz des Verlustes spüren zu lassen, den andern, Grösseren aber würde sie im Stillen schon auch erklären, dass der Jüngste ein solches Verständnis eben erst erwerben müsse durch eigene Erfahrung, wie gerade jetzt, da sie ihm eine Sache weggenommen habe, sowie durch die Übung in der Selbstbeschränkung zugunsten der Anderen.
Siehe, das tut aber eine bloss natürliche Mutter kaum, sondern sie lässt den aufkeimenden Wuchersinn im Wildlinge ihres Kindes gewähren und verrät damit, dass ihre Liebe nicht so wohlgeordnet und nutzbringend ist, wie sie dem Betrachter anfänglich erscheinen möchte, weil sie mehr am Wildlinge als an der guten, allen dienenden Ordnung hängt. Später aber, wenn dann der Sohn oder die Tochter sich der Mutter zu verweigern beginnt, wird sie traurig, enttäuscht und oft gar verwirrt – und das zeigt wieder, dass sie alle Mühe, die sie an ihr Kind verwendet hatte, eigentlich zu ihrer eigenen Bereicherung und nicht zur Bereicherung des Kindes auf sich genommen hatte. Denn hätte sie es nur zur Bereicherung des Kindes getan, so würde das Kind sich ihr kaum verweigern, und würde es dies trotzdem, weil es eigensinnig ist, so würde sie sich sagen können – wie sie es zu jeder Stunde ihrer Erziehung hätte sagen müssen: Was ich dir gebe, gebe ich dir zu eigen, damit du aus der Fülle der von mir erworbenen Erkenntnis nach deinem Sinne leben kannst, damit du nach deiner Art in die Seligkeit Gottes eingehen kannst – oder notfalls auch in deine eigene Unordnung, damit du hernach besser und freier den Wert der Gottesordnung daraus erkennen kannst.
Siehe, so sieht manches nach Liebe und guter Ordnung aus, wo noch sehr viel Selbstliebe steckt, und das sind die scheinbar harmonisch schönen Gestalten unter den Menschen wie unter den Bäumen, die zwar nützlich sind, den äussern Menschen zu schützen und auch zu fördern, die aber den innern Menschen, also den Geist verhungern lassen und die Liebe durch falsche Ordnung – auf sich selbst gerichtet – verdorren und un-fruchtbar werden lassen.
Aber du sollst nun auch noch einige spezielle Beispiele dafür erhalten, wie allgemein und Vielem entsprechend die Wahrheit in der Geschichte der beiden Bäume in unserem Baumgarten ist:
Siehe, wenn wir zusammen eine schöne Musik hören oder ich euch dann und wann eine schöne Geschichte erzähle, so habt ihr Kinder alle daran eine Freude. Und dennoch bemerke ich immer wieder, wie einige aus euch sich nachher gestärkt und sozusagen wie frisch geputzt vorkommen, während nur zwei aus euch vielen zwar ebenso andachtsvoll, aber eher wehmütig davongehen. Kennst du davon den Grund?"
Der Knabe, der sich getroffen vorkam, wurde durch die Frage seines Vaters etwas verwirrt, weil er glaubte, dass seine Wehmütigkeit den Vater jeweils etwas enttäuscht haben mochte, während die Fröhlichkeit und Aufgestelltheit der übrigen bei solchen Gelegenheiten ihn wohl jeweils erfreut haben mochte. Und so antwortete er nun etwas gedämpft, dass er den Grund nicht kenne.
Der Vater – den Vorgang in seinem Kinde wohl gut verspürend – legte seine Hand auf die Schulter seines Kindes und sagte zu ihm: "Der Grund liegt genau im Wesensunterschiede bei euch Kindern, wie du ihn bei den beiden Bäumen unseres Gartens nun kennen gelernt hast! Jede schöne Melodie und jede Geschichte, die einen Wahrheitsgehalt hat, ist – erkannt oder unerkannt – ein neues Pfropfreis auf euren Wildlingsstamm.
Der danach Aufgestellte sieht darin eine Verlängerung seines Stammes und sieht eben dadurch seinen Stamm bestätigt, weil er das Eigenliebige in seinem Stamme noch nicht erkennt und ihn deshalb in seiner Geradheit schön und erhaben findet, wie eine Mutter ihr Tun, und er beschäftigt sich noch mehr damit, das Gute des Reises mit seinem Stamme zu vereinen, wodurch aber das Reis seine Kraft verliert, ohne dass diese dem Stamm zugute käme, denn die Bereicherung des Stammes wäre ja eben eine Früchte tragende Krone. Der Wehmütige aber erkennt darin nur die Vorzüglichkeit des Reises oder der Gedanken in der schönen Geschichte und dadurch auch die Minderwertigkeit seines eigenen Stammes; er geht wirklich in das Pfropfreis ein und wird, wenn er in dessen Lichte steht, noch mehr enttäuscht über sein eigenes Wesen. Durch dieses gedankliche Wohnen im Reis überträgt er aber seine ursprüngliche Kraft vom Stamme in das Reis und wächst mit diesem zusammen fort und wird dann in diesem gross, während der andere sein überkommenes Reis in seine eigene Kraft überzuführen bestrebt ist – sie damit bereichern wollend – das Edle darin damit aber erstickte." –
"Das verstehe ich noch nicht ganz!" unterbrach der Sohn seinen Vater. "Also", fuhr dieser fort, "wenn ein Mensch eine schöne Musik hört und ihm diese gefällt und er auch wohl weiss, dass unter den Gebildeteren diese Musik als edel gilt, so empfängt er durch das Erkennen, dass ihm diese Musik gefällt, die fälschliche Bestätigung, dass auch er selber edel sei, und er sieht seinen eigenen Adel in der Musik und in der Liebe zu dieser Musik als bestätigt. Das richtet ihn auf. In der Wahrheit verhält es sich aber nicht so, sondern ganz anders:
Denn wie das Auge eines Menschen selbst kein Licht hat, aber solange es gesund ist, wohl die Fähigkeit hat, das Licht aufzunehmen, so hat auch der natürliche Leib, wie anfänglich auch die Seele des Menschen weder Edles noch Gutes in sich, sondern nur die Fähigkeit, solches zu erkennen und damit in sich aufzunehmen. Was geschähe nun aber mit einem Menschen, der die Narrheit beginge, anzunehmen, dass sein Auge selber Licht sei. Er müsste am Ende wohl das Licht für einen Schatten halten und den Schatten für Licht. Warum denn? Weil er doch erkennen müsste, dass dann, wenn er seine Augen verschlossen hält, er nur schwarz oder Nacht sieht. Wenn er aber der Meinung ist, dass sein Auge Licht sei, so muss er doch das Schwarze, das er bei geschlossenen Augen empfindet, für Licht halten. Also wird er an einem Bilde, welches sich stets nur aus hellem Licht und schwarzem Schatten ergibt, die schwarzen Schatten als das seine – und somit als Licht – erkennen, und das seinem geschlossenen Auge fremde Licht dafür als Schatten. Zwar wird jedes Bild nur durch Licht und Schatten, oder durch die Differenzierung des Lichtes ersichtlich, aber der Grund von Licht und Schatten ist das Licht und nicht der Schatten, obwohl man natürlich auch sagen könnte, ein Bild wird durch die Differenzierung des Schattens ersichtlich. Weil aber erst das Licht – als Gegensatz zum Schatten – diesen als solchen erkennen lässt, so bleibt denn am Ende doch das Licht Urheber aller Erkenntnis. Das kann aber einen Irrsinnigen nicht davon abhalten, den natürlichen Zustand seines Auges als Licht zu verstehen und das wirkliche Licht, als Gegensatz zu ihm selbst, als Schatten. Dabei sieht er dann das wirkliche Licht ebenfalls als sein Eigentum an, da es – seiner Meinung nach – erst durch den Gegensatz seiner Nacht, die er aber Licht nennt, als solches in Erscheinung tritt.
Dasselbe geschieht in der Erkenntnissphäre einer verwirrten Seele, die ob des Sich-freuen-Könnens an etwas Schönem der Meinung wird, dass sie selber bereits schön sei. Dabei ist es doch so, dass unter vielem Schönem das Wort "schön" gar nicht entstehen könnte, sondern nur dann, wenn Schönes und Unschönes gemischt vor dem Betrachter liegt. Ebenso merkt ja ein Gesättigter seine Sattheit nicht anders, als durch das Fehlen von Hunger. Hätte er nie Hunger, so würde er die Sättigung nicht eigentlich empfinden. Auch ein unbegrenzt Starker würde seine Stärke nie empfinden, denn erst eine Begrenzung seiner Stärke durch etwas Stärkeres würde ihm durch die Begrenzung seiner Kraft die Empfindung der eigenen Kraft und Stärke geben, die er als eine Schwäche gegenüber dem noch Stärkeren empfinden würde. Würde aber einer seine Sattheit, die er fühlt, und seine Stärke, die er erfährt, auf seine eigene Fülle und seine eigene Kraft zurückführen, so würde er sich doch offenbar selbst betrügen. Denn die Fülle ist der Gegensatz seiner eigenen Leerheit, die er als Hunger fühlte, und die Kraft ist der Gegensatz seiner eigenen Schwäche, über welche hinaus er nicht stark ist.
Der Wehmütige aber empfindet der Wirklichkeit nach richtig – daher kommt ja auch seine Wehmut. Er sieht, hört und empfindet das Schöne zwar mit grosser Freude, aber er ersieht es aus seiner Armut und der Unschönheit seines Wesens heraus, durch welchen Umstand es ihm noch schöner und werter vorkommt, sodass er sich trotz seiner Wehmut, oder eben seiner Wehmut wegen, noch vermehrt in das Schöne hinein versenkt, sein eigenes Unschönes dabei für Augenblicke verlassen müssend. Und eben dieses bewirkt durch die zeitliche Häufigkeit eines solchen Vorganges ein vermehrtes Einleben ins Schöne und ein gewisses Ableben des eigenen Unschönen. Bei diesem Vorgang ist die Armut das Gefäss des Reichtums, wie der Hunger das Gefäss der Sättigung darstellt. Und eben deshalb ist die Demut eine der ersten Forderungen Gottes an den Menschen, weil die Demut ihn erst geeignet dafür macht, alles Gute und Schöne von seinem himmlischen Vater anzunehmen.
Alle Demütigen, die ihre eigene Schuld und Armut stets vor Augen haben, sind am besten geeignet, in der Fülle allen Reichtums zuzunehmen. Alle aber, die für ihre eigene Armut eine Entschuldigung haben und dadurch den Druck ihrer Nichtigkeit nicht in demselben Masse als Schuld verspüren, wie die Demütigen (und Wahrheitshungrigen), werden auch nie so voll und satt, weil ja die Entschuldigung den Druck der Leere benimmt und damit aber auch die Freude und den Drang zur Sättigung mindert.
Wer bei einer Zurechtweisung sagt: 'Das habe ich nicht gewusst', der wird kaum je zum Rechten kommen. Wer aber seine Armut fühlt, und denkt: 'Wie arm muss ich doch sein, dass mir das nicht schon lange selber aufgefallen ist oder in den Sinn gekommen war', der beklagt seine Armut bitterlich und findet in der Freude über das Dargebotene der Zurechtweisung noch viele weitere Punkte in seiner Armut, die er mit ein und derselben Zurechtweisung ebenfalls noch füllen kann. Der sich Entschuldigende hingegen erkennt durch die Entschuldigung seiner Armut niemals einen Weg, wie er ohne Zurechtweisung zu der Sache hätte kommen können. Denn er ist es ja, der durch die Entschuldigung die Unmöglichkeit der eigenen Auffindung sich selber wie den andern vortäuscht und dadurch seine Schwäche, nicht selber finden zu können, verdeckt. Er ist es deshalb auch, der nur durch die ihm über alles verhassten Zurechtweisungen weiterkommt, während der andere durch die Erkenntnis seiner Armut bei der nur einen Zurechtweisung unzählige andere Armutspunkte in sich ersieht und damit auch Möglichkeiten findet, in andern Punkten weiterzukommen, sodass er selten mehr eine Zurechtweisung braucht, obwohl doch gerade ihn eine solche nicht stört, indem er sie – trotz dem Unangenehmen jeder Zurechtweisung – willkommen heisst.
Und nun siehe noch Folgendes: Als ich dich vor einigen Wochen einmal ordentlich zurechtweisen musste, gingest du tränenden Auges von mir. Als ich aber kurz zuvor deine Schwester zurechtgewiesen hatte, ging sie in ihr Zimmer und schloss sich ein. 'Wie unendlich tief musste ihr diese Zurechtweisung doch gegangen sein', so könnte man denken. Und es war ihr auch tief gegangen – tief in ihren vermeintlich schönen Stamm. Sie sah sich von mir missverstanden; dabei hat sie selber aber mich nie und nimmer der Wahrheit nach verstanden, sonst hätte sie gemerkt, dass ich mit meiner Zurechtweisung nicht ihr – in ihrem bisherigen, eitlen Wesen – helfen wollte oder musste (denn das macht sie ohnehin selber mehr, als es gut ist), sondern ich musste ihrer von Gott ihr zugedachten Form nur gedenken und ihr diese durch die Zurechtweisung als ein Edelreis aufpfropfen – oder: wieder in Erinnerung bringen.
Du hingegen erkanntest den Sinn meiner Zurechtweisung und weintest, weil du in ihr das Gute und damit das in dir Schlechte, das dem geliebten Guten zuwider ist, entdecktest, und weintest zum andern auch, weil du in meiner Zurechtweisung meine Sorgfalt und dadurch meine Zuneigung zu der von dir selber erstrebten neuen Schönheit – dem neuen Pfropfreis –erkanntest, und ebenso meine bis dahin offenbar vergeblich sich bemühende Liebe und Sorge darum. Aber eben deshalb hattest du auch bald und leicht einen rechten Trost in der sofort an- und aufgenommenen neuen Form gefunden, wohl wissend, dass mich ja die erneute Belebung der neuen, guten Form in dir durch deine An- und Aufnahme sicherlich für alle Mühe entschädigt und ich also an dir nicht länger leiden muss.
Und siehe, das alles geht lebendig in dir vor. Und deshalb auch vermutetest du in der Geschichte der beiden Bäume eine grosse Wahrheit, die deine Schwester nie vermuten würde, die sie aber mit hoch erhobenem Kopf hinweg laufen liesse, hätte sie diese Erklärung bis vor das letzte nun Behandelte gehört. Hätte sie allerdings auch dieses Letzte gehört, so wäre sie angeekelt davongegangen. Denn bis dorthin hätte sie ja alles als in sich gelöst seiend angenommen, nur das letzte hätte ein zu grelles Licht auf sie geworfen und ihr wahres Wesen zu sehr verraten, sodass dieses sie so lange gedrückt hätte, bis sie dafür eine annehmbare Entschuldigung gefunden hätte. Was aber hätte ihr diese genützt? Siehe, sie ist schon jetzt voll auf dem Wege, eine von mir dir vorher geschilderte Mutter zu werden. Aber sie selber hätte das niemals gemerkt, indem sie an sich selbst keine innern Fehler findet, sondern äusserlich erscheinliche nur, die auch den andern auffallen könnten. Mit dem letzten Hinweis aber wäre sie nicht um die Wahrheit ihres "Stamm"-Wesens herumgekommen.
Begreifst du nun schon etwas davon, weshalb die Welt auch bei den vermeintlich guten Menschen stets ein Jammertal bleibt? Weil sie stets um sich selber jammern, anstatt um das von ihnen selbst versäumte Gute. Das ist eben die weltweite Wahrheit, welche in der Geschichte dieser beiden Bäume ruht."
Was mancher Erwachsene nicht fassen kann, das fasste in diesem Moment der Knabe. Wohl konnte er es nicht so detailliert, wie es sein Vater gab, fassen, da ihm die nötige eigene Erfahrung noch fehlte und damit die längere Zeit notwendige Auseinandersetzung in seinem Intellekt. Aber viel tiefer und wahrer fasste er es in seinem Gemüt, dessen weiche Empfindungsbereitschaft noch unverdorben war und durch die Liebe zum Guten auch noch rein, sodass sein Gefühlsbild ungemein stark und auch äusserst präzise die kleinsten Regungen bei solchen Vorgängen zu erfassen vermochte. Deshalb auch schwieg er nun auf die letzte Frage seines Vaters. Nicht, dass er ihm keine Antwort schuldig zu sein glaubte, sondern dass er durch die volle Beschäftigung mit dem ihm Offenbarten möglichst bald zu einer positiven – also bejahenden – Antwort kommen könne. Das hatte dann für sein ferneres Leben jene Wirkung, dass das nun lebendige Erkennen in seinem lebendigen Gefühl von selbst stets weiter zu wachsen begann und damit all das in diesem Moment noch nicht Erkannte zu erkennen vermochte, und zwar ohne weitere Belehrung, sondern einfach durch ein Erfühlen der Situationen, wie sie sich mannigfach zwischen den Menschen ergeben.
Er begann also erst viel später an dieser ihm von seinem Vater offenbarten Entsprechung anzuknüpfen, wenn er zum Beispiel erkannte, dass viele Menschen, welche im Beruf – oder auch im Hobby – bloss eine Selbstbestätigung suchen und deshalb weder im einen noch im andern etwas anzunehmen geneigt sind, das wie ein gütiges Almosen gewertet werden könnte (also ein Pfropfreis des Guten auf das Schlechte), notgedrungen in ihrer Tätigkeit unerfüllt bleiben und am Ende sich von dieser distanzieren – dass alle diese Menschen nichts anderes darstellen als die Stamm-bewussten, die just durch ihr Verhalten ihren eigenen Stamm zerstören und nachher genötigt sind, Nebenstämme zu bilden.
Er begann auch zu begreifen, dass eben diese Zerstörung durch das Nichtannehmen der Pfropfreiser einen Gärtner voraussetzt, dass also damit das Wirken eines Vaters im Himmel für Einsichtsvolle mehr als klar wird. Denn bei allen Tieren ist die ihnen notwendige Vollendung auf ihrer Stufe ohne äussere Schule möglich, wie das Wachsen der Bäume im Walde ohne Pfropfen vor sich geht. Aber was für den Menschen gute Früchte tragen soll, das muss gepfropft werden, oder, mit andern Worten: Was für den Himmel – welcher das Mass eines vollendeten Menschen ist – Früchte tragen will, das muss gepfropft werden mit dem guten Reis aus der Liebe und der Ordnung aller Himmel, welche im Dienen liegt. Darum solche Selbstzerstörung des Individuums nur beim Menschen möglich ist, weil nur er gepfropft wird.
Weiter erkannte dieser Knabe in seinem reiferen Alter dann auch, dass solche Nebenstämme, die als Ersatz getrieben werden, am Ende die noch unveredelte Kraft zerstreuen und es dann erst möglich wird, an den schwächsten insgeheim neue Pfropfreiser anzubringen, welche der grösseren Zerstreuung des Gesamtwesens wegen vom Baume nicht als solche erkannt werden und deshalb auch eher anwachsen können, sodass ein solcher Baum dann doch noch wenigstens in seinem Äussersten, in seiner Verstandeserkenntnis, gutfrüchtig wird, wenn er schon im Urwesen seiner einstmaligen Liebe nicht gutfrüchtig werden wollte.
Bei so gestalteten Menschen wird also mit andern Worten ein Einfliessen des Guten durch äussere Belehrung nur in Wissens- und Lebensgebieten möglich, in welchen sie nicht stolz auf ihre eigene Leistung und ihr eigenes Können sind. Aber selbst dort verfährt der psychologisch (also gärtnerisch) Geschulte am besten, wenn er die in das Wesen einzubringende Wahrheit nicht als solche vorbringt, sondern lediglich als eine Hypothese vorträgt, die er selber mit Vorteil erst noch leicht zu bezweifeln anfangen kann, sobald er merkt, dass der Wildling daran eine Freude bekommt. Durch dieses Bezweifeln, was einem fortwährenden Enteignungsversuch des einmal An- und Aufgenommenen gleichkommt, wird erwirkt, dass sich der aufnehmende Wildling nur umso mehr mit dem neu Aufgenommenen konsolidiert. Wie lange es dann aber noch geht – wenn überhaupt – bis der Wildling die Vorzüglichkeit dieser Pfropfung in einem solchen Masse erkennt, bis er willens wird, von nun an alle seine Kraft nur noch auf diesen – bisher schwächsten – Nebenstamm zu konzentrieren, und bis er sein ganzes Wesen dann noch derart umgestellt hat, dass er alle Kräfte der andern Nebenstämme auf diesen neuen Einen nun vereinen kann, wird unendlich viel Zeit und Geduld erforderlich sein. Aber eine Freude an einer erneuten weitern Pfropfung wird er dennoch nie haben und deshalb stets nur notdürftig mit guten Ästen versehen sein.
Als eine weitere Erkenntnis aus dem damals von seinem Vater erhaltenen Bilde oder Gleichnis wird der Knabe dann auch merken, dass der verschüttete Stamm des guten Baumes nichts anderes ist, als das gute Entsprechungsbild der Sorgen und der Krankheit, die das ursprünglich Wilde, Seelische eines Menschen oft derart beugen und umgeben müssen, dass von ihm nicht mehr viel sichtbar bleibt und alle Kraft noch vermehrt in die Krone getrieben wird. In die Krone der Schöpfung, welche dem vollendeten Menschen entspricht. Ja, der nun schon längst erwachsen gewordene Knabe wird erkennen, dass das den Stamm zudeckende Erdreich noch einiges an Feuchtigkeit abgibt, die der Stamm zur Verwendung des Kronenwachstums noch zusätzlich aufnehmen kann. Oder auf den Menschen bezogen: Krankheit und Sorge entziehen dem Leib soviel Kräfte, dass die innere, seelische Kraft des Menschen nicht mehr so sehr zur Mässigung der oft überbordenden Leibesbegehren gebraucht werden muss und dadurch vermehrt der Kräftigung ihres Geistes zu Diensten stehen kann.
Auch wird er wohl erkennen, dass nicht unbedingt alle guten Fruchtbäume ihre Stämme derart vernachlässigen müssen, damit nur möglichst ihre Krone gross wird. Welch ein wundervolles Bild ist doch ein Fruchtbaum, der – mit kräftigen Wurzeln im Boden verankert – auf einem gesunden und geraden Stamme eine mächtige Krone trägt; wie herrlich auch schützt er bei Regen seine Nutzniesser, die unter ihm stehen können, damit sie trocken bleiben. Und dennoch: – so liebevoll zugänglich und demütig freundschaftlich wie jener Baum im Obstgarten seines Vaters wird er nicht aussehen. So bescheiden freundlich, wie dieser über dem Abgrund des Tales stehend alle Stürme mit Gleichmut über sich hinweg ziehen lassen konnte, kann ein gesundstämmiger Baum dem ihm Widerwärtigen nicht entgehen; er muss und wird ihm trotzen mit seiner gerechten Kraft. Aber die Kindlein als Symbol des Himmels finden sich viel wohler bei dem kleinen und freundlich zugänglichen Strauche, als bei den hohen Schönheiten, darum es ja auch heisst, dass im Himmel über einen reuigen Sünder mehr Freude herrsche als über 99 Gerechte.
Es ist zwar für einen gesunden, natürlichen Menschen etwas schwer verständlich, dass ausgerechnet über einen reuigen Sünder im Himmel mehr Freude herrschen soll als über 99 Gerechte. Aber der schwache Knabe erkennt das eher, dass nur die eigene Schwachheit sich der wahren Grösse derart anzuschmiegen fähig ist, dass sie förmlich in ihr aufzugehen vermag. Und dieses Aufgehendürfen erfüllt den Schwachen mit so beseligender Liebe und Dankbarkeit, dass er sich in stets vermehrtem Masse noch vollkommener hinzugeben vermag, während des Gerechten Mass einmal voll wird. Deshalb heisst es, dass Gott in den Schwachen mächtig sei, weil die Schwachen ihm keinen Widerstand der Eigenheit leisten, sondern nur nach ihm alleine das immerwährende Verlangen haben, welches der Hunger der Liebe in ihnen bewirkt.
Der Gerechte aber erkennt die Hilfe Gottes nicht in demselben Masse wie einer, der zufolge einer Sünde diese Hilfe eine Zeitlang entbehren musste, und kann sich deshalb nur selten derart hingeben wie ein Schwacher durch die Sünde. Auch erkennt einer den Wert der Liebe eher, wenn er sie vermisst, als einer, der sie besitzt. Darum ist ein solcher der über-mächtigen Liebe Gottes eher mehr zugetan als einer, der sich dieser Liebe wert fühlt und sie auch augenscheinlich empfängt.
13.7.1991
nach oben
EIN RÄTSEL  Es war – und ist eigentlich noch – ein gar wundersamer Meister der Gartenkunst, der schuf eine Blume von unbeschreibbarer Schönheit und beseligendem Duft mit stark heilender Kraft, die so sonderbar war – und heute noch ist –, dass sie nur wenige kennen und noch weniger Menschen sie pflegen und beinahe niemand begreifen kann das sonderbare Wesen dieser Pracht.
Wohl ist der Meister noch, und gibt diese Kostbarkeit gerne einem jeden, der danach fragt und darum bittet und der deshalb zu ihm kommt. Aber stets weniger finden den Weg zu ihm. Ja, für viele ist diese Geschichte nicht mehr, als eine Mär aus alter Zeit. Und doch gibt es auch heute noch Menschen, die diese Blume im eigenen Garten haben und sie pflegen. Aber diese Blume ist derart gestaltet, dass sie die meisten nicht kennen, auch wenn sie sie mit den Händen greifen können:
Zum einen ist ihre Gestalt eine sehr vielfache und ihre Farbenpracht übertrifft zum andern alles. Eigentlich ist sie weiss, jedoch im Morgenlicht und in der Abenddämmerung erscheint sie eher gelblich mit einem leichten Anflug von rosarot. An ganz kalten Morgen, wenn die Sonne aber ganz rein über dem Horizonte aufgeht, kann sie leuchten aus ihrer innersten Mitte in tiefem und dennoch lichtfeurigem Rot und nur die Ränder sind etwas rotgolden bis weisslich verfärbt. Wer sie so gesehen hat, dem erscheint sie in helleren Nächten lichtblau – und wenn die Nächte kalt sind, besonders, wenn schon leichter Schnee über der Welt liegt, kann sie dann in ihrer Mitte ein warmes Lila mit einem leichten Anflug von rosarot erkennen lassen, während ihre äussersten Ränder in leuchtendem hellen, und dennoch durch einen leichten Silberglanz verhüllten Himmelsblau erscheinen. Ihre Form ist sternförmig und ihre Mitte stets verhüllt.
Über die Kultur dieser seltenen Blume hat der Meister eine eingehende Gebrauchsanweisung gegeben, die in vielen Abschriften existiert. Diese Abschriften sind zumeist aber verfälscht, sodass schon die Kulturbedingungen selber in heutiger Zeit geheimnisvoll erscheinen. Am besten ist es noch stets, sich beim Meister selber Rat zu holen; nur ist der Weg beschwerlich und Erwachsene finden ihn kaum.
Der Same dieser Pflanze ist ungemein fein, sodass es besser ist, sich gleich eine Jungpflanze geben zu lassen, als den Samen zu suchen. Weil sie aber trotz ihrer Seltenheit dennoch über dem ganzen Erdenrund verbreitet ist, so kann es vorkommen, dass sie jemand plötzlich in seinem Garten hat, wenn nur ein winziges Sämlein dahingeflogen kam, und natürlich die Bedingungen zum Keimen gut waren. Besonders die Kindlein erleben das oft, sofern sie einen ganz kleinen Gartenanteil besitzen.
Es kann auch geschehen, dass bei kleinen, zarten Kindlein, die keinen Garten und nicht einmal ein Zuhause haben, diese Blume zur Blüte treibt, ohne vorher Kraut getrieben zu haben. Wenn ein verwaistes Kind in einer sehr kalten Nacht, von Müdigkeit, Hunger und Schwäche übermannt, sich niederlegt und vor grosser Kälte seine Händchen auf seine Brust drückt und leise und ganz stille vor sich hin weint, so geschieht es manchmal, dass ihm eine solche Blume zwischen seinen Händchen über der Brust zu spriessen beginnt und es wärmt. Obwohl solch ein Kindlein dann diese Welt verlässt, ist es doch ein grösstes und schönstes Erlebnis für sein Erdenleben. Und es lächelt stets dabei, was man bei seinem leblosen Körperchen auch später noch feststellen kann. Nur die Blume findet man nicht mehr!
Auch gibt es Kinder, die besonders zur Nachtzeit solche Blumen sehen und darüber auch ihren Eltern berichten. Weil aber diese Blüte zur Nacht nur sieht, wer sie bewusst oder unbewusst am Tage, oder noch besser am Morgen schon gesehen hat, so sehen sie die Eltern zumeist nicht und glauben ihren Kindern auch nicht. Aber Weise haben bemerkt, dass Kinder, die einmal oder auch öfters diese Blume schauen, besonders wenn sie sie intensiv betrachten, nachher einen Abglanz davon in ihren Augen tragen.
Noch merkwürdiger als die Blume selbst ist ihre Frucht! Sie gedeiht nur, wenn die Blume gegessen wird; niemand je hat sie gesehen, wer sie aber isst, verspürt nachher, wie sie wächst und wie eine grosse Wärme sich in alle seine Glieder ergiesst und verspürt auch eine Helligkeit in sich. Und wenn er spricht, verspritzt er ganz winzige, dem blossen Auge nicht sichtbare Sämlein. Diese sind so fein, dass sie überall hinkommen. Dass sie aber nur selten keimen und zu einer neuen Blume werden, liegt an den Bedingungen, die sie zum Keimen brauchen, und die beinahe nirgends in der Welt vollständig sich vorfinden.
Warum wohl ist denn dieses Kleinod, diese Pracht und dieser Balsam nicht überall verbreitet auf der Welt? Auch das hat wieder seinen Grund im Wesen der Blume selbst. Abgerissen ist sie nämlich beinahe nicht haltbar; nur wer sie fest und unablässig in seinen Händen hält, dem bleibt sie erhalten und kann sogar zur Frucht werden. Aber wer wollte schon eine Blume immerwährend in seinen Händen tragen? Ja, die Kindlein wohl, die noch nichts Irdisches erwerben können und noch keine Arbeit verrichten können, die könnten das wohl; aber dann könnten sie nicht spielen, und deshalb tragen sie auch die Kindlein nur selten herum. Jene Kindlein aber, die sich gar übermächtig an dieser Blume freuen, die tragen sie wohl auch stets herum. Aber, weil sie oft viele solche Blüten haben, so verschenken sie diese auch gerne und leicht. Und wenn der Empfänger die Blume nicht ebenso innig in Händen hält, so verwelkt sie schnell und wird blass, grau und bald unsichtbar.
Manchmal auch geschieht es, dass sie die Erwachsenen den Kindern wegnehmen und als Schmuck auf ihr Haupt stecken, und das ist mit ein Grund, weshalb diese Blume oft nicht nur ungekannt bleibt, sondern öfters noch verachtet wird. Denn sobald sie aufs Haupt gesteckt wird, fängt sie an auszuhärten und die weichen, balsamisch duftenden Blütenblätter werden steif und unbeugsam und bohren sich gleich Nadeln oder Dornen in die Haut. Dabei verströmen sie einen ungemeinen Ekelgeruch, der besonders – weil er steigt – die Erwachsenen bis zum Erbrechen bringen kann, ja sogar tödlich wirken kann. Kleine Kinder erleben das kaum je, weil der Aasgeruch sich nicht bis zu ihnen senkt und weil sie viel eher etwas ihnen Liebes in den Händen halten und an ihre Brust drücken, als dass sie es auf ihr Haupt stecken. Täten sie aber das, so würde es auch Ihnen ergehen wie den Erwachsenen.
Ein weiterer Grund dafür, dass diese Blume nicht sehr verbreitet ist, in dieser Welt, liegt an ihrem Kraut, das ebenso veränderlich ist wie die Blume selbst. Ja, es ist so verschiedenartig, dass beim Betrachten irgendeines unbekannten Krautes niemand mit Sicherheit sagen kann, ob er gerade das Kraut dieser Blume vor sich hat oder irgend ein ganz gewöhnliches.
Zumeist ist es rauh und etwas derb, öfters noch dornig. Vor allem ist es beinahe undurchdringlich dicht und manchmal klebrig. Das alles hängt ganz von seiner Kultur ab. Vielfach hat es nur halbausgebildete Blätter oder öfter auch sind viele seiner Stängel dürr. Dabei bilden sich oft keine, oder nur ganz selten Blüten. Anderseits kann es auch wieder solche geben, deren Laub feiner gestaltet ist und dessen Form harmonisch sich entfaltet – das kommt ganz auf die Pflege oder die Kultur an. Viel Licht lässt das Kraut herb werden und grob, dornig und warzig; viel Wärme lässt es geschmeidiger werden und Feuchtigkeit tut ihm gut. Vor allem fördert sie auch die Blütenbildung, weshalb auch zumeist gerade die Kindlein nur wenig Laub und grosse Blumen haben, besonders jene, die viel weinen, sofern sie nur im Stillen weinen und ihr Tränenwasser nicht in die Welt verspritzen. Auch halten die Kindlein diese Pflanzen gerne in ihren Händchen und drücken sie an ihre Brust. Diese, von kindlicher Liebe erregten, meist feuchtwarmen Händchen kräftigen die Pflanze sehr.
Wie heisst wohl diese Blume, die heute stets seltener wird, die auch die heutigen Kinder stets weniger sehen und die doch stärkend wirken würde; die mancher Sterbende sich wünscht und auch hin und wieder sichtlich erhält. Diese Blume, deren Same so fein ist, dass er mit blossem Auge nicht gesehen wird und dennoch überall sich befindet und doch wieder nur so selten keimt. Was muss es wohl für eine Blume sein, die am Morgen so schön rot ist und nur für jene in der Nacht blau erscheint, die sie schon am Morgen oder doch wenigstens am Abend vorher gesehen haben? Deren Kraut den Bedrängten oft Tränen entlockt und deren Blüte dennoch wieder alle Tränen trocknet?
Gäbe ich auch den Namen preis, so wäre sie gleichsam vom Stiele gerissen, wer würde dann seine Hände leihen, um sie ständig herumzutragen, dass sie nicht welken möchte?
10.11.1981
nach oben
DES RÄTSELS LÖSUNG  Beim Lesen der Geschichte, die ja zugleich auch ein Gleichnis ist, können bei noch nicht ganz verwirktem Gemütsleben stille Sehnsüchte nach einer bessern Welt entstehen. Und diese Sehnsüchte, die sich wie ein leises Heimweh kundgeben, sind ja schon der Beginn der Blüte dieser seltenen Pflanze! Weil sie nach Hause, also an den Anfangsort, zum Ausgangspunkt ziehen, so erregen sie in ganz sachter Weise die Liebe des Menschen, die er ja eben von diesem Ausgangspunkte, von seinem Schöpfer erhalten hat. Und die Liebe ist somit nicht nur der eigentliche Grund eines jeden Menschen für sich, sondern vor allem der Grund für die ganze Schöpfung, Und alles was da gemacht ist, ist aus Liebe gemacht und ein jedes Ding ist in sich pur Liebe. Nur, weil die Liebe des einen und einigen Gottes sich so vielgestaltig dem Äussern nach zeigt, so streitet dem Anscheine nach ein Ding mit dem andern, also eine Liebe mit der andern, und wir Menschen bedauern es, wenn der Wolf die Schafe reisst.
In der innern Wirklichkeit aber könnten wir dieses Bild des Schafe fressenden Wolfes aber auch als Gleichnis sehen: dass nämlich die Erkenntnis des Abgängigen eines Wesens, die gleich dem Hunger ist, die Ruhe, die sich im sorglos weidenden Schafe bildlich zeigt, verzehrt. Erst nach dem Verzehr, also nach der Sättigung des Erkenntniswillens durch neue Erkenntnisse, tritt dann eine Ruhe ein.
Aus diesem Bilde ersehen wir, dass die Bilder der Natur eine geistige Entsprechung haben, die auf den ersten Blick der natürlichen Wahrheit widersprechen. Wenn wir aber bedenken, dass auch das Schaf einen Hunger verspürt und diesen durch Frass stillt, das heisst durch Einverleibung zwar andersartiger aber immerhin noch verwandter Nahrung, so erkennen wir, dass die sanfte Natur des Schafes vor allem auch darin begründet ist, dass es seine ihm zusagende Nahrung – oder, entsprechend seine Erkenntnisinhalte – überall und leicht findet, weil sein Erkenntnishunger mehr allgemeiner Natur ist, und es deshalb auch leichter zur Sättigung kommt, während der Wolf schon alle seine Kräfte und seine Intelligenz braucht, um zur Sättigung seines Hungers zu gelangen. Also sind auch die kleinsten Kindlein den Schafen gleich, da sie mit einfacher Milch gesättigt werden und sie darüber hinaus nicht manches weitere Bedürfnis spüren.
Der Heranwachsende ist dann, sofern er geweckt ist, eher einem Wolfe zu vergleichen, denn sein erwachender Geist wittert unruhig überall hin nach neuen Erkenntnissen und keine Anstrengung ist ihm zuviel, um zur Sättigung zu gelangen. In dieser Zeit verzehrt der Mensch oft alle ihm eigene Ruhe und er braucht dann schon sehr viele ihn eher beruhigende Erkenntnisse, bis er selber wieder zu einiger Ruhe gelangen kann.
Solche Entsprechungsbilder, die man auch Gleichnisse nennt, sind derart beruhigende Erkenntnisse, weil sie den Menschen gewahren lassen, dass er von einem Punkt oder von einem Zuhause ausgegangen ist und dass es ihm dort wohl wieder am Besten ergehen würde. Also zieht der hungrige Wolf dann, wenn er erstmals auf das beseligende Gefühl der ewigen Sättigung aufmerksam gemacht wird, in Richtung heimwärts, zu seinem Ausgangspunkte, dem Schöpfer, der in seiner allmächtigen Liebe nicht nur der Anfang und das "Alpha" ist, sondern eben vor allem auch die Erfüllung oder das "Omega".
Wenn er, der Wolf oder die Liebe zur Erkenntnis, also zur Wahrheit, daselbst ankommt, so ist er dann wahrhaft auf einer saftigen Trift, auf welcher es niemals einen Mangel gibt, und seine Natur wird wieder sanft und er wird mit den Schafen in einem und demselben Stalle sein. Also ist die Liebe der Anfang und das Ende oder die Erfüllung und damit ist nur sie alleine eine Wahrheit und diese Wahrheit ist eben die seltene Blume in der Welt; weil eben gerade sie durch beinahe alle äussern Erscheinungen verdeckt wird und sich nur im Allerinwendigsten finden lässt. Weil aber das Inwendigste die Liebe ist, so erscheint im Bilde oder Gleichnisse diese Blume im Morgenlichte, das heisst in der beginnenden Erkenntnis in Rot, als dem Symbole der Liebe. Und nur, wer einmal erkannt hat, dass die Wahrheit aus der Liebe in Gott besteht und wieder nur in der Liebe, eben zur Wahrheit und damit – oft noch unbewusst – zu Gott, gefunden werden kann, der wird zur Nachtzeit seiner Erkenntnisse dieselbe Blume blau sehen. Die Nachtzeit seiner Erkenntnisse ist jene Zeit, in welcher der Mensch, durch die scheinbare Notwendigkeit der Weltsorge, seinen Erkenntniswillen auf den Erwerb materieller Erkenntnisse richtet, und damit beginnt, vom Materiellen, also von der Lüge, zu zehren. Dadurch wird sein Gemüt sehr kalt werden, weil seine Tätigkeit im Kopfe begründet wird und nicht mehr im Herzen. Wenn er dann – zum Beispiel durch ein Gleichnis – in seinem Herzen wieder etwas aufgeweckt wird, was die hellen aber kalten Nächte in der Geschichte bezeichnen, in welchen seinem Verstande immerhin so viel Licht zukommt, dass er das Erkannte in seiner dadurch zustande gekommenen Erregung seinem Herzen mitzuteilen beginnt, sodass dieses wieder erwacht und das Gemüt dadurch erwärmt wird, so kann es immerhin geschehen, dass er sich wünscht, alle materielle Weltsorge verlassen zu können und wieder ganz der Wahrheit alleine zu leben. Dann eben bedeckt er seine vom Verstand erhärtete, kalte Gemütswelt mit dem Niederschlag der Liebessehnsucht, und das entspricht im Gleichnis dem Schnee in diesen kalten Nächten, der auf der Welt liegt, sodass sie dadurch von ihm zugedeckt wird. Wenn ein Mensch wieder einmal so weit ist, so sieht er in der Mitte der blauen Farbe dieser Wahrheitsblume schon wieder ein leichtes Rosa der Liebe, während das Blau, als der Farbe der Treue, die Treue der Gottesliebe durch Ihren Ernst und Ihre Ordnung versinnlicht.
Diese Erkenntnis des stets gleichen Gottes ist zwar beruhigend wie die blaue Farbe selbst, auch für den Verirrten; aber zum Leben erregend ist dennoch nur die Liebe, die sich in der Mitte der Blume als Rosa kundgibt, andeutend, dass eben die Liebe die Mitte und das Zentrum allen Lebens ist – der Anfang und die Erfüllung zugleich. Sternförmig erscheint im Bilde die Blüte der Wahrheit deshalb, weil ja in all den vielen Wesen, die sich wie im Kreise um Gott, als der Urwahrheit, versammeln, nur eine Wahrheit wirkt, die stets vom Zentrum, also von Gott aus, wirkt, sich also strahlenförmig wie das Licht der Sonne ausbreitet.
Der Same dieser Blume ist deshalb überall vorhanden, weil eben auch die Wahrheit überall vorhanden ist. So klein und unscheinbar ist er nur deshalb, weil das Äussere auf den Menschen stets einen unverhältnismässig grösseren Eindruck macht, als der inwendige Grund zu all den vielen Erscheinungen, der nur in der sich erklärenden Liebe gefunden werden kann. Die Erkenntnis der Wahrheit ist deshalb nur ganz demütigen und liebevollen Menschen eigen, die vor allem in sich selbst tätig sind; und wenn diese auch der Wahrheit gemäss sprechen, so werden sie oft nicht verstanden, weil sie zwar wohl die Erkenntnis, nicht aber deren Grund weitergeben können, weshalb im Bilde (des Rätsels) der Same von blossem äusserem Auge nicht gesehen werden kann. Die nährende Frucht der Wahrheit aber hat nur, wer in der Wahrheit selber – durch alle seine Handlungen und Reden, ja sogar in allen seinen Gedanken – bleibt. Dieser ist es auch, der die Wahrheit in sich tätig aufgenommen hat, also im Bilde gegessen hat.
Wer die Blume der Wahrheit abreisst, das heisst, wer eine Erkenntnis, als einen Teil der Wahrheit, in sich hat, kann diese nur erhalten, wenn er stets dieser Erkenntnis gemäss handelt – selbst dann, wenn seine Handlungen dann einmal sogar scheinbar gegen das Interesse seiner äussern Erhaltung gehen. Deshalb ist die Blume im Bilde auch nur frisch zu erhalten, wenn sie stets in Händen getragen wird. – Aber darum steht auch die Frage, wer das schon könne und wolle, und dass es am ehesten noch Kinder könnten, die noch auf keinen materiellen Erwerb angewiesen sind.
Wer aber die Wahrheit, die aus der Liebe Gottes kommt und wieder aus der Liebe zu Gott gefunden wird, als Schmuck auf sein eigen Haupt steckt, der verdirbt sie gänzlich, weil er sich hochmütig schmückt, während die Liebe und die Wahrheit nur demütig dienen. Der Hochmut ist denn auch der giftige Ekelgeruch für den wahrhaft Liebenden, der die Liebe tötet und die Wahrheit, die in der Liebe wohnt, in die äussern Worte und Buchstaben fixiert, die ihn in seiner Eitelkeit dann selber einmal verletzen und am Ende gar töten, wenn sie ihn in seinen gegenteiligen Handlungen treffen. Den Kindern widerfährt das deshalb seltener, weil sie von der scheinbaren Grösse der Erwachsenen noch leichter demütig gehalten werden.
Das Kraut dieser Blume ist gleich der äussern Erkenntnis, die auch eine Wahrheit darstellt. Diese aber ist gleich der Erkenntnis, dass der Wolf die Schafe frisst und sie ist als solches herb, dornig und oft so dicht (besonders in den Weltsorgen), dass sie undurchschaubar und verletzend, aber auch klebrig wirkt. Viel Licht, was vieler Weisheit gleich kommt, vermehrt unter anderem auch dieses Kraut. Viel Liebe oder Wärme, die inwendig sich gestaltet, vermindert das Kraut und sänftigt es und viel Feuchtigkeit, welche mit Schmerz ertragener Liebe entspricht, fördert die Blütenbildung als den Übergang vom äussern Kraut zum inneren Lebenssamen. Darum heisst es im Bilde, dass das Kraut den Bedrängten zwar Tränen entlockt, dass aber die Blüte sie wieder trocknet. Wer ein Gärtchen hat, also ein warmes und weiches Gemüt, in welchem sich etwas entfalten kann, und viel warme Liebe, der findet diese Blume bald in seinem Garten; wer das nicht hat, der muss, den Kindlein in dunkler Nacht gleich, erst aus Tränen ein Erdreich schaffen und wird dann diese Blume über seiner Brust, als dem Grund der Tränen, erblicken; aber – seine Aussenerkenntnis muss darüber sterben.
18.11.1981
nach oben
|