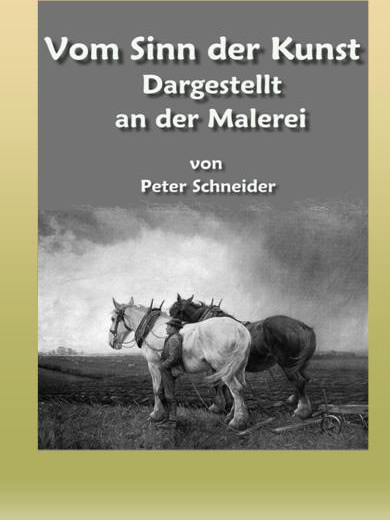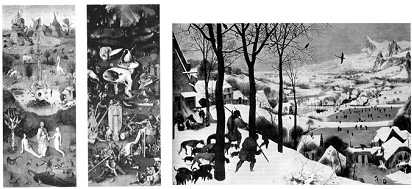|
Die Werke der Malerei spiegeln ebenso die innern Vorgänge der sie ausübenden Menschen wider wie die Werke jeder andern Kunst, ja wie selbst jede handwerkliche Gestaltung überhaupt. Allerdings geht nicht in allen Menschen gleichviel in ihrem Innern vor. Bei vielen wird der Geist durch die äussern Konventionen niedergedrückt. Manch eine Seele ist auch zu faul, sich über die üblichen Konventionen zu erheben oder auch nur sie zu hinterfragen. Wieder andere tun dies aus Schwäche oder Feigheit nicht. So kann es auch kommen, dass ein Mensch mit einem grossen so genannt natürlichen Talent, das ohne viel Aufwand an Zeit und Kraft zu grossem künstlerischen Leistungsvermögen kommt, eher weniger Eigenes entwickeln wird – oder wennschon, dann oft erst in einem höhern Lebensalter oder in einem spätern Abschnitt seines Schaffens. Ein kleineres Talent hingegen wird sich schon von Natur aus weniger schnell zu einer Kunstausübung herbeilassen, weil es den minder Talentierten viel kostet, zu einer gewissen Fertigkeit zu gelangen, die notwendig ist, um auch Abnehmer für die geschaffene Kunst zu finden und zu haben. Darum wird der weniger Talentierte zumeist nur dann zum Mittel der Kunst greifen, wenn er in sich durch fortwährende innerliche Beschäftigung einen gewissen Aussagedruck zu spüren beginnt. "Wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über", sagte Jesus (Matth. 12, 34). Bezeichnend, dass er nicht sagte: wessen der Kopf voll ist, dessen geht der Mund über. Denn im Herzen, das heisst in der Liebe alleine ruht die schöpferische Kraft, die unbedingt Ausdruck finden muss und diesen Ausdruck sucht und sucht, wenn es anfangs auch noch so schwierig ist. Schon ein ganz normaler in ein Mädchen Verliebter wird keine Mühe scheuen, endlich seinen innern Druck durch irgendein vermittelndes Wort – einen Ausdruck – an seine Geliebte los zu werden. Ja, je stärker der Druck der Liebe in ihm wächst, desto weniger gut wird ihm das oft gelingen. Denn Vieles in einen Ausdruck – ob Wort, Bild oder Ton – zu fassen, ist auch um vieles schwerer, als nur Weniges in einem Ausdruck festzuhalten. Zudem lässt sich Banales viel leichter ausdrücken als tiefe und tiefste Gefühle. Das alles fühlt und weiss also schon ein normal Verliebter aus seiner eigenen Erfahrung. Alleine, weil sein innerer Druck nur so lange währt, bis er sich ein erstes Mal eröffnet hat, wird ein solcher auch nie zu einem Künstler. Denn sein Druck erzeugendes Gefühl ist ja nur auf einen einzelnen Punkt der Schöpfung gerichtet – auf seine Geliebte –, und dazu genügt die eine Aussage, die auch nur wieder eine Einzige – eben seine Geliebte – ansprechen muss. Trotzdem wird auch er das zu Sagende in einer Weise tun, wie es den Umgangsformen seiner Zeit entspricht.
Ganz entsprechend wird darum auch der einzelne Künstler zu Beginn seiner Kunstergreifung immer mehr oder weniger die Konventionen seiner Zeit bei seiner Ausdrucksfindung mitberücksichtigen, weil er ja auf die Bereitschaft des "Eindruckaufnehmens" – seiner spätern Gönner – angewiesen ist, und die Kunstgeniessenden – die spätern Gönner – nicht so sehr in der Sache, (im Begreifen und Erkennen der Verhältnisse) ein Manko empfinden, das durch seine Kunst gedeckt werden muss, als vielmehr in der blossen Reizung ihres sonst leeren Gefühles, sodass ihnen die Art und Weise des Ausdruckes viel wichtiger erscheint als der Inhalt. Und selbst dieser Ausdruck – der zu ihrem Eindruck wird – muss in gewohnter Weise geschehen, also den üblichen Konventionen entsprechen. Er darf sie nicht befremden! Diese Konventionsberücksichtigung aber bringt den so genannten "Stil" hervor. Der Stil ist also nichts anderes als eine zeitlich bedingte und auch zeitlich begrenzte Konvention. Und diese färbt alle Kunstwerke sowohl der Literatur (Dichtung) wie der Musik und eben auch der bildenden Kunst – der Malerei und Steinhauerei.
Es gab Zeiten, in welchen die Lust an den Konventionen so gross war, dass diese Konventionen sich in so vielen Details manifestieren konnten, dass es genügte, eine allerlumpigste und banalste Aussage zu machen, wenn sie nur möglichst viele Variationen der Konvention berührte – dass also das Sprechen zur Hauptsache wurde anstatt die Aussage, das Spiel wichtiger als das Thema – und die Details dominanter als der Ausdruck des gesamten Bildes. Man denke nur an die Maler Hieronymus Bosch und die Maler-"dynastie" Pieter Breughel im 16. Jahrhundert mit ihrer ausgeprägten Figürlichkeit ohne jeden innern Lebens und Erlebens, und in der Musik an Komponisten wie Monteverdi, Albinoni und vor allem Joh. Seb. Bach mit seiner ausgeprägten Tonanhäufung, ohne dem einzelnen Ton Zeit und Gelegenheit zum sich Ausschwingen zu geben.
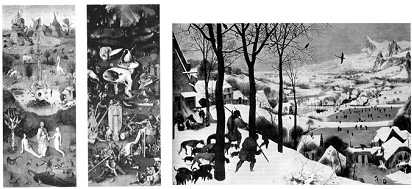
Hieronymus Bosch "Garten der Lüste" Pieter Breughel "Heimkehr der Jäger
All diese Konventionen entsprachen dem Ungeist jener Zeit, der sich insbesondere in der Religion – trotz der Reformation – noch von unmöglich vielen äussern Gebräuchen derart gefangen nehmen und knebeln liess, dass eine wirkliche, tief innerlich empfundene, lebendige Verbindung zu Gott verunmöglicht wurde. Dabei musste das Herz mit all seiner aus dem Gefühl des Lebens heraus empfundenen und entwickelten Liebekraft unter dem Gewicht solcher Verstandesklügeleien fast völlig ersticken.
Sowohl bei den genannten Malern wie auch bei den erwähnten Musikern gab es in ihren Werken darum auch keine sachten Andeutungen, zum Beispiel durch einen Schatten bei den Bildern oder durch einen Nachhall in der Melodie, sondern nur feste und starre äussere Tatsachen, die erdrücken, während erst die Andeutungen den Betrachter und Hörer in seiner innerlichen Liebekraft zur weitern innerlichen Verarbeitung des Vernommenen beleben, ja sogar begeistern würden. Erst das Ausklingen eines Tones zum Beispiel lässt den Hörer spüren, dass der Ton eigentlich ein Schwingen ist, ein Ausdrücken einer Kraft im Widerspruch zur lähmenden Stille. Erst die leichte Färbung (pastell) lässt die Farbe als gradative und einseitige Beeinflussungskraft des sonst neutralen weissen Lichtes erkennen. Schwere Farben jedoch erscheinen als blosse Tatsachen neben der Gegebenheit des weissen Lichtes. Sie wirken wie selbständig und lassen weder erkennen noch vermuten, dass auch sie Kinder dieses einen so neutral erscheinenden Lichtes sind. Die Konventionen spielten in jener Zeit eben mit Lust mit diesen aus dem Ganzen gelösten Einzelheiten, dem Figürlichen, und liessen damit nichts wahrhaft Lebendiges zu den Menschen sprechen, nichts ihr Inneres berühren. Solche Konventionen sind nur die Zeit vertreibend und die Leere kaschierend. Dabei kamen sich aber die Benutzer solcher Konventionen als Verkünder solcher den Geist richtenden Scheinwahrheiten noch äusserst gross und wichtig vor. Man betrachte dazu die inquisitorisch strengen Gesichter der Künstler jener Epoche, der so genannten alten Meister, wie zum Beispiel jenes von Joh. Seb. Bach!
Später hingegen wurde es ausgerechnet zur Konvention, Gefühl zu zeigen, was schon in der Klassik begann und sich in der Romantik fast zu einer Sucht entwickelt hat. Denn Gefühle zu haben und auch zu zeigen, ist das eine; sie zu verstehen und zu ordnen, ist ein zweites.
Aus einem solchen Verstehenwollen entstand dann später aber wieder eine Konvention, die schon zu Richard Wagners Zeiten begann und sich durch die gleichzeitige stete Ausbreitung der Wissenschaft ganz allgemein auch wieder immer mehr vom lebendigen Gefühl hinweg, in den Verstand hinein verstärkte und sich dabei sosehr ins Suchen, Experimentieren und Probieren, aber damit auch ins bloss Äussere von Zahlen und Formen verlor, dass sich die Konventionen nicht mehr einheitlich durcherhalten liessen. So sind dann in Musik und Malerei unzählige, nur in loser Verbindung zueinander stehende, vielfältige Richtungen entstanden, deren Kurzlebigkeit nicht mehr zur eigentlichen Ausschaffung oder Bildung von neuen Konventionen führen konnte.
Also sind zu fast allen Zeiten – bis auf die Neuzeit – die Konventionen das Innere des Menschen gefangen nehmende und verunstaltende Element gewesen, das der wahren Kunst geschadet hat. Einzig in der spätern Klassik und der frühen Romantik waren solche Konventionen einem allzu hemmungslosen Ausdrückenwollen nicht einmal unbedingt erstrebenswerter Gefühle und Vorstellungen entgegen, und somit eher brauchbare als hemmende Leitlinien.
Wenn wir uns also mit den Werken der Kunst befassen, werden wir – soweit sie gut und wahr, das heisst aus innerem Bedürfnis kommend ist – immer etwas Bestimmtes finden, das zu uns hindrängt, und ein Unbestimmteres darum herum, das den Rahmen bildet – eben die Konvention. Nur in der eher seichten Kunst aller Epochen, die im Ausleben der Talente besteht, finden wir blosse kalte und renommiersüchtige Förmlichkeit. Daraus können wir schliessen, dass es sich in der Kunst trotz des dazu erforderlichen Talentes eigentlich genau gleich wie beim normalen, alltäglichen Handeln vernünftiger Menschen verhalten müsste: Sie müsste vor allem aus dem Innern kommen, aber dann, als zweite Bedingung, auch aus der zuerst in diesem Innern kultivierten Tiefe – aus den lebendigen Gefühlen eines verständnisvollen Menschen also. Denn wer die Tiefe seiner nur erst dumpf wahrgenommenen Gefühle nicht ausgelotet hat und ihren Grund nicht erkennt, wie könnte der verständnisvoll und daher für andere wohlbegreiflich sich ausdrücken?! Freilich kann dieses Fassen seiner eigenen Tiefe bei dem Einen eher verstandesmässig und bei einem andern eher intuitiv erfolgen. Immer aber muss es ein durchgreifendes sein, da erst ein solches die Fähigkeit hat, sich andern gegenüber verständlich auszudrücken und mitzuteilen. Wer will schon einen Wirrwarr mit andern teilen wollen! Darum genügt es in der Kunst nicht – soll sie wahr und wahrhaftig sein –, nur Gefühle zu vermitteln oder nur bestimmte Schwächen zu beleuchten, ohne diese in ihrer Entstehung zumindest andeutungsweise zu erklären und ihre Überwindungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Natürlich kann anderseits auch wahre und wahrhaftige Kunst mit ihren Mitteln nicht aus an ihr völlig unbeteiligten Gaffern und Konsumenten wahre Menschen ziehen. Darum liegt in der Kunst ein erzieherisches Mittel für den sie Geniessenden darin, dass man zwar den ganzen Sachverhalt aufzeigt, aber immerhin so gestaltet, dass die darin aufgeworfenen Fragen den durch die Kunst Angesprochenen zuerst ordentlich brennen müssen, bevor sie dann nur nach und nach und eventuell nur andeutungsweise beantwortet werden. Auch dürfen mehrere Antworten enthalten sein, die erst in ihrer Abstimmung aufeinander Vollständigkeit erlangen, sodass selbst diese vollständige Antwort dem durch die Kunst Angesprochenen ein eigenes Abmühen abfordert, aber dadurch auch eine eigene Belebung all seiner Gefühle vermittelt. Allerdings gibt es nicht nur unter den Künstlern, sondern auch unter den von der Kunst Angesprochenen solche, die so lebendig genug sind und auch so tief fühlen, dass sie nicht noch extra zuerst belebt werden müssen, sondern im Gegenteil durch zu intensive Belebung all ihrer Gefühle auf Grund des dadurch geforderten erhöhten Verarbeitungsdruckes überfordert und deshalb schwach und traurig werden können. Es sind das melancholische oder depressive Menschen. Ihnen darf die Kunst mit ihren Werken nicht noch Weiteres abverlangen, sondern sie muss ihnen etwas Wohlzubereitetes bringen. Sie soll zwar eine Sachlage, sie begründend, aufzeigen, aber dabei vielmehr ihre Überwindung und vor allem die Möglichkeit der Überwindung betonen.
Dabei gelangen wir zu einem Punkt, der die drei Kunstgattungen wesentlich voneinander unterscheidet in eine Gruppe des steten Nebeneinanders und eine Gruppe des vorwiegenden Nacheinanders. Nacheinander erfährt der durch die Kunst Angesprochene die beiden Gattungen: Dichtung und die Musik. Nebeneinander erfährt er die Gattung bildende Kunst mit ihren Zweigen: Malerei und Bildhauerei.
Dabei ist klar, dass das Nebeneinander die Fragen nie so brennend und darum auch nie so belebend stellen kann wie das Nacheinander. Denn beim Nebeneinander muss ja die Antwort gleich dabei oder eben "daneben" liegen, während sie beim Nacheinander oft schrecklich lange – trotz mancher möglichen Vorandeutungen – auf sich warten lässt. Zum Beispiel in der Musik, wo eine Dissonanz nur langsam und vorerst oft nur in Andeutungen einer möglichen Harmonisierung endlich zu einer Konsonanz – zu einem Wohlklang – kommt. Darum spricht Dichtung und Musik den Menschen im Allgemeinen heftiger an als die bildende Kunst. Man ist dort eher mit dem Leben konfrontiert, das ebenfalls unablässig nacheinander auf uns einwirkt, und in der bildenden Kunst eher mit der Betrachtung dieses Lebens.
Der stille Friede einer Abendlandschaft zum Beispiel, der nur durch die im Bilde in weiter Ferne dargestellten Hantierungen eines oder mehrerer Menschen unterbrochen ist, zeigt, wie der grosse Friede im Menschen durch kleine Hantierungen eher belebt, als unterbrochen wird. Anderseits zeigt ein anderes Bild, welches Menschen im Vordergrund an einer Arbeit darstellt und eher im Hintergrund eine Abendlandschaft erkennen lässt, dass erst die richtige, weil angemessene und stete Beschäftigung den Menschen zu einer innern Ruhe und Erfüllung – dem Wesen eines schönen Abends gleich – bringt. Beide bildlichen Darstellungen sind Betrachtungen über das Leben! Das eine Mal über das Wesen des Friedens, das andere Mal über den Weg zum Frieden hin.
Natürlich kann auf einem Gemälde auch eine Schlacht, ein Brand oder ein Sturm dargestellt werden. In diesem Falle wirkt dann auch die Nebeneinander-Kunst sehr belebend, wenn nicht gar aufwühlend. Aber eben: Würde das in der Musik oder der Dichtung geschehen, so könnte auf die Frage nach dem Sinn oder Nutzen solcher Katastrophen mit der Zeit – eben nachher – vom Kunstschaffenden ohne weiteres eine Antwort gegeben werden. Sie in einem solchen Bilde gleichzeitig mitzugeben, ist weit schwieriger – wenn auch nicht unmöglich. So könnte beispielsweise in einem Bilde dargestellt sein, wie ein Haus oder gar ein Schloss auf einem etwas vorspringenden Landstück vom Sturme abgedeckt wird, während im Hintergrund, in der schützenden Enge eines Tales ein ärmliches kleines Haus noch unversehrt blieb. So wäre auch das eine Betrachtung des Lebens, die zeigt, wie gefährlich das Sich-Exponieren im Leben sein kann und wie gut geschützt die Bescheidenheit oft ist, wenngleich natürlich von exponierten Stellen aus das äussere Leben besser genossen werden kann, sich aber eben auch leichter verflüchtigt und zerstreut, wie die herumfliegenden Ziegel und Balken auf dem Sturmbild verdeutlichen.
Es wird aber ein stürmisch veranlagter Betrachter dieses Bildes einerseits die kleine Hütte im Hintergrund gar nicht sehen, solange er vom Sturmgewühl im Vordergrund gefangen gehalten wird – und ein Bild mit friedvoller Abendstimmung anderseits wird ihn nicht oder ungleich weniger ansprechen.
Umgekehrt wird ein vom Leben schwergeprüfter Betrachter die Aussagen in den Abendbildern gut verstehen und sie auch als Bestätigung seiner Erfahrungen und Gefühle empfinden – und diesen Eindruck auch dankbar in sich aufnehmen. Aber das Sturmbild will er sich nicht längere Zeit ansehen, obwohl er wahrscheinlich bald einmal – auf dem Bilde die Ruhe suchend – die ärmliche Hütte erblicken wird und die Tatsache dankbar zur Kenntnis nimmt, dass ein Haus in dieser Position eher verschont bleibt. Aber die Enge des Tales, die er aus seinem eigenen Leben kennt, wird ihn unangenehm berühren. Er brauchte eher – wennschon ein Haus in einem engen Tale – ein Bild, welches die kindlich sorglose Entfaltung spielender Kinder unter der Aufsicht ihrer Mutter in einem Zimmer darstellt, durch dessen Fenster man zwar die Enge der äussern Umgebung noch gut erkennt, aber dennoch näher beim Gefühl der Weite bleiben kann, wie es sich bei eher innerer Betätigung oft einstellen kann – so, wie es auch der im Vordergrund eines solchen Bildes dargestellte grosse Zimmerboden für die mit innerer Anteilnahme und viel Fantasie spielenden Kinder immer noch sein wird.
Viele derartige Bilder schuf zum Beispiel der geniale Maler Ludwig Richter, der in seinem Leben durch seine tiefe Gemütsergriffenheit selber viel durchstehen musste und dabei seinen Glauben an das von oben geleitete Geschick der Menschen nicht etwa verlor, sondern in gar Vielem bestätigt gefunden hat.
Einer musikalischen oder dichterischen Darbietung könnte ein vom Leben schwer Geprüfter weniger gut beiwohnen, sofern sie in ihrem Nacheinander auch einmal auf einen ausgedehnten Sturm gerät, weil ihn dieser zu einseitig und damit auch über seine Kräfte hinaus in Beschlag, und damit gefangen nähme. Das Sturmbild kann er eher weg legen oder sich wenigstens gleichzeitig an der verschonten Hütte im engen Tale innerlich aufrechterhalten.
Wir ersehen aus den bisher geschilderten Abläufen, dass die Kunstgattungen des Nacheinanders uns stärker in Beschlag nehmen, uns stärker ansprechen können; dass sie aber – als Folge – dann auch mehr Kraft erfordern. Wenn sie hingegen ausgleichend wirken, so lassen sie uns dafür die Fragen auch bald vergessen.
Die Kunstgattung des Nebeneinanders hingegen spricht durch das nebeneinander Dargestellte selten so heftig an, zeigt aber darum auch viel plastischer die Möglichkeiten, die in allen Vorkommnissen und Begebenheiten liegen; findet mit andern Worten besser zur Quintessenz des Lebens. Darum aber ist diese Kunst auch viel delikater was ihre Ausführung betrifft! Während man eine etwas unbeholfene oder übertrieben betonte Stelle in der Musik oder Dichtung noch schnell einmal vergisst angesichts des darauf folgenden wohlgestalteten Weitergehens, so bleibt eine solche Schwäche des Werkes, ein solcher Fehler auf dem Nebeneinander – oder der stetigen Gegenwart – eines Bildes oder einer Plastik natürlich auch fortwährend als störender Punkt erhalten. Und ein Bild mit einem solchen Punkt erscheint uns ungleich schwerwiegender unvollendet als eine musikalische oder literarische Darbietung mit einem ebensolchen Fehler. Denn das Falsche liegt da unmittelbar bei dem Guten und spricht uns also immer mit dem Guten zusammen an. Bei dem Nacheinander hingegen erscheint es viel mehr separiert – entweder vorher oder dann eben nach dem sonst Guten oder gut Gelungenen.
Die Konventionen allerdings sind bei beiden Kunstarten gleich störend; denn diese sind selbst bei dem Nacheinander immer gleich gegenwärtig wie beim Nebeneinander, weil sie sich an alle Aussagen anklammern. Darum wird der sich wirklich frei entwickelnde Künstler nur dann und dadurch sich entwickeln können, dass er in seinem steten Lebensernst, mit dem er alles in ihm sich Zeigende und alles ihn Beseligende oder Bedrängende betrachtet, und dieses dann auch nach und nach zu gediegenen Erkenntnissen, Ansichten, Einsichten und zu ganzen Bildern vereinigt. Diese werden dann mit der Zeit sein ganzes Wesen derart erfüllen, dass er sie in äussern Formen festzuhalten bestrebt wird, und diese dann in der dadurch gewonnenen eigenen Klarheit auch andern mitteilen möchte.
Solche von Konventionen mehr oder weniger freie Künstler – mögen sie auch noch so selten sein – gibt es unter dem grossen und über-wiegenden Haufen der "Ungezählten" wirklich auch. Und jedermann, der – wenn auch ganz unvorbereitet – vor ihren Werken steht, empfindet, ohne angeben zu können, weshalb, diese Aussage oft so stark, dass er ganz ergriffen wird davon – besonders bei längerer Betrachtung.
Natürlich hat dem einleitenden Satz zufolge, nach welchem sich in den Werken der Kunst die innern Vorgänge des Künstlers widerspiegeln, jedes Bild eine Aussage. Aber es besteht ein grosser Unterschied zwischen einer bewussten Aussage aus dem Erkenntnislicht eines Aus-sagenden selbst und einer unbewussten Aussage über das Wesen des Künstlers, die erst aus dem Erkenntnislicht eines Betrachters wahr-genommen wird. Denn im zweiten Fall liegt die Kunst dann vielmehr auf der Seite des Betrachters. Sie verrät dem Betrachter zwar vielleicht für ihn selber Neues, vielleicht auch etwas über das Wesen des Künstlers selbst, und hat dadurch ebenfalls einen grossen und bleibenden Wert – aber eben nur für ihn! Denn solche Aussagen, die zwar wohl vom Betrachter wahrgenommen werden, nicht aber vom Künstler vorher erkannt worden sind, lassen natürlich den Künstler auch weiterhin stumm, das heisst von einer eigenen Erkenntnis und Beurteilung unberührt, seine ihn bewegenden – in diesem Falle wohl sehr oft bloss äusseren – Motive auf der Leinwand festhalten. Dabei ist dann eine Aussage in allen weitern Bildern nicht gesichert.
In den Bildern ersterer Art spiegelt sich die Lebenskunst des Künstlers, der aus all dem ihm in seinem Leben Begegneten etwas aufzubauen weiss, das auch andere in ihren eigenen, inneren Bestrebungen hilfreich unterstützen kann, während sich in den Bildern der vielen anderen der zweiten Art auf der einen Seite bloss die handwerkliche Fertigkeit als "Kunst" zeigt, und die wahre Kunst – das durch die Motivwahl und Motivdarstellung Aussagende zu erkennen – dem Können des Betrachters überlassen bleibt.
Blosse Fertigkeiten aber und die Freude, diese Fertigkeiten auszuüben, als Kunst zu bezeichnen, ist schon deshalb fragwürdig, weil es auch unter den Tieren solche angeborenen Fertigkeiten gibt. Vielmehr besteht die wahre Kunst darin, dasjenige aus der dem Menschen unter allen Geschöpfen allein verliehenen Freiheit zu machen, was ihn am meisten veredelt und dergestalt dann auch allen andern am meisten dient. Diese innern Vorgänge verständlich und andern nachvollziehbar zu machen und sie dann anspornend aufzuzeigen, ist die äussere Form der vorher im Innern, im Seelischen, gepflegten Kunst und verdient alleine und vor allen andern äussern Betätigungen als Kunst bezeichnet zu werden. Natürlich ist selbst bei diesen innern Veredelungen und der nachherigen Bildhaftmachung nicht ein jeder gleich geschickt und deshalb auch noch lange nicht eine jede solche Aussage gleich grosse Kunst.
Denn die Aussage eines jeden Bildes sollte soviel als möglich präzise sein, möglichst ohne dass dem zur Erkenntnis des Inhaltes der Aussage noch Unfähigen oder Unreifen zu sehr Dinge vor Augen gestellt werden, die er in seiner noch grösseren Erfahrungsarmut nicht verarbeiten kann und die ihn deshalb überfordern und damit in seiner innern Entwicklung hemmen oder schädigen würden. Die grosse Kunst liegt also nicht alleine darin, durch die Erfahrung die Erscheinungen zu erfassen, sondern ebenso sehr auch darin, das Erfasste so weiterzugeben, dass es einerseits jedermann möglichst umfassend erkennen kann, ohne dass es anderseits andere auf Dinge stossen lässt, die ihrer eigenen Erfahrung vorgreifen. Die grosse Kunst liegt also darin, das zu Offenbarende eher im Keime darzustellen als in seiner ausgeprägten Aussenform, aber so, dass ein geweckter Betrachter jederzeit aus diesem dargestellten Keime ohne Mühe jede Kleinigkeit der sich daraus ergebenden äussern Form insoweit erkennen kann, als sie in seinem Wesen zwar als bereits erlebt, aber immerhin noch nicht bewusst erkannt worden ist und darum auch bis zur Zeit der Betrachtung des Kunstwerkes verborgen in ihm geruht hat.
Dass im Übrigen auch Künstler Menschen sind und ihre Schwächen haben, ist klar. Und es sei mit dem soeben Erörterten auch überhaupt nichts gegen das Malen aus reiner Sinnenfreude, aus Freude an der schönen Form und an den Farben des Lichtes gesagt. Es ist auch ohne Weiteres klar, dass dabei auch natürliche Fertigkeiten noch verfeinert und verbessert werden können, sodass es zu einer ganz grossen Fertigkeit kommen kann. Aber die Frage bleibt dennoch, ob eine grosse Vollendung im bloss äusseren Schaffen als Kunst im eigentlichen Sinne gelten kann. Denn es ist ja auch eine gewisse Kunst, eine Mauer gerade aufzuführen, sein Geld richtig einzuteilen und einer Versuchung zu widerstehen. Und dennoch unterscheiden sich alle diese "Künste" eindeutig von der ganz grossen, wahren Kunst des Lebens, die einen aufbauenden und damit bleibenden Wert haben muss, der auch für jeden dadurch angesprochenen Einzelnen eine zeitlose Wirkung – über das Grab hinaus – beinhalten muss. Eine Kunst, wie sie in grossen Werken wirklicher Künstler, die auch ihr eigenes Leben meistern konnten, augenfällig hervorleuchtet!
Natürlich werden selbst von grossen und wahren Künstlern auch Bilder oder andere Werke geschaffen, die eher ihnen selber als den durch sie eventuell Angesprochenen dienen sollen. Es sind Studien und Übungen, die vielleicht sogar in grösserer Anzahl erforderlich sind. Aber die Werke oder Stufen der Ausbildung bereits als Kunst zu bezeichnen, ist eine Unüberlegtheit, die in keinem andern Beruf üblich ist als in den so genannten Kunstgattungen. So liegt beispielsweise der Sinn einer Aktstudie primär im Erfassen der körperlichen Form in all ihrer möglichen Brauchbarkeit fürs tägliche Leben, sodass in daraus erfolgenden, spätern Kunstwerken dieses schöne Sinnbild des menschlichen Wesens in seiner ganzen äussern Vollkommenheit auch hinter noch so ärmlichen Lumpen hervor leuchten kann – auch wenn die Lust beim Malen solcher Studien sich dann doch noch öfters auf die bloss sinnliche Wirkung – anstatt auf die Aussage – dieser Form konzentrieren wird. Aber nur, wer in einem spätern Werk auch in einer alltäglichen Szene diese Tauglichkeit der vollen Schönheit festhalten kann, ohne ihr einen extra sinnlichen Reiz zu geben, der versteht die Kunst, mit der Entsprechung, die im Schönen und Guten der vergänglichen Formen liegt, die Liebe des ewig dauernden Geistes dadurch zu wecken, dass er erst die grosse Nützlichkeit alles Guten als wahrhaft schön, und damit erstrebenswert einzusehen beginnt. Dann erst wird der Mensch mit dem Schönen der äussern Form nicht mehr selbst-gefällig spielen, sondern es ernsthaft und sorglich dazu benützen, die Lebenskraft der Liebe auch in den andern zu wecken, damit sich einmal alle in der Anerkennung dieser von einem ewigen Schöpfer geschaffenen Werte einträchtig finden und gegenseitig dienen können.
Wie banal nimmt sich daneben die aus blosser Sinnlichkeit betriebene Handwerksarbeit der Malerei – wie im Übrigen auch einer jeden andern so genannten Kunst – aus!
Noch weit vernünftiger und darum gehaltvoller als die solchem Sinnlichkeitskitzel dienenden Handwerksarbeiten sind die Werke jener Künstler, die – noch vor der Erfindung der Fotografie – ganz einfach der Notwendigkeit zu dienen versuchten, Geschehenes, Erlebtes oder Sich-dargestellt-Habendes der spätern Menschheit zur Beschauung in Bildern aufzubewahren, so, wie es nun für sie die Fotografie tut und so, wie es neben ihnen her auch die Schriftsteller teilweise getan haben mochten.
Bei der Malerei, die aus dieser Absicht heraus betrieben wurde, erkennen wir auch vorzüglich eher das handwerkliche Geschick darin, als die Kunst schlechthin. Zur Kunst konnte es beim Einzelnen erst dann kommen, wenn er bei dem Vielen, das ihm bei seiner Arbeit oder in seinem sonstigen Leben begegnete, anfing, die Wirkungen davon in sich selber zu studieren und aus dieser dann aus ihrer Ähnlichkeit, oder aber aus ihrer Gegensätzlichkeit zur Wirkung bei andern – die oft ganz verschiedenen Veranlagungen der verschiedenen Charaktertypen zu erkennen begann.
So kann zum Beispiel ein schreckliches Ereignis, das es in einem Bilde entweder festzuhalten oder auch bloss anzudeuten gilt, auf die daran Beteiligten ganz anders wirken als auf Unbeteiligte. Und man wird auf einem guten, kunstvollen Bilde aus den Stellungen und Physiognomien der dargestellten Personen bald einmal herausgefunden oder besser empfunden haben, wer beteiligt oder betroffen war und wer nicht.
Aber selbst bei den direkt Betroffenen ergeben sich je nach Alter, Wesen und Gesundheitszustand die allerverschiedensten Reaktionsformen auf ein und dasselbe Ereignis. So ist der eine fassungslos bestürzt, der andere verängstigt, der dritte verwirrt, ein vierter aufgebracht, ein weiterer gebrochen (was am Ende auch den vorher Aufgezählten nicht unbedingt erspart bleiben wird), wieder einer ist bereits auf der Suche nach Abhilfe und hingewendet dahin, wo er Trost und Kraft findet. Trost und Kraft ihrerseits liegen aber für ein Kind wieder vorzüglich bei seinen Eltern, während sie Jungvermählte vielleicht eher beim Ehepartner suchen. Dabei können wir dann schon erkennen, dass für die Jüngern Trost und Stärke ausserhalb ihres Wesens liegen, während diese beiden bei eher abgeklärten, älteren Menschen hingegen zutiefst innen – in ihrem Herzen – liegen, wo ihre Liebe das Teuerste behütet; das grosse, aus der Liebe begründete Verständnis für die Liebeführungen Gottes, dessen Walten sie ahnungsweise in äusseren Zulassungen wahrnehmen.
So kann ein und dasselbe Ereignis bewirken, dass der eine ausser sich kommt und der andere in sich gekehrter wird. Und eine jede Wesensart zieht ihre eigenen Konsequenzen bei einem jeden Ereignis – ob schrecklicher oder freudiger Natur. Und diese Konsequenzen aufzufinden und sich dabei auch um jene Natur des eigenen Wesens zu bemühen, die in ihrer letztendlichen Konsequenz für alle die grösst-mögliche Seligkeit zulässt, wäre eigentlich die Aufgabe eines jeden auf dieser vergänglichen Welt Lebenden. Die Gründe dazu aus all den verschiedenen Möglichkeiten aufzuzeigen, ist die eigentliche wahre Kunst des Lebens. Und sie auch bestimmt erst den Grad der Kunst – in der Malerei ebenso wie beim Schriftsteller oder beim Musiker. Denn wir alle sind nicht für immer hier, sondern nur zeitweilig, zur Er-probung und Konsolidierung unserer Kräfte in der Freiheit der völligen Isoliertheit von der uns erschaffen habenden Kraft und in der Sammlung allen unvergänglichen Erfahrungsreichtums aus den Abläufen des Vergänglichen.
Es muss also der wahre Künstler nicht einfach ein Ereignis festhalten, noch sollte er es einseitig kommentieren, sodass ihm dann viele anders Denkende und Empfindende nicht zu folgen vermögen. Vielmehr muss er sich zuerst überlegen, ob er mit der Festhaltung des Ereignisses an sich die Betrachter bloss vor eine Aufgabe stellen will, oder ob er durch die vorwiegende Darstellung, der Wirkung eines solchen Ereignisses den von seinem Kunstwerke Angesprochenen die Aufgabe der innern Bewältigung desselben erleichtern will, um sie so eher auch noch für die Empfindung der verschiedenen Folgen aus den ganz verschiedenen Reaktionsweisen der Beteiligten empfänglich zu machen, weil sie so der grossen Verschiedenheit eher gewahr werden und dadurch die unausweichlichen Konsequenzen auch eher abzuwägen imstande sind. Denn durch das grosse Gewicht, das in der Darstellung darauf verwendet wird, werden auch die Unterschiede weit plastischer und handgreiflicher spürbar als bei einer persönlichen Anwesenheit bei einem solchen Ereignis, wo unsere Sinne zu sehr vom Ereignis selbst gefangen genommen sind, oder dann anderseits viel zu wenig in Anspruch genommen werden – wie es bei nebensächlichen Kleinstereignissen der Alltäglichkeit gewöhnlich der Fall ist –, als dass die daraus hervorgehenden Wirkungen überhaupt noch erkenntlich würden.
Um diese innere, menschliche Verarbeitung eines Ereignisses auf einem Bilde festzuhalten, muss ja der jeweilige Zustand der Beteiligten, sowohl als auch die fernere Wirkung auf ihre Wesensart in einer Darstellung verdeutlicht werden können. Der momentane Zustand ergibt sich aus der Darstellung der leiblichen Sphäre zumeist genügend. Denn der Gebrochene wird auch in all seiner Stellung gebrochen erscheinen und der Erfreute in all seinen Gliedern den Ausdruck freudiger Erregung verraten. Aber die Folge kann ja nicht – einem Film vergleichbar – einfach ablaufen. Wie also wäre sie darzustellen? Am ehesten in der Umgebung der dargestellten Personen! Denn: wie eine jede Person all ihre Ansichten und Einsichten stets mit sich führt und aus ihnen durch den Verlauf der Gegenwart die Gefühle empfindet, die sich aus all dem bisher Verarbeiteten angesichts des aktuellen Vorfalles ergeben, so hat ein jeder Mensch eine seinem Wesen entsprechende innere "Landschaft" stets um sich herum, die er sehr wohl zu verspüren imstande ist, wenn ihn nicht gerade äussere Vorkommnisse daran hindern.
Dass dem so ist, erfahren nicht nur die Verstorbenen, welche einer äusseren Gegend fortan entbehren müssen, und dennoch wie in einer Gegend sich vorkommen (wie alle reanimierten Personen mit Rückerinnerung an das im Jenseits Geschehene angeben), sondern auch stark traurige Personen, die trotz schönem Wetter alles düster und schwarz bis fast zur Unkenntlichkeit empfinden, oder dann auch wir selber, wenn wir plötzlich und oft ohne äusseren Anlass uns in einem Walde oder auf einem Berge fühlen, oder in einer grossen Stadt, die wir nicht kennen, obwohl wir uns an einem ganz vertrauten Ort befinden, wie zum Beispiel zuhause oder in der Arbeitsstätte. Oder wenn wir das Gefühl haben, dass die Sonne scheine, obwohl wir ja sehen, dass der Tag trübe ist etc.
Wie aber ist das im Einzelnen darzustellen möglich, da ja alle die verschiedenen Wesenstypen zusammen auf einem Bilde dargestellt werden, das ja für sich selbst schon eine (natürliche) Landschaft hat? Das ist allerdings keine einfach zu lösende Aufgabe – und wäre sie es, so wäre es keine Kunst! Aber unlösbar ist sie dennoch nicht. Was ist beispielsweise leichter, als den Insichgekehrten bei einer äussern Szene vor sein Haus, vielleicht trefflicher noch vor den Eingang seines Hauses zu platzieren? Denn dorther muss er ja kommen, wenn er in sich gekehrt ist, da im äussern Handel und Wandel kein In-sich-gekehrt-Sein liegen kann. Den Weltgewandten aber vor die Welt zu stellen, wie sie sich zeigt aus all dem Vielen, das die Menschen erzeugen. Den Naturverbundenen vor oder in ein Stück Natur – und sei es auch nur der Zweig eines Baumes. Den Sinnlichen zum Gegenstand seiner Sinnlichkeit, den Nüchternen vor oder bei seiner Arbeit oder mit einem Werkzeug oder sonstigem Emblem seines Berufes etc. All die vielen innerlich Leeren aber entweder vor den Horizont (ihrer Zerstreuung) oder vor das im Bilde dargestellte Ereignis, so dass sie der Betrachter von hinten sieht. Denn die gemüts- und geistleeren Menschen sind es, die jeder innerlichen Betrachtungsweise am meisten entgegenstehen, aber in ihrer Gesamtheit zugleich den weiten Horizont der Zerstreutheit in die Welt bilden, welche in der Vielfalt ihrer Erscheinungsformen dem wahren. Geist der Liebe und Hinwendung gegenüber denn auch immer mehr oder weniger profillos oder flach erscheinen muss, gerade so, wie ein Mensch von hinten anzusehen ist.
Überall dort aber, wo sich die Übereinstimmung der Umgebung mit der Gemütsart des Dargestellten nicht bewerkstelligen lässt, können dennoch durch die ganz sachte, fast unbemerkte Betonung gewisser Gegenstände seiner Umgebung Hinweise dazu angedeutet werden. Und vor allem liegt in der Farbe – oder besser der Färbung – der Umgebung ein nahezu sicherer Anhaltspunkt über die Gemütsart des Dargestellten vor. Denn nichts färbt die Dinge so sehr wie die verschiedenen Gemütslagen der Menschen.
Selbstverständlich bewegen wir uns mit dieser Darstellungsweise schon inmitten grosser Kunst. Denn: es erheischt ja auch die Darstellung des äussern Bildes eine folgerichtige Licht- und Farbverteilung und die Nachbildung von Dunkelheit und Schatten gegenüber dem vollen Licht. Und zudem dürfen ja – wie bei allen seelischen oder gar geistigen Darstellungen – nicht deutlich erkennbare oder gar offen-sichtliche Zeichen gesetzt werden, sondern – allem Lebendigen und darum im Flusse Befindlichen entsprechend – nur Tendenzen spürbar gemacht werden.
Aus dem bisher Beleuchteten erhellt aber anderseits auch unzweideutig, dass ein jedwedes, blosses Landschaftsbild (ohne Menschen darin) ganz speziellen Gemüts- oder gar Wesenslagen entsprechen muss. Deshalb ist auch der blosse Landschaftsmaler insoweit ein Künstler, inwieweit er versteht, die verschiedenen, ihr entsprechenden Möglichkeiten innerer Wesensgestaltung einer von ihm dargestellten Landschaft anzudeuten. Denn mit der alleinigen Auslese einer zu malenden Landschaft lässt er nur die entweder von ihm empfundenen oder aber die von ihm herbeigesehnten innern Gefühle und Zustände erkennen, und der Betrachter weiss ohne weitere Andeutungen nicht, was allenfalls in einer solchen (Gemüts-)Landschaft alles für Möglichkeiten und Aussichten liegen; sieht mithin also nur eine Kopie der Natur, nicht die Aussage ihres Inhaltes für den Maler und durch ihn auch für den Betrachter. Er wird innerlich nicht mehr geweckt oder gar angesprochen als von der Natur selbst. Er weiss das Bild weder zu deuten, noch weniger seine Aussagen zu nutzen. Und dafür braucht er kein gemaltes Bild, dazu genügt die Natur selbst! So wird beispielsweise in einer flachen Landschaft die Sonne eher aufgehen und auch später untergehen als in einem Gebirgstal. Der Tag währt also länger. Die Sonne wird gewisserart alltäglicher und damit – dem Gefühle nach – entbehrlicher. Ein Sonnenaufgang in einer flachen Landschaft entspricht also eher der anfänglichen Aufnahmeperiode eines vorzeitig entwickelten Intellekts – im Gegensatz zu einem Sonnenaufgang in einem Bergtale, bei welchem – seinem Wesen entsprechend – erst die Verarbeitung tiefer Erlebnisse einen Aufgang der (Erkenntnis-) Sonne ermöglichen. Die Schatten sind im Flachland beim Aufgange unendlich lange, kaum überschaubar, jedenfalls nicht einladend, ihre Begrenzung zu suchen und zu finden – entsprechend dem früh geweckten Verstande eines Menschen, dessen Liebe noch keine Schutzwälle gegen die Ausuferungen um ihren Verweilkreis hat erheben können, aber dadurch auch kaum die nötige Stärke erlangen konnte, das Negative einer erkannten Sache zu erkennen und seine endliche Einwirkungsgrenze im eigenen Gemüte zu überschauen oder gar zu bemessen. Die äusseren Ereignisse wiegen der noch fehlenden innern Konsistenz der Seele gegenüber viel zu stark, sodass ihre Aufnahmefähigkeit und damit auch das Bild ihrer Gemütslandschaft ebenso zu verflachen beginnt wie die aus einer solchen Landschaft resultierenden Gefühle, wo dann Land und Wasser nicht mehr überall klar getrennt werden können, sodass Sümpfe entstehen – anstatt Bäche und Wiesen.
Dessen ungeachtet aber stellt dann beispielsweise ein Baum – der Ebene einer Landschaft entwachsen – ein Ereignis dar, das, wenn es näher betrachtet oder auf der Leinwand auseinandergesetzt wird, die Möglichkeit der Gegensätzlichkeit des Individuums zu seiner Umgebung verdeutlicht, welcher Gegensatz, wenn er aus dem Verstande herrührt, auf einem Bilde für sich alleine dargestellt werden muss (also nur ein einziger Baum), während wenn er eher aus dem Grund eines Sehnens der Liebe – durch die unangenehm gefühlte Zerstreuung hervorgerufen – erwächst, durch das Umstandensein von weitern, andern (Erkenntnis-) Gewächsen in einem Bilde dargestellt werden müsste, was dann dem Betrachter verdeutlichen würde, dass selbst in der grossen Zerstreuung des Verstandes die Liebe Lebendiges zu sammeln und um sich zu scharen fähig bleibt, sodass das in ihr Gesammelte mit der Zeit auch einmal zu einer eigenen (Gemüts-) Welt zu werden beginnt – wenn auch mitten in der Fläche einer äussern Landschaft (also noch umgeben von Gefühlen der Zerstreuung).
Es versteht sich von selbst, dass alle solche Motive im Frühling oder auch im Sommerkleid gestaltet sein müssen, sollen sie den vorher besprochenen Inhalt verdeutlichen. Im Herbst hingegen gliche eine solche Darstellung eher einer vorläufigen Bilanz einer solchen, vorher betrachteten Entwicklung, wenigstens solange die Blätter bloss bunt, aber noch nicht abgefallen sind. Mit kahlen Zweigen in einer kahlen Landschaft wiederum würden solche Bäume oder Baumgruppen eher der Vereinsamung solchen Bemühens gegenüber der übrigen Welt entsprechen, die einer solchen innern Entwicklung einiger Wenigen folgen kann, ja folgen muss, die dann einen derartigen Druck durch diese bloss äussere Erkenntnis darstellt, dass der Erfolg bezweifelt werden muss, wohingegen eine mit Schnee bedeckte Baumgruppe in einer verschneiten Landschaft zwar auch das vorläufige Ende einer solchen Entwicklung andeuten könnte, wo aber durch den alles vereinenden Eindruck des Schnees der sanfte, in seinem Wirken kaum erkennbare Schutz einer Vorsehung angedeutet wird, unter deren Walten in aller Stille sich die Kräfte zu erneuter Wirksamkeit sammeln.
Eine weitere Möglichkeit der Andeutung einer beginnenden Sammlung des Lebens in der grenzenlosen Zerstreutheit einer Fläche wäre eine sachte Erhebung jener Stelle, auf welcher ein Baum oder gar eine Baumgruppe steht. Sie deutet bereits einen förmlichen, innern Drang zur Abwendung vom Vorhandenen an, eine Sammlung oder Konzentration der Kraft um einen lichten Gedanken (dann wohl am besten durch bloss einen einzigen Baum dargestellt), oder um bestimmte Gefühle, die als Reaktion auf die Einwirkung der Zerstreuung zustande gekommen sind (dann wieder eher als Gruppe kleinerer und grösserer Gewächse).
Bei schon fortgeschrittenerer Entwicklung aus einem solchen Ungrund blosser Äusserlichkeit zu innerer Sammlung dürfte gar nur noch die sachte angehobene Wölbung der Erde mit ihrer Baumgruppe dargestellt sein, wo dann das Wesen der Fläche, aus welcher sie entstand, nurmehr in der Weite des Horizontes angedeutet bleibt.
Strassen oder Wege in einer solchen Landschaft braucht es keine. Sind sie dennoch gemalt, so deuten sie eher auf die Nutzlosigkeit solchen Fortschrittbemühens. Denn in der Ebene zu einem Ziel zu gelangen braucht es keiner gebahnten Wege, weil das Ziel – aus einer solch endlosen Ebene heraus zu gelangen – nicht im Fortgang, sondern eher in der Konzentration auf das eigene Wesen zu suchen ist, in der Sammlung also, gepaart mit der Hoffnung auf eine erhöhte Sicht der Dinge und auf einen Abstand zum zwar sattsam Bekannten, jedoch noch nicht Überwundenen, das weder erhebend noch erlösend wirkt.
Wege braucht es vor allem in der oft gefährlich steilen und wenig übersichtlichen Bergwelt. Und wer sich an einem Weg erfreuen will, der findet seine Freude wohl nur dort. Denn dort erst kann er wirksam zu uns kommen und uns weiterführen.
Im Gegensatz zum Bild der Ebene kann das Bild eines Bergtales den Folgen allzu grosser, eigenliebiger Abschirmung entsprechen – besonders dann, wenn die Wände kahl und schroff sind. Ein solches Tal versinnlicht auch die relativ späte Erkenntnisfähigkeit solcher eher instinktiv und sinnlich handelnder Personen durch die Tatsache des späten Erscheinens der Sonne am Firmament eines solchen Tales und ebenso auch durch das rasche Verschwinden dieser Sonne hinter den hohen Bergen – entsprechend den errichteten Schutzwällen aus Sorge um das eigene Wohl.
Aber dasselbe Bergtal kann anderseits auch den äussern, allzu verschachtelten Verhältnissen einer zu blossem Egoismus verkommenen Gesellschaft – ob in Familie oder Staat – entsprechen, die das dadurch tangierte einzelne Individuum recht feurig und innig auf bessere Zeiten und Zustände hoffen lässt. Dabei muss sich aber – ob die Bergflanken kahl und steil oder schon leicht bewachsen und zugänglicher sind – die grosse Erwartung der darin sich Befindlichen im Hinblick auf das Erscheinen der Sonne – oder aber der grosse Dank über die bereits erschienene Sonne – aussprechen oder fühlen lassen, gleichgültig in welcher Art auch immer dargestellt – ob durch Form oder Farbe.
Es sind dort die Schatten denn auch kürzer und gediegener, wie ja anderseits auch der entsprechende seelisch-geistige Zustand grosser und konzentrierter Hoffnung und grosser Liebe zur Wahrheit, die auch dem Nächsten dienen will, alle Nachteile falscher oder unüberlegter Handlungsweisen schnell und effektiv erkennen lässt.
Es zeigen die Höhen und Tiefen eines erweiterten Landschaftsbildes im Allgemeinen den Wechsel im Leben eines Menschen. Dabei zeigen die Berge die Höhepunkte seiner innern wie auch äussern Tätigkeit und daraus resultierender Erkenntnisfähigkeit und die Täler entsprechen den Sammelbecken der sich bei solcher Tätigkeit zu sehr zerstreuenden Seele, wie es entsprechend die mannigfachen innern und äussern Leiden und Notstände des irdischen Menschen darstellen – wenigstens dann, wenn er sie demütig annimmt, anstatt ihnen auszuweichen versucht in die Ebenen der natürlichen Weltlichkeit, die weder die Liebe sammelt und konzentriert, noch die Seele erweichen kann durch eine aus Liebe bedingten Reue, die wiederum gleichkäme einem Tale der Not. Denn: eine sich in aller seichten Weltlichkeit gefallende Seele ist allzu sehr eingebildet und eigenliebig und dadurch zu einer Reue ohne äussere Not unfähig.
In einer solchen Landschaft braucht es eher gebahnte, sichere Wege von den Höhen zu den unvermeidlichen und notwendigen Tiefen der innern Sammlung, damit wir weder auf den Höhen, verhungern, noch in die Tiefe stürzen, sondern aus der Höhe lichtvollster Erkenntnisse dennoch wieder sicher und gesund zur Tiefe der alles befruchtenden Demut gelangen, die alleine uns fähig hält, immer noch Neues und Höheres zu fassen und das schon Erfasste zu festigen in der Erkenntnis, dass nicht wir selber die Höhen sind, sondern dass wir nur die Höhen eines viel Höheren (Gott) betreten können, dessen von uns ersehnte Nähe uns einstens auch eine gleichzeitige Tiefe auf solcher Höhe sichert, dass wir sie nicht mehr als Druck oder Zug zum Hochmut hin empfinden können und müssen, sondern in unserer eigenen dankbaren Tiefe richtig verstandener Demut als unsere Sammlung im Hohen empfinden können. Und dazu einen gebahnten Weg zu erschauen, ist im Leben noch viel trostvoller als in einem Bilde, in welchem wir aber dennoch durch solche Entsprechungen tief von ihm angerührt oder berührt werden können.
Es gehört aber ebenfalls zum Wesen wahrer Kunst, in fast allen Erscheinungen jeweils auch eine gegenteilige Aussagekraft zu finden und sie dann auch ausdrücken zu können. So lässt beispielsweise Robert Zünd, der geniale Schweizer Maler, die beiden Jünger mit ihrem (noch unerkannten) Herrn zusammen in seinem Ölgemälde "Der Gang nach Emmaus" ausgerechnet durch eine ebene Landschaft gen Emmaus pilgern. Ja, es wäre geradezu grotesk, diese Gruppe im Gebirge darzustellen. Und zwar nicht etwa deshalb, weil zwischen Jerusalem und Emmaus kein Gebirge vorhanden sein könnte. Es wäre nämlich selbst beim Vorhandensein eines solchen viel eher angezeigt, zumindest das darzustellende Wegstück in eine relative Ebene zu verlegen. Und das aus innern, entsprechenden Gründen: Menschen, die durch grosse Ereignisse (in diesem Falle die Kreuzigung ihres Meisters und Herrn) aufgerüttelt wurden, deren Wucht sie nicht zu verkraften vermögen, sind nach einem solchen Erlebnis immer etwas flach in ihrem Gemüte, weil der bisher vorhandene Sinn des Lebens und ihre Liebe zu ihm durch das Ereignis zu sehr strapaziert worden sind, als dass sie sich so schnell wieder sammeln können. Kommt dann aber in einem solchen Zustand der Trost folgerichtiger, in der Liebe gegründeter Erklärungen, so sammeln sich die zerstreuten Begriffe einer derart überfordert gewesenen Seele schnell wieder zu den alten, lebendig gebliebenen Bäumen des eigenen früheren Verständnisses und diese säumen dergestalt den noch fernerhin zu durchschreitenden Pfad, der natürlich in Gegenwart des auferstandenen Herrn – also auch in Gegenwart unbezwingbarer Liebe – ein völlig ebener sein muss. Eben gerade so, wie es Zünd in seinem "Gang nach Emmaus" dargestellt hat.

Dass die Sonne (des Geistes) dabei scheint, wird wohl kaum zu erklären nötig sein. Eher noch der Umstand, dass die zwei Jünger mit ihrem Meister gerade im Schatten wandelnd dargestellt sind. Aber, wenn wir bedenken, dass die beiden Jünger vom grellen Licht der leiblichen Gegenwart Gottes in Christi Gestalt – vor seiner Kreuzigung – her kommen, von welcher sie eben durch den Tod ihres Herrn am Kreuze getrennt worden sind, so erweist sich diese beschattete Stelle ihres sonst wohlerleuchteten Weges als die am besten ihrem momentanen inneren Wesen entsprechende. Dass aber unmittelbar vor ihnen der Weg wieder von der Abendsonne beschienen ist, ist ja eben die sinnlich verdeutlichte Folge der Gegenwart des Herrn. Das ganze Bild zeigt zudem deutlich, dass Gott besonders denen – wenn auch unerkannt – nahe ist, die sich trotz all ihres Mühens nicht zu ihm hin versetzt fühlen, und das besonders zu jener Zeit, da Menschen Not (Licht- und Wärmemangel – entsprechend Erkenntnis- und Liebemangel) leiden. Eine Tatsache, die dem heute Gott vergessenden oder gar negierenden Menschen beinahe völlig fremd geworden ist!
Dass der Himmel, das heisst entsprechend die Gefühle des Gemütes, in solchen Situationen nicht wolkenlos ist, liegt auf der Hand. Aber die Wolken sind licht und weiss, zur Abendzeit auch zart rosa oder rosagolden gefärbt. Sie sind nicht Bedrohung, sondern sichtbares Zeichen der Segenfülle Gottes, der durch sie der Erde das so notwendige Hoffnungswasser der Liebe zukommen lässt, welches alle Vertrauens- und Liebeserkenntnisse im Gemüte eines Menschen wachsen lässt, wie der Regen die Pflanzen. Die grosse, fast unfassbare Detailtreue der Bilder Zünds wie auch anderer grosser Meister dieser Geistesrichtung, die dennoch der Natürlichkeit und Lebendigkeit nicht den geringsten Abbruch tut, ist nicht, wie viele kunst- und geistlose Kritiker glauben, eine blosse Kopie der Natur – kann es nicht sein bei solch immensen geistigen Entsprechungsaussagen. Vielmehr ist solche Detailtreue der Ausdruck eines demütigen Willens, sich auch nicht über das Kleinste hinwegzusetzen, sondern bestrebt zu sein, allem gerecht zu werden, ohne dabei von der Herrlichkeit und Harmonie des Ganzen etwas zu verlieren.
Es ist ja nicht das die wahre Kunst, das eine auf Kosten anderer herauszustellen, wie es etwa die heutige, selbstsüchtige Werbung tut, sondern das ist die wahre Kunst des Lebens – wie der Malerei –, dem Herauszustellenden in einer jeden Kleinigkeit wieder zu begegnen und es dort auch zu begrüssen, um damit dem Ganzen auch in jedem Detail zu dienen. Solche Kunst ist das grosse Gegenteil zur Art und Weise der Welt, die von allen, die dieser Welt dienen, nur deshalb oft geflissentlich verkannt wird, weil ein jeder die Mühe scheut, in den vielen Brüdern Gott zu dienen und stattdessen viel lieber sich von seinen Brüdern und – wenn es möglich wäre – gar von Gott in seinen Ansichten und Zielen dienen zu lassen. Alle vor der Welt grossen Geister neigen zu einer solchen Haltung, und noch fast mehr die Kleinkarrierten, die sich nicht einmal mehr von einer von andern herrührenden guten Idee dienen lassen wollen, weil das ihrem Empfinden nach zu sehr ihr eigenes Ansehen schmälern könnte. Christus ist davon das blanke Gegenteil; er sagt aber auch aus, dass das vor der Welt Grosse vor Gott ein Gräuel sei. Weil das Grosse im Äussern das Innere verkümmern lässt, während das Grosse im Innern jede Äusserlichkeit belanglos werden lässt.
Wer sich über das Geringste willentlich achtlos hinwegsetzt, der setzt sich damit über die Liebe, die es schuf, hinweg und kann daher der Liebe und damit auch dem Grossen und Ganzen unmöglich mehr dienen – also auch nicht mehr dem Durchbruch wahren Lichtes und wahrhaftigster Wärme in seinem kleinsten Selbst, das ebenso zum Ganzen gehört wie alle anderen "Selbst" auch. Wäre diese Erkenntnis in den Künstlern und Lehrern aller Zeiten so sehr wach und ihnen auch bewusst geblieben wie Zünd und seinen Geistesgenossen, so hätte es nie Religionskriege, ja zuvor nicht einmal Glaubensspaltungen gegeben, noch weniger Inquisition und Verdammung. Denn diese Ansicht erst ermöglicht es ihren Bekennern zu erkennen, dass dieselben zwei Möglichkeiten, welche die Welt im Tage und in der Nacht kennt, schon ein jedes kleinste Wesen in sich selber trägt, wenn es auf der einen Seite das Licht – anstatt in sich aufzunehmen – bloss widerspiegelt zur Erhöhung des Glanzes vor der Welt, aber dafür auf der entgegen gesetzten Seite die Nacht nicht nur in sich selbst, sondern auch in den andern dadurch verbreitet, dass es mit seinem eigenliebigen Wesen einem Nächsten vor der lichtvollen Durchsicht und damit vor der Entfaltung seines Wesens und Lebens steht.
Und nur wer dieses erkannt hat – vorab an sich selbst – und dann natürlich auch an allen andern, der weiss, dass er dem Ganzen nie zu dienen vermag, wenn er es nicht im Detail – und vorab an sich selbst – tut. Wie viele grosse gesellschaftspolitische Gedanken und Ideen – und heute die ganze Technik – haben doch in der Weltgeschichte das Kleine und Harmlose sowohl in der Natur wie im Menschen und seiner Gesellschaft zertreten und dadurch eine gedeihliche Entwicklung gestört! Das ist dann der Zustand, wo ein Grosses sich wider das andere erhebt, sodass die Täler der Not enge werden und das Leben der noch freien Menschen bedrohen. So, wie wir es auch in der Kunst erleben, deren bloss äusseres Verständnis sich noch stets zu einem Stil erhoben hat und deren Stile dann in chronologischer Reihenfolge seit schon längerer Zeit stets nur den Zerfall – selbst des einmal Gross gewesenen – erkennen lassen, anstatt einen Aufbau im Kleinen zum Wohle des Ganzen.
In früherer Zeit und auch noch zu Beginn der Ölmalerei war der Glaube an Gott und das Weiterbestehen des Individuums über die Zeit hinaus nicht nur ein zentraler Punkt menschlicher Überlegungen, sondern – etwas despektierlich ausgedrückt – zum Stil menschlichen Lebens und menschlichen Schaffens erhoben worden. Als Stil kann ja nur eine Aussage ein veräusserndes Bild gemeint sein – ohne jedwede Verbindung zu innerlichem Gefühl und Empfinden. Denn würden die Menschen nach ihrem innerlichen Gefühl und Empfinden reden und aussagen, so gäbe es niemals eine förmliche und dadurch stilisierbare Übereinstimmung – und die meisten hätten wohl gar nichts zu sagen, weil ihnen Gefühl und Empfindung fehlen oder – besser gesagt – sich die meisten ihrer innerlichen Gefühle und Empfindungen nicht bewusst sind und auch nicht bewusst werden können, weil sie erstens keine Zeit und Lust haben, auf sie einzugehen und sie zweitens im gesellschaftlichen Leben, das ein rein äusseres Leben ist, nur sehr schlecht gebrauchen könnten.
Wohl mag vor allem auch bloss die Not und Drangsal des damaligen Lebens den einen oder anderen gewöhnlichen Menschen schon auf ein künftiges, ewiges Leben hoffen gelassen haben, auf welcher Hoffnung dann auch der Glaube Einzelner gegründet gewesen sein mag. Aber die offiziellen Handlungen und alle äussern Gebräuche, die einen solchen Glauben verdeutlicht haben könnten, waren nicht aus eben solchem Hoffnungsglaube gewachsen, sondern aus dem Diktat oder der Diktatur des herrschenden Systems des Verstandes sowohl in jedem Einzelnen alsdann natürlich auch in den Gesellschaften. Ein Beispiel aus der heutigen Zeit zeigt das deutlich: Heute ist es üblich geworden, in allen Redewendungen und erst recht in allen schriftlichen Aussagen über Berufsleute, aber auch in allen Gesetzen speziell des weiblichen Geschlechtes zu gedenken, wenn auch nur der sprachlichen Endung nach (-innen), gerade so, als ob es sich dabei nicht mehr um Menschen handeln würde – denn Berufe und Gesetze, die das berufliche oder auch nur das menschliche Zusammenleben ordnen sollen, sind doch stets nur für Menschen gegeben, und ein Schreiner oder Maurer und überhaupt alle Berufsleute sind doch vor allem Menschen, gleichgültig welchen Geschlechtes!! Und dennoch hat die heutige überbordende, bloss äussere Verstandeskultur einen solch idiotischen Stil aus der Tatsache entwickeln können, dass es unter den Menschen zweierlei Geschlechter gibt. Nur solch tote Verstandesformeln sind es, die einen so genannten Stil begründen, auch damals, als eine jede Handlung als zur Ehre Gottes gefordert oder aber proklamiert worden war. Das war nicht nur bei den Politikern so, sondern in noch viel krasserem Masse bei der Kirchlichkeit. Ob es sich um Lehre, Mahnung, Gesetze oder die Strafe und Verdammung handelte, immer war es zur grösseren Ehre Gottes dem Wortlaute nach und zur grösseren Bereicherung mit Macht oder Geld der Gesinnung nach. Die grössere Ehre Gottes, welche die Kleinen nicht verstanden hatten und welche die Grossen dieser Welt zu eigennützigen, ja zu himmelschreienden Taten der Selbstsucht gebrauchten, war zum Stil und damit zur Diktatur einer sehr langen Zeit geworden!
Was Wunder, dass die ersten Ölbilder auch vor allem dieses Thema zum Inhalt hatten. Die Art der Darstellung entsprach dabei auch der Art der Ausführung: Eine jeden lebendigen Gefühles bare und im Leben niemals erprobte, aus hirnverbrannten Verstandesgrübeleien gewonnene Ansicht stellte die als tot oder geschnitzt wirkenden Figuren – so plastisch sie auch gemalt sein mochten – konform ihrer verdrehten Sichtweise in Beziehung zueinander. Alle Figuren wirkten dem Erleben des Betrachters nach einzelgestellt, materiell und tot – wie die toten Glaubenssätze –, selbst dann, wenn sie der figürlichen Handlungsaussage nach noch so deutlich miteinander in Verbindung standen, gewissermassen miteinander zu leben hatten. So hatten selbst noch Rembrandts Engel ein empfundenes, statisches oder physisches Gewicht, das eher jenem von Bleifiguren ähnlich sein mochte, als demjenigen eines lebenden Menschen geschweige denn eines geistdurchfluteten Engels (z.B. in der Radierung: "Der Engel verlässt die Familie des Tobias"). Das Äussere, das Gesetz, die Materie, also das äussere Tote, das waren die Grossen der damaligen Zeit und wurden in allen Arten von Aussagen – ob Musik, Bild oder Schrift – zur Hauptsache. Jene, die sich in ihrem Schaffen weniger stark von kirchlichen Dogmenaussagen leiten liessen, malten aus dieser

Radierung von Rembrandt: "Der Engel verlässt die Familie des Tobias"
Geisteshaltung heraus dann aber dennoch bloss nur die Materie – statt das Leben – von Natur und Menschen.
Das Gemüt oder die dasselbe belebende Kraft der Liebe schlief eben noch fest im Menschen, soweit es nicht etwa schon durch die Unvernunft des ohne Gefühl verwendeten Verstandes völlig flach und zertreten war, und konnte deshalb auf die Bilder keinen Einfluss nehmen – sowohl der Entstehung, wie der Betrachtung nach. Alles war formelhaft. Was schön war oder schön sein musste, das hatte zum Beispiel griechisch zu sein – oder dann wenigstens ein Kreuz zu tragen, irgendwo und irgendwie. Anderes konnte und durfte nicht schön sein. Vor allem lag das Schöne immer in der Form oder der Formel, und nie im Inhalt oder der Harmonie des Lebens. Alles, was dargestellt wurde, war gut – oder dann eben schlecht –, aber nichts hatte Tendenzen und noch viel weniger hatte es Neigungen und Spannungen, nichts liess eine Entwicklung – als Indiz des Lebens – erkennen. Selbst Schlachtenbilder hatten, soweit sie nicht überhaupt bloss statisch – durch Massierung von Macht und Materie – dargestellt wurden, nur eine äussere Bewegung. Innerlich waren alle unbewegt, vorab die Figuren und der Maler, aber in der Folge auch der Betrachter. Die Formel lautete: Die grössere Macht ist die Übermacht. Damit waren auch die Folgen als Resultat bereits bestimmt: Übermacht war das Ziel solchen Denkens.
Gefühle gab es in diesen Bildern nicht – weder des Hasses, noch weniger der Liebe oder gar des Elendes der vielen Einzelnen. Der Grundzug solcher Bilder ist die Herrlichkeit; und dabei spielt das Elend – auch von Abertausenden – keine Rolle, es ist vernachlässigbares Beiwerk für den Pracht- und Herrlichkeitssüchtigen ebenso, wie für den solcher Äusserlichkeit huldigenden Verstand oder für die in diesem Geiste malenden Künstler, welche zwar zu selbiger Zeit die Detailtreue – wenigstens im materiellen Sinne – sehr weit trieben, aber dafür im eigenen Leben nicht einmal die dasselbe bedingenden Kräfte und ihre Zugrichtung ahnen, geschweige gar wahrnehmen und erkennen und noch weniger darzustellen fähig oder gar willens waren.
Mit der Zeit mögen ja nach und nach immer mehr Maler auch die Eindrücke und Empfindungen in ihre Bilder hinein gemalt haben. Aber in so düsteren Zeiten waren diese wohl auch eher düster und tragisch, soweit nicht die Jugendlichkeit noch hin und wieder Gefühle der Lust hineingemischt hat. Nichts gegen die Detailtreue der vielen gemalten Leiber der Menschen. Aber die Betonung dieser Details gibt den allermeisten solchen Bildern die Schwere. Das Gefühl der Schwere der Leiblichkeit war einerseits sicher Empfindung – in der Not der Zeiten begründet. Viel mehr aber mag das stete und einseitige Eingehen auf die Bedürfnisse und noch mehr auf all die Regungen des Leibes – anstatt die ebenso starken Bedürfnisse und Regungen des Geistes – der Grund der dannzumaligen Empfindung gewesen sein. Wer im eigenen Leben derart auf seinen Leib eingeht, der wird, ja, der muss es ja dann auch im Gefühl tun bei der Anschauung des Leibes in der Natur – als Folge dessen dann aber auch auf der Leinwand.
Eine seelisch-geistige Betrachtungsweise des ganzen Lebens liesse zwar für die Detailtreue im Äussern ebensoviel Raum, würde aber all diesem Leiblichen viel weniger Gewicht gewähren, indem es in Form, Farbe und Bewegung vielmehr auf das Inhaltliche des Menschen abzielte.
Eine herrliche Illustration zu dieser Behauptung ergibt sich aus Franz von Defreggers Ölgemälde "Die Kraftprobe", wo eine Gruppe von Menschen einen Burschen umsteht, der versucht, einen riesigen Stein zu heben. Wie der Maler dabei die Arme und das bei der Tiroler Lederhosentracht um das Knie herum freie Bein des Gewichtshebers darstellte, lässt auch für den sinnlichsten aller nur möglichen Betrachter seines Bildes nichts zu wünschen übrig, ja sie stehen – als die unmittelbaren Auslöser dieser Kraftprobe – sogar unter dem Diagonalkreuz seines Bildes. Aber Spannung und Leben strahlen viel eher aus den ihn Umstehenden, indem der Heber eigentlich erst so recht in der Stellung zu seiner spätern Probe sich befindet, ohne dass er sie bereits vollführt. Wie wir eingangs – bei der Erklärung über die Bildaussagemöglichkeiten – gesehen haben, charakterisiert, nebst ihrer Haltung und Physiognomie, der Standort, die Umgebung sowie die Farbe sehr gut das innere Wesen der im Bilde Dargestellten.

Betrachten wir diese, so fällt uns vor allem der Handwerker – der Schmied – auf, wie er voll Spannung und stets bereit, zu helfen, dem Kraftprotzen tatkräftig am nächsten steht. Seine Arme hält er angewinkelt, seine etwas verkrampften Finger lassen die innere Anteilnahme am Gewicht der Aufgabe, den Stein zu heben, erkennen. Seine Stellung verrät die Bereitschaft seines ganzen Wesens, im Falle eines Missgeschickes beim Hebeversuch irgendwie behilflich zu sein. Der Zweitnächste zum Hebenden ist der hinter ihm Stehende. Er hält seinen Kopf etwas sinnierend gesenkt, während er an seiner Pfeife zieht. Er wägt eher die Gefühle und die gefühlsbedingten Konsequenzen einer gelungenen oder auch einer misslungenen Probe ab. Deshalb auch sein gemüthaftes Lächeln im Gesicht. Er weiss gewisserart, dass eine solche Probe für solche Menschen einmal sein muss, und erwägt eben die mögliche Wirkung auf Gemüt und Fortentwicklung solcher Menschen – freilich weniger sich dessen voll bewusst, als vielmehr in der gemüthaften Anteilnahme, die in ihm Erinnerungen an eigene solche Kraftstücke in seiner Jugend wach ruft. Fast alle andern stehen etwas weiter entfernt um den Kraftprotzen herum, insbesondere die beiden Männer vor dem gähnenden dunkeln Loch zur Schmiede hin – als der Werkstätte des äusseren Lebens, entsprechend dem Verstande des Menschen. Die Feder auf ihren Hüten erscheint viel höher aufgerichtet als jene auf dem Hut des vorher besprochenen, eher gemüthaft Anteilnehmenden. Das Haupt, besonders des einen, der an seiner Pfeife zieht, ist leicht erhoben, ähnlich demjenigen, der verständig eine Sache in der Ruhe seines Unbeteilgtseins beurteilt. Sie urteilen mit dem Verstande, der als solcher keine Richtung kennt, da er nicht lebendig ist wie das Gemüt aus seiner Liebe heraus, und darum mit erhobenem Kopf das Weite, das Andere sucht und nicht – wie etwa das Herz – die Nähe und das Verwandte.
Die beiden, die vor dem Hebenden stehen, das Kind und der Mann ganz rechts – wohl sein Vater –, gehören zu jenen gemüts- und geistleeren Menschen, die trotz allem Nahestehen bei einem Ereignis kaum je wissen oder auch nur erahnen, worum es (innerlich) geht. Es ist typisch, dass der Alte seine Hände dabei auf seine Knie abstützt, um mit seinen Augen noch näher beim Ereignis sein zu können, bei dem es eigentlich nichts zu sehen gibt – nur viel darüber zu denken. Ebenso typisch ist die Stellung des Kindes, die eher jener eines Erwachsenen oder gar eines Schwerarbeiters gleicht. Denn so geist- und gemütsleere Menschen, die stets nur äussere Ereignisse suchen, weil sich in ihnen selbst kaum je etwas Nennenswertes ereignet, erscheinen – zumeist geflissentlich – schon in ihrer Jugend erwachsen, da ja das Erwachsenwerden ihr einziger Wunsch und ihre einzige Zukunft darstellt, und auch das nur darum, weil es sich aus der Natur schon so ergibt.
Zuletzt steht noch im Vordergrund, ganz links, ein junger, kräftiger Mann, der es abzuwägen scheint, ob er es im Falle des Misslingens der Probe selbst einmal probieren soll. Seine noch jünglingshafte, kraftvolle Stellung und der gespannte Schultergürtel zeigen, dass er jedenfalls noch solche Proben vor sich hat, will er sein Wesen runden.
In einiger Entfernung stehen vor dem Hauseingang zwei Frauen, wohl die Ehefrau und die Mutter oder Schwiegermutter des Schmiedes. Der Ort, vor dem sie stehen, der halboffene Hauseingang, verrät, woher sie kommen – seelisch-geistig gemeint, natürlich. Sie sind in ihrer gemüthaften Häuslichkeit eher mit ihrem gefühlsmässigen Abwägen der Situation beschäftigt, fragen eher nach dem Sinn einer jeden Handlung und ihrem praktischen Wert und verstehen solche äusserlich betriebene Kraftmeierei nicht, so sehr sie sie auch kennen und tolerieren wie der lächelnde Mund der Jüngeren und der verständnisvolle Blick der älteren verraten. Das Kind zwischen ihnen und einem weiteren männlichen Zuschauer, auf einer Bank sitzend, ist in seine Arbeit des Strickens zu sehr vertieft, als dass es wirklich bewussten Anteil an dem sinn- und ziellosen Unterfangen der Männer nehmen könnte. Wie schön, dass die Kinder in ihrer schlichten Natürlichkeit und Einfalt noch vor den Einwirkungen solch eitler Dummheiten in ihr Gemüt bewahrt bleiben, soweit sie nicht geflissentlich danach suchen wie der Knabe im Vordergrund.
Wir ersehen aus diesem Beispiel, wie ungemein viel an vermittelnder Lebenserfahrung einem Bilde zu entnehmen ist, dessen Maler nicht primär das Leibliche sucht, sondern die Beurteilung aller äussern Vorkommnisse in Bezug auf ihre nützliche oder ungünstige Wirkung auf die Fortentwicklung des innern, seelisch-geistigen Menschen. Und das alles ist so frei im Bilde dargestellt, dass es sich niemandem aufdrängt, wiewohl es doch überdeutlich aufgezeigt ist. Es zeigt aber auch, wie eine solche Betrachtungsweise dem natürlichen Detail nicht den geringsten Abbruch tut. Denn besser wäre das natürliche Detail nicht wiederzugeben. Freilich braucht es dazu eben den wahren Künstler, den Innern, den Lebenskünstler, der noch vor seinen Bildern sein Gemüt bearbeitet hat.
Natürlich stellt sich vor allem für die Kritiker der Kunst, als zumeist reine Verstandeshelden, immer wieder die Frage, ob der Künstler das alles wirklich bewusst in sein Bild gelegt hat, was da alles herauszulesen ist. Wird der wahren Entsprechung der Dinge gemäss geurteilt, so kann man diese Frage freilich nur bei den wenigen wirklichen Künstlern – ohne weiteres mit einem "Ja" beantworten. Denn es ist ja vor allem das Gefühl des wahren Künstlers, das ihn zur Tat drängt und nach welchem er seine Werke auch beurteilt. Und dieses Gefühl gibt ihm schon die Sicherheit darüber, ob eine Bildaussage vollständig und rein ist, wenigstens insoweit, als er die Vollständigkeit überhaupt abschätzen kann und die Reinheit des Denkens bereits beherrscht. Ob er es freilich bewusst in dieser – oder eben jener – Form tat, muss offen bleiben, ist aber für den inhaltlichen Wert seiner Aussage ohne Belang.
So lässt sich zum Beispiel von Franz von Defregger sicher sagen, dass ihn generell die mannigfachen Charaktere der verschiedenen Menschen äusserst stark interessiert hat. Das erhellt schon aus der Tatsache seiner vielen, höchst verschiedenartigen Portraits, von welchen ihm jene vom Typ eines "Egger Matzl" (einem unbekümmert dahin vegetierenden und wohl auch dem Alkohol zugetanen Knecht) und ähnlichen sicher weder bestellt noch bezahlt wurden.
 |  |
Defregger "Egger Matzl"
|
Seine Vorliebe war es, zu erkennen, wie bei geselligen Anlässen ein jeder Menschentyp auf die ihm eigene Weise auf seine Rechnung kommt und wie er durch das ihm Zusagende und in sich Aufgenommene eines Ereignisses sich innerlich immer mehr in eine bestimmte Richtung – ob positiv oder negativ – entwickelt. Kurz, wie ein jeder seinem Charakter entsprechend aus ein und derselben natürlichen Kost eines Ereignisses seine ihm zusagenden Aspekte in sich aufnimmt und damit sein Wesen festigt – verhärtend, oder sich verlierend bei negativem Sinn –, oder verständnisvoll aufbauend bei einem positiven Streben.
Wenn er nun eine "Kraftprobe" malt, so wird er – seiner Freude am Erkennen solch persönlichen Entwicklungen entsprechend – nicht versäumen, diese so, wie tatsächlich einmal gemalt, oder dann auch in irgendeiner andern Form sich entwickelnd darzustellen. Er muss dabei nicht eine bestimmte Aussage machen: dass z.B. immer verstandes-betonte Beurteiler dabei sein müssen, oder dass ein Helfen-Wollender dem Akteur näher stehen müsse als der Kritiker. Genug, dass er alle erkannt und bezeichnet hat; denn damit wird er auch einem jeden in der Darstellung gerecht. Welche er aber alle an seinem darzustellenden Ereignis teilnehmen lassen will, braucht er sich im Einzelnen nicht vorher vorzunehmen. Genug, dass er aufzeigt, wie sich am selben Ort jedes Individuum sein seelisches oder geistiges Futter sucht und in seiner ihm entsprechenden und von den andern völlig abweichenden Wesensart dabei zunimmt.
Auf der andern Seite stellt sich natürlich auch die Frage, ob vom Betrachter eines Gemäldes wirklich auch all die vielen Aussagen verstanden und begriffen werden. Das Verstehen ergibt sich dabei einfacher, als man denkt. Wenn wir ein Bild betrachten, und es auf uns einen angenehmen, wohltuenden Eindruck macht, noch bevor wir sein Sujet so recht würdigen können, so sind seine Aussagen mit unseren Ansichten einigermassen übereinstimmend. Denn: ohne dass wir es wissen, ergeben sich aus unseren Ansichten, Einsichten und Vorstellungen auch in uns – als Laien – Bilder und Farben; und wäre es nicht so, woher rührten dann die Träume? Als Laien kennen wir zwar diese Bilder wohl kaum – selbst wenn wir uns an unsere Träume erinnern, weil die Träume ja nur das Ungelöste oder dann das innerlich Aktuelle wiedergeben und nur selten Bilder, wie sie sich aus dem bereits gesicherten Erfahrungsschatz ergeben, darin enthalten sind. Würden wir jedoch die Bilder erkennen, so besässen wir die Fähigkeit, selbst Künstler zu werden. Ist es doch nur die Überfülle solcher bildhaft gewordenen Empfindungen, welche einen Menschen bestimmen kann, zum Mittel der Kunst, als der gehobensten Aussprache- und Mitteilungsform des Geistes zu greifen.
Wenn wir also beim Betrachten eines Bildes – ob in der Natur oder auf der Leinwand – angenehme, wohltuende Eindrücke empfangen, bevor wir uns über deren natürliche Aussagen so recht klar geworden sind, so erkennen wir ganz einfach die Übereinstimmung seiner Aussage mit der uns eigenen Auffassung der Dinge. Ob wir diese Aussagen allerdings auch verstehen, das heisst in ihrer Bedeutung erfassen, das hängt weitgehend davon ab, ob und wie gut wir erkennen und begreifen, was für Bilder über das Leben in uns vorhanden sind und aus welchen Gefühlen sie zustande gekommen sind. Begreifen wir das, so begreifen wir natürlich auch selbstredend den Grund der Übereinstimmung mit dem Geschauten.
Nun gibt es aber Bilder, die uns auf den ersten Blick gefallen und ansprechen, bei näherem Eingehen auf sie dann aber dennoch missfallen. Das sind solche Bilder, deren natürliche und offensichtliche Darstellung mit den darin enthaltenen Entsprechungsaussagen, die in allen Farb- und Formkombinationen ruhen, nicht übereinstimmen.
Würde zum Beispiel in einer herrlichen Abendstimmung einer prächtigen Landschaft – wenn auch nur am Rande oder in des Horizontes Ferne – ein Mord oder eine Schlägerei dargestellt, so würde uns vielleicht die Landschaft auf den ersten Blick eine wohltuende Wirkung vermitteln, die aus der bildhaften Entsprechung mit der gesänfteten und vergeistigten Naturkraft in uns selber entspränge, aber mit dem nähern Eingehen auf das Bild würde uns natürlich dann auch der darin dargestellte Gewaltakt bewusster werden und – als in solcher Stimmung undenkbar möglich erscheinend – die Einheit des Bildes und damit unsere Hingabe an es stören. Es liesse sich zwar fragen, ob denn eine Schlägerei oder gar ein Mord bei einer schönen Abendstimmung nicht geschehen könne. Um es etwas drastisch, aber dafür umso plastischer auszudrücken, sagen wir einmal: "Nein, das dünkt uns schier nicht möglich!" Weil aber die Kriminologie sicher solche Taten in der Dämmerungszeit aufzuweisen hat, muss eine Erklärung folgen, weshalb das – so, wie dargestellt – dennoch nicht sein kann:
Dem völlig natürlichen Auge mag es sich wohl einmal so darstellen. Aber dem geistigen Auge nie! Wenn der Angreifende in Abendstimmung wäre, so könnte er gar nicht angreifen wollen; denn Abendstimmung ist das genaue Gegenteil von Angriff. Es ist das Sich-Hingeben an eine höhere Macht, wohl erkennend, dass die eigene Kraft begrenzt ist. Es ist das Loslassen all seiner zeitlichen Ideen und Vorsätze zugunsten eines Ausgleiches mit dem Unendlichen, dem Ewigen (was nicht verhindern muss, sie am Morgen des nächsten Tages wieder aufzunehmen). Wer das aber nicht kann und auch nicht will, der hat auch keine Abendstimmung. Folglich muss ein wahrer Künstler, der sich stets bewusst ist, dass er in all seinen Bildern, in welchen Menschen in ihrer Handlungsweise dargestellt sind, natürliche Vorgänge mit geistigen Vorgängen darstellend verbindet, im Klaren sein, dass er darum auch beide zugleich als plausibel und wohl möglich darstellen muss. Erst damit kann er auch den Grund zu solchen vom aussenstehenden Betrachter empfundenen Widersprüchen aufzeigen und dadurch die Betrachter seiner Werke in aufbauend-belehrendem Sinne beeinflussen. Er müsste also im geschilderten Fall das Missverhältnis der äusseren Abendruhe zur innerlichen Unruhe in seinem Bilde darzustellen wissen. Er muss entweder das grelle Zornlicht, welches das sonst sanfte Abendlicht übertönt, als den Grund der dargestellten Handlung in seinem Gemälde sichtbar machen, oder er müsste die totale Nacht der geistigen Verfinsterung, in welcher oft solche Taten passieren, als Gegensatz zum sanften Abendlichte darzustellen wissen.
Wie leicht könnte – zur Darstellung des Zornlichtes – auch beim natürlichen Abendlicht ein einzelner, direkter Sonnenstrahl, der irgend durch einen Gegenstand – wie beispielsweise eine Wasseroberfläche – zurück geworfen wird, zu einem förmlichen Feuer werden, das in seiner gleissenden Heftigkeit zu einem grossen Gegensatz zum sonst so mild und gleichmässig verteilten, rötlichen Abendlicht wird. Ein solch äusseres Geschehen wäre ein vorzügliches Entsprechungsbild dafür, wie ein zurückgeworfener oder abgelehnter noch so milder Vermittlungsvorschlag plötzlich und fast ungewollt zu jenem Entschlossenheitsfeuer führen kann, das in seiner Heftigkeit weit über das eigentliche Ziel hinausschiesst und alles, was es trifft, töten oder zumindest schwer verletzen kann.
Wie leicht liesse sich anderseits – zur Darstellung geistiger Verfinsterung – beispielsweise durch ein Dickicht jener Schatten in das Bild bringen, der dem Gestrüpp wirrer, weil nicht von der Liebe geordneter Gedanken entspricht, deren Undurchdringlichkeit und Absolutheit erst eine solche Tat ermöglichen können. Und wie sehr unterstriche auch eine topographische Niederung beim Tatort den geistigen Standpunkt, auf welchem erst ein solcher Lichtmangel komplett werden kann: nämlich die niedrigste Form der Liebe, die reine Selbstliebe – ohne Verständnis, geschweige denn Entgegenkommen für den Andern.
Natürlich verlöre durch eine solche Darstellung der geistigen Vorgänge der Reiz des natürlichen Bildes der Abendstimmung. Aber – in rechten Proportionen dargestellt – würde sie vielleicht manchen bis jetzt an solchen oder ähnlichen Handlungen durchaus unbeteiligt gebliebenen Hitzkopf auf gar sanfte Art spüren lassen, wo seine Gefahren liegen, und ihn dabei erfahren lassen, was alles er mit einer solchen Abgeschlossenheit gegenüber dem Ganzen zerstören könnte, würde sein oftmaliger innerer Ablauf nicht immer wieder durch hellere Gedanken und Gefühle unterbrochen. So könnte das durch und durch wahrhaftige Bild für manch Einen zu einem Evangelium werden – zu einer erläuternden Erklärung darüber, wie dem geschriebenen Evangelium im Leben besser entsprochen werden kann.
Aber auch mehrheitlich ausgeglichene Menschen würden sich bei ein-gehendem Betrachten eines solchen Bildes so mancher Vorkommnisse in ihrem Leben bewusst, wo sie selber – wenn auch nicht handelnd, sondern nur gemütsmässig – sich in einer solchen oder ähnlichen Situation befunden haben. Und dabei hätten sie Gelegenheit, zu spüren, wie ungemein wohltuend und beschützend das milde äussere Licht des Abends auf unser Gemüt wirken könnte, würden wir uns ihm bewusster hingeben.
Aus diesem Beispiel können wir leicht erkennen, dass auch der Laie vorzüglich imstande ist, ein Bild zu verstehen, wenn er es anfangs auch nicht begreift, das heisst: seinen Finger nicht auf die aussagende Stelle legen kann. Aber er kann sich an seinem Bilde – wenn er es erworben hat – täglich erfreuen und im Laufe der Zeit und den verschieden-artigsten alltäglichen Erfahrungen zusammen einen Wesenszug nach dem andern besser erkennen und begreifen und dabei eine Ahnung davon bekommen, wie sehr ineinander verflochten oft Ursachen und Wirkungen – im Grossen wie im Kleinen – sein können.
Auf diese Art wachsen Künstler und Laie an der Kunst. Der Laie in eben beschriebener Weise und der Künstler in der stets grösseren Differenziertheit seiner Erkenntnisse und zunehmend umsichtigeren Art seiner Aussagen. Das ist dann wirklich lebendige Kunst; Kunst, die das unvergängliche, geistige Leben im Natürlichen sammelt und konsolidiert. Wie lächerlich nimmt sich dagegen jene Auslegung des Wesens der Kunst aus, die fordert, dass lebendige Kunst unter der Ausgelassenheit des Volkes und mit seiner aktiven Teilnahme am Produkt oder gar mit seiner innern Zustimmung stattfinden müsse!
Wie würde wohl die Entwicklung der Kinder aussehen, wenn wir die sie gestaltende Erziehung von ihrem innern Einverständnis abhängig machen wollten?! Zuerst muss doch der bei jedem innern, veredelnden Fortschritt auf den ersten Blick unangenehme, weil mühevolle erste Schritt getan werden, ehe man ihn angesichts des nach sich ziehenden Erfolges beurteilen und schliesslich bejahen kann. Und dafür braucht es Vorbilder und Lehrer. Das Vorbild muss der Künstler – durch sein Leben und seine eigene Wesensentwicklung und -gestaltung – sein und als "Lehrer" wirkt dann die Aussage, die er in seine Werke legt, während anderseits die Bestätigung beim Betrachter durch das Leben selber und durch die vergleichende Beurteilung der Gefühle geschieht, welche einerseits beim Betrachten eines Bildes und anderseits im Alltag des Lebens entstehen.
Wenn hingegen der Künstler einige oder auch gar viele seiner Eindrücke, die ihn stark beschäftigen, immer wieder nur auf seine Leinwand bannt, ohne dabei die Absicht zu haben, sie dadurch besser begreifen zu können und sie später umfassender und zusammen-hängender aufzeigen zu können, so bleibt er blosser Diener seiner Sinnlichkeit und lässt dabei seinen eigenen Geist, wie auch denjenigen der Betrachter seiner Werke verkümmern. Er gleicht darin dem Schlemmer, der isst und trinkt um des Essens und Trinkens Willen, und nicht etwa zu seiner Sättigung, und noch viel weniger zu seiner Kräftigung für den Dienst an seinem Nächsten.
Es gleichen alle solchen sinnlichen Leidenschaften dem Wühlen der Mäuse in einem Acker oder dem Suhlen der Schweine in den Pfützen dieser Welt. Die einen zerstören damit die Fruchtfelder des Geistes und die andern beschmieren ihren Geist mit materieller Sinnengier.
Was anfangs der Malerei zu wenig in den Bildern war – das Gemüt und dessen Gefühl –, davon begannen die spätern Werke derart zu strotzen, dass die bloss sinnlichen Gefühle den Geist ebenso ersticken, wie der trockene Verstand zuvor den lebendigen Geist der tätigen Liebe nie aufkommen liess.
War der Himmel in den frühen Werken der Kunst – in Bildern, wie in der Musik – nur in abstrakter geometrischer Ordnung darstellbar, so ist er später lange Zeit im Fleisch und seinen Sinnen gesucht, aber nicht gefunden worden, weil alles Fleisch letztendlich den Würmern zum Frass bestimmt ist.
Und heute sind wir so weit, den Himmel weder zu begehren, noch weniger zu suchen. Der Mensch, und besonders der heutige Künstler, ist sich selbst genug! Aber die Kultur war dementsprechend auch zu allen Zeiten wie die Kunst! Was früher toter Verstand alles verhinderte, treibt die heutige Bejahung des Sinnenrausches zu geilem Wachstum mit der Folge frühzeitigen Zerfalls, ehe noch der alles Fleisch überdauernde Geist je zum Zuge gekommen wäre. Ein dieser Richtung angehörender Künstler wird jenseits wahrlich genügend Gelegenheit haben, an sich selber ein Akt-Studium zu betreiben, das allerdings solchen Umständen entsprechend sehr dürftig ausfallen könnte.
Der heutige, moderne Künstler, der seiner eigenen Aussage gemäss, die Betrachter seiner Werke wachrütteln will, ist nichts anderes als ein vom Wohlstand verwöhntes Kind, das seine Aggressionen – mangels natürlicher, seine Kräfte fordernder Widrigkeiten – durch die Kompromittierung anderer loswerden will. Er ist dabei ebenso sinnengierig wie jene, die damit begonnen haben, ihre unersättliche Sinnengier auf der Leinwand auszuleben – die Impressionisten von der Prägung eines Manet, Cezanne oder Gauguin. Nur beschränkt sich die Sinnlichkeit der Modernen – im Gegensatz zu den Impressionisten – nicht auf den blossen Genuss an den in der Natur bereits vorhandenen Formen und Farben, sondern sie verlangt zu ihrer Steigerung nach der seelischen Zerfleischung der Betrachter ihrer Werke durch Verwirrung und Irreführung ihrer Ansichten, und das zwar nicht – wie sie vorgeben – als Anstoss zu einer Entwicklung, sondern aus blosser sinnlicher Lust am Zerstören.
Nichts soll jedoch mit der vorherigen Erwähnung der Impressionisten gegen eine andersartige, eher skizzenhafte, dafür farbbetonte Darstellung des äussern Details gesagt sein. Aber eine Lehre daraus zu basteln oder gar den verruchten Stil zu kreieren, das erscheint unter den oben beschriebenen Gesichtspunkten ebenso abwegig wie der Drang, auch wirklich alles nur zu beginnen, aber nichts ausreifen zu lassen. Ein Trieb, der eigentlich nur den Kindern eigen sein sollte, weil er dort – im frühen Kindesalter – doch wenigstens noch für eine breite Erfahrungsgrundlage sorgt. Zur Erfahrung der eigentlichen Realität hingegen sind eine sorgfältige Durchführung aller Arbeit und das Abwarten des Endproduktes zwecks Vergleichs mit der ursprünglichen Idee ebenso wichtig oder noch viel wichtiger als die für die anfängliche Kindesentwicklung notwendige breite Grundlage. Denn letztendlich gleichen sich alle Wachstumsprozesse so stark, dass es egal ist, auf welcher der vielen Grundlagen wir ihn durchgemacht haben. Nur, dass wir ihn durchlaufen, ist das Wichtige.
Die Betonung der Kontur und die Leere der Fläche bei Bildern der modernen Art illustrieren ja überdeutlich, wie überfordert der Schaffende heute durch die Mannigfaltigkeit der Konflikte ist. Denn eine Begrenzung (die Kontur) muss sich ja stets aus dem (gedanklichen) Inhalt ergeben. Nur wo der Inhalt oder, im besseren Falle, die stützende Kraft der Struktur eines Inhaltes fehlt, ist eine äussere vom Inhalt nicht implizierte Begrenzung notwendig: im psychischen Bereich beispielsweise kann sie – etwa bei gedankenleeren Spielereien – durch die dazu vom Erzieher vorgegebene Zeit (weil ein vorschriftsmässiges Müssen den blossen Hang zu etwas am besten unterbinden kann) erfolgen; im physischen Bereich – etwa bei Flüssigkeiten – durch irgendein beliebiges Gefäss.
Das Gedankenchaos eines "Modernen" (Künstlers) kann zwar ebenso viele Gedanken umfassen wie die Erkenntnissphäre eines genialen Künstlers. Nur ist beim ersteren keine feste, in sich selbst begründete Form möglich, weil die das Chaos ordnende, positive Kraft der Liebe fehlt, die dem Ganzen die notwendige Struktur zu einer möglichen, ständig gediegener werdenden Vollendung gäbe. Das passive Sich-Hingeben aber ist eine Erscheinung dieser Zeit und gleicht der Hingabe wohl zubereiteter Nahrung (durch Stehen lassen) an den aufzehrenden Schimmelpilz der Zerstörung und Vernichtung – ohne je irgendetwas vollbracht, oder irgendwem gedient zu haben.
20.8.1983
In der Wirklichkeit oder in der alles umfassenden Realität jedoch entsteht eine jede Form aus den Bedürfnissen ihres Inhaltes – oder dann aus der weisen, geistvollen Voraussicht dieser Bedürfnisse – wenn sie für einen bestimmten "Inhalt" erschaffen wurde, wie zum Beispiel alle Wesensformen der Natur. Was geht all den Geschöpfen der so genannten Natur an ihrer äussern Form ab, dass sie nicht all ihren Aufgaben gerecht werden könnten!? Nichts! Findet der einfache Wurm in seiner primitiven Form nicht ebenso geschickt seine einfache Nahrung wie die mit vielen Werkzeugen (Hinterbeine, Augen, Ohren und Nase mit ihrem Geruchssinn, Vorderpfoten mit ihren Krallen und ein scharfes Gebiss) ausgestatteten Raubtiere, die sich ihre Nahrung erst aufstöbern und dann erjagen müssen?! Und hat der Vogel mit seinem Schnabel nicht jene Fertigkeit, sich ein Nest, ein Zuhause, zu bauen, für das wir Menschen unsere Hände bräuchten. Und hat zuletzt der in allen äussern Fertigkeiten den Tieren nachstehende Mensch dafür nicht einen Verstand, mit welchem er sich selber erst all jene Werkzeuge erschaffen kann und soll, die den Tieren mitgegeben worden sind, damit er, als Krone der Schöpfung, selber ein Schöpfer werden kann – zuerst in der materiellen Vorschule der Natürlichkeit, dann aber auch in der Ausbildung seines Geistes, der die Materie zu durchdringen fähig werden soll, so, wie uns das Christus – als unser aller Vorbild – gezeigt hat. Da erst beginnt die wahre Kunst des Lebens!
Da also, wo der alles durchdringende Geist durch die Vorkommnisse des äussern Lebens und innern Erlebens bedingt in der Seele zu erwachen beginnt und sein Einfluss auf die Seele mit dem Fortgang des Lebens weiter gestärkt wird, sodass er die Seele einmal völlig zu durchdringen beginnt, bis sie in ihrer Vergeistigung dann fähig wird, auf ihr materielles Werkzeug – ihren Leib – derart umfassend und durchdringend einzuwirken, dass sie alle seine Gebrechen (Krankheiten) zu überwinden beginnt durch die geordnete Kraft des schöpferischen Geistes in ihr. So, wie uns das einmal Christus vorgelebt hat, wobei das damalige – und wohl auch noch das heutige – Volk ein solches Wirken als "Wunder" bezeichnete, weil es zu sehr über dem Horizont ihres noch in tiefem Schlaf befindlichen Geistes stand.
In einem solchen geisteswachen Zustand beginnt die Seele dann erst zu begreifen, wie tief entsprechend die äussern Formen den Inhalt charakterisieren, sodass sie in den Formen der äussern Natur die geistige Aufgabe zu erfühlen und zu erahnen beginnt. Dann kann sie auch zu ganz natürlichen Bildern, wie zum Beispiel zum Ölgemälde "Vesperbrot auf dem Felde" von Rudolf Koller, Erklärungen geben, die weit über das irdische Leben hinaus ihre Gültigkeit haben, weil die Seele ebenfalls weit über ihren irdischen Leib hinaus erhalten und entwicklungsfähig bleibt.

Sie würde daraus etwa folgendes erkennen:
Wenn wir das von Rudolf Koller gemalte Ölbild, eine Bauernfamilie bei der Malzeit auf dem Felde darstellend, betrachten, so sind wir innerlich angesprochen und zugleich fast wehmütig berührt, dass solche Zeiten nicht mehr sind.
Solche Zeiten sind aber der entsprechenden, innern Wahrheit gemäss immer noch und werden es auch immer sein und bleiben. Denn das wird jeder Mensch in sich selber antreffen, dass der Geist – im Bilde durch den Vater dargestellt – in ihm sich ruhend verhält, ihn also nicht drängt. Erst wenn die durch das Fleisch des materiellen Leibes etwas schwerfällige Seele – im Bilde durch das Weib dargestellt – sich über ihre materiellen Interessen zu erheben beginnt und damit dem Geist zu dienen beginnt, indem sie seinen Anforderungen entspricht und durch diese neue Tätigkeit ihrem Geiste ähnlicher wird, den Geist also gewisserart zu ernähren beginnt, so wird dieser in der ihm immer mehr entsprechenden Seele immer freier und wird sich in dieser Freiheit endlich vollständig erheben und das ganze noch unbearbeitete Feld ganz alleine zu bearbeiten beginnen und diese Arbeit in kurzer Zeit auch vollenden. Und die Seele – durch das Weib dargestellt – wird dabei nicht viel mehr zu tun gehabt haben, als dass sie in sich tätig geworden war nach der rechten Ordnung des in ihr ruhenden Geistes, wobei sie durch die Werke der Liebe den Geist gleichsam weckte und nährte oder ihn frei machte. Dann aber wird sie stehend staunen über die grosse Tätigkeit und Wirkungsmacht des Geistes und es wird zutreffen – angesichts des grossen Feldes – , dass sie zu sprechen beginnt und aus tiefster Einsicht sagen wird, nachdem sie alles getan hat, was der Geist von ihr fordert, dass sie dennoch nur eine faule und unnütze Magd war (ganz ähnlich der Bibelstelle in Lukas 17. 7). Denn das Feld stellt ja ihr eigenes Gemüt dar, das – wenn es dem Geiste (Gottes) durch den Liebedienst nach seiner Ordnung zur Verfügung gestellt wird – aus seiner Kraft in der Seele vervollkommnet wird – zur grossen Freude und Seligkeit der Seele.
Ihre Kinder aber, die ja dann in Wirklichkeit die Kinder des Vaters sind, stellen die guten Werke dar, die ebenfalls nur Werke des göttlichen Geistes sind, da ja nichts Gutes im Menschen liegt, es komme denn vom Vater oder vom Geiste. Darum auch die Kinder, zusammen mit dem Vater, am Boden der Erde dargestellt sind, weil sie eben vom Vater herrühren und ihm also gleichen müssen, weil der Vater unter allen der Demütigste ist, da er sich in seinem Sohne von seinen eigenen Geschöpfen ans Kreuz nageln liess; darum er aber auch in seiner demütigsten und jedem Geschöpfe nur dienenden Liebesorge der Grund und Boden jedes Engels und endlich auch der ganzen Schöpfung ist. Die Kindlein aber werden auf dem vom Vater bearbeiteten Feld gute Zeiten haben und schnell wachsen können. Das heisst, dass die guten Werke in dem vom Vater von aller Selbstsucht gereinigten Herzensgrunde der Seele einen guten Boden finden und deshalb in ihrer Wirksamkeit schnell wachsen können, weil die Einsicht durch die wachsende Liebe stets vertieft wird.
Und darum ist und bleibt dieses Bild ein Bild der guten Ordnung und der Wirklichkeit des innern seelisch-geistigen Lebens und wird nie alt. Alt werden nur die Menschen, wenn sie sich zu weit von dieser Ordnung der väterlichen Liebe entfernen und sich dabei dann oft noch erfahrener und erwachsener vorkommen als zuvor – wo es doch anderseits geschrieben steht, dass den Kindlein das Reich Gottes gehöre (Markus 10. 14).
Oder, um es in einem andern Bild (dem Titelbild dieses Büchleins) auszudrücken: Bliebe der Mensch in der ihm am besten dienenden Demut, so gliche er einem wohlerfahrenen Fuhrmann, der seine beiden Pferde – als Zugkraft seiner Liebe –, das Gefühl und den Verstand, zu paaren versteht und zu richten weiss gegen das Licht des Geistes hin, damit sie im Gleichschritt den Pflug des Lebens zu ziehen vermögen, welcher die Natürlichkeit durch Hinterfragen aufreisst, damit in ihren tiefen Furchen im Gemütswesen des Menschen endlich der Same des Geistes Fuss fassen kann, welcher sich dann zur nährenden Frucht des innern Geisteslebens auswachsen wird, die die Liebe des natürlichen Menschen auf seinen ewigen Urgrund zurückführen wird, wie der Fuhrmann auf dem Titelblatt dieses Büchleins seine beiden ungleichen Pferde in Richtung des Lichtes des sich wieder auftuenden Himmels leitet. Wenn er dabei demütig und umsichtig bleibt, so bleibt er in der für seine Arbeit ungünstigen Regenzeit der weltlichen Widrigkeiten zwar ruhig stehen – wie der Fuhrmann bei seinen beiden Pferden, hält sie aber stets zum sofortigen Einsatz bereit, damit er sogleich nach dem Regenschauer wieder auf dem natürlichen Felde seines Gemütes für die Ewigkeit seines innern Seins arbeiten kann. Dass er dem weissen Pferde – entsprechend dem Gefühl – näher steht als dem dunkelfarbigen, bedeutet, dass das Gefühl dem Leben des innern Menschen ungleich näher steht als der Verstand.
nach oben
|