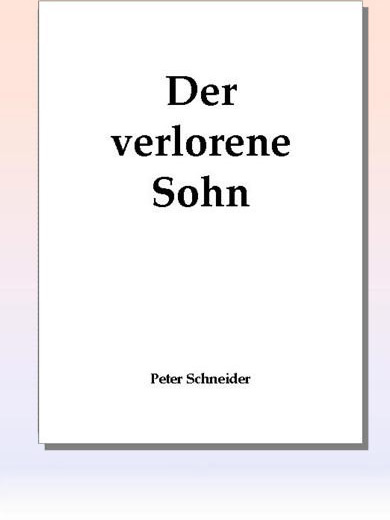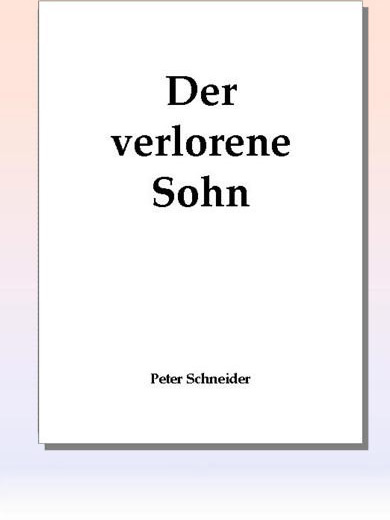|
Jedermann kennt die Gleichnisgeschichte vom verlorenen Sohn (Luk. 15, 11 bis 32). Weiss aber auch einer, was sie in ihrer ganzen Tragweite wirklich bedeutet und wer für was verloren war.
"Im Anfange war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort" (Joh. 1, 1). Also sind das Wort und der Gedanke eine Einheit. Denn vor dem Wort muss ja der Gedanke sein, der sich dann im Wort ausspricht. Folglich ist im Worte auch immer der ursprüngliche Gedanke enthalten. Nur ist er im Wort – eben durch das ausgesprochene Wort – geschieden von allen andern Gedanken, die ihn einerseits bedingen und ihm anderseits auch folgen. Darum auch ist es möglich, das Wort falsch verstehen zu können – weil es nämlich in seiner ausgesprochenen Einheit dennoch nur ein Teil ist, und zwar der ausgesprochene Teil eines ganzen (Gedanken-) Wesens. Und er kann darum – als ausgesprochen – zu einem Teil eines andern Wesens werden, das zwar in sich dasselbe auch beinhalten muss, aber eben in anders geordneter Weise und darum auch zu einem andern Zwecke. Betrachten wir beispielsweise das Wort "Feuer": Jedes Feuer zerstört Vorhandenes. Aber das Feuer aus reiner Liebe erlöst dabei den Inhalt aus seiner ihn bedrängend vorhandenen Form. Das Feuer aus eigenliebig entstandenem Zorn und der nachfolgenden Rache hingegen vernichtet die Form einzig zum Zweck der Vernichtung. So kann das Wort "Feuer" im Wesen des einen "Schmerz" und "Vernichtung" bedeuten, aber ebenso gut kann es im Wesen und Verständnis eines andern "Leben" bedeuten, denn ohne Feuer gibt es keine Wärme und ohne Wärme kein Leben!! Ob ein Feuer schmerzt oder gar vernichtet, bestimmt in einer gewissen Weise auch unser Verhältnis zu ihm: Je lauer wir sind, desto weiter muss das Feuer von uns entfernt sein, damit es uns noch erträglich ist oder uns sogar noch wohl tut. Je kälter wir jedoch sind, desto vernichtender wirkt es auf uns ein – selbst noch aus jener Distanz, aus welcher es dem Lauen angenehm erscheint. Denn bereits in einer bloss lauen Wärme muss das kalte Eis schmelzen, oder mit andern Worten die Vernichtung seines harten und jedem Schlage trotzenden Wesens erleiden. Seine Härte muss zerfliessen in nachgebendes Wasser.
Hingegen können sich im andern Extremfall zwei Feuer nur wohl tun in ihrer gegenseitigen Hitze, welche alleine die Bedingung allen Feuers ausmacht. Nichts verträgt ein Feuer so gut wie wieder ein Feuer. Daraus wird ersichtlich, dass das ausgesprochene Wort "Feuer", das in der Glut der Liebegedanken Gottes nur die Bezeichnung seines eigenen Wesens ist, in der Gedankenwelt eines nach aussen gekehrten Menschen als erschrecklich erscheinen muss. Denn das Feuer löst alles auf; es schmilzt das Eis zu Wasser und verdunstet das Wasser zu Dampf und am Ende löst es in seiner grössten Kraftentfaltung sogar die Atome wieder auf oder verschmilzt sie zu ganz anderen Stoffen. So löst das Feuer reiner Liebe alle Hinterhalte auf, bringt alles hervor an den Tag der vollen Wahrheit, welche der Tod aller Lüge und aller Verstellung bedeutet, sodass der davon Betroffene in sich zusammenfällt und sein eigenes bisheriges Leben dabei einbüsst. Das ist der eigentliche Grund, weshalb der Vater seinen jüngsten Sohn ziehen lässt. Damit er möglicherweise aus eigener Erkenntnis zu diesem heiligen Feuer wieder zurückkehren kann, das alleine sein ferneres Leben nährend bedingt.
Aus diesen Betrachtungen lässt sich leicht folgern, dass in dem einen Ausdruck "Wort" dennoch zwei Dinge enthalten sind: Erstens der innere Gedanke, der zu diesem Wort geführt hat, und zweitens die äussere, begrenzende Hülle dieses Gedankens, die ihn von seinem Entstehungsgrunde trennt, sodass der ausgesprochene Begriff für Vieles verwendet werden kann, das nicht mehr mit der Verwendungsweise oder Entstehungsweise des Begriffes so direkt übereinstimmen muss, dass mit diesem Begriff auch dieselbe Erfahrung und Empfindung verbunden sein muss.
Rechnerisch können wir es so ausdrücken:
Wenn ein Gedanke durch das ausgesprochene Wort zu einem selbständigen Begriff wird, so ist seine Zahl nicht mehr das "1" des ursprünglichen Gedankens, sondern ½ und ½. Dabei nährt zwar der Gedanke noch stets, sodass er wie eine Einheit erscheint. Aber aus diesem Begriff kann man über das äussere Wort auch zu andern Gedanken gelangen, sodass dann das äussere Wort – verbunden mit andern Gedanken – zu einem völlig neuen Begriff werden kann, der dem ersten diametral gegenüber stehen kann.
Die Gleichnisgeschichte zeigt diese Situation auf, indem in ihr eigentlich von zwei Söhnen die Rede ist. Es sind die beiden Wesensarten, welche ein und dasselbe Wort zu zwei völlig verschiedenen Begriffen werden lassen. Der eine Sohn, welcher dem Vater das Erbe nicht herausverlangte, oder das Wort, das er selber – in seiner Wesenheit – darstellt (denn: "ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist [Joh. 1, 3]), nicht in einen andern Begriff ummünzen wollte, blieb dem Vater treu. Er achtete ihn in seiner Grösse und Vollkommenheit und auch der Vater achtete ihn als ein gelungenes Werk, indem er seinen Gedanken in diesem Menschen eine äussere Form gegeben hat, die seiner Grundabsicht treu geblieben ist. In dieser gegenseitigen Achtung blieben sie eine Einheit – jedoch immer in zwei Wesen, was sich später (bei der Heimkehr des zweiten Sohnes) noch klar zeigen wird. Das erste Wesen – Gott – prägte durch seine Gedanken den Begriff und nährt ihn dann auch fortwährend durch seinen Gedankenfluss, damit er das bleibe, als was er ausgesprochen wurde. Das zweite Wesen – der Mensch, das ausgesprochene Wort – bleibt dem ihn erschaffenden habenden Gedanken treu, bleibt also in seiner Artung seinem Urgrund ebenbildlich gleich; in seinen Möglichkeiten jedoch vom ersten Wesen verschieden. Denn das erste Wesen kann seine Gedankenordnung nicht aufheben, ohne sich selbst in seinem ganzen Wesen zu zerstören. Das zweite – als ein vom ersten durch das Wort veräusserte – jedoch könnte das wohl. Warum aber sollte es so etwas tun?! Es wird ja von seinem ursprünglichen Grunde, von Gott, geachtet und achtet deshalb seinerseits auch seinen Grund. Daneben bleibt aber doch immerhin die Möglichkeit dazu bestehen, sodass die ursprüngliche Einheit aus zwei (2) Möglichkeiten besteht, die nur in gegenseitiger Achtung ständig wieder zum "1" wird.
Bei der geringsten Unachtsamkeit aber empfindet sich das zweite, aus dem Ersten hervorgegangene Wesen dennoch als selbständig, also als eine "1" , und zwar zu seinem ursprünglichen Grunde hinzu – und nicht mehr als ½ oder einen Teil zu dem andern ½ oder Teil, sodass es in der Folge 2 Wesen werden, anstatt nur 1 Wesen aus je einer Hälfte. In der Schreibweise der Brüche erkennt man den Unterschied deutlich: Die Gesamtheit entspricht der Zahl "1", im Wesen entspricht diese Gesamtheit jedoch der Zahl "2", sodass ein jedes Wesen dementsprechend der zweite Teil ein und desselben Begriffes ist und darum rechnerisch auch diese beiden Zahlen enthalten muss; und zwar über oder vor dem Bruchstrich das "1", die Einheit des Begriffes, und unter oder nach dem Bruchstrich die Zahl "2", die Zweiheit des Wesens (1:2), nämlich das erzeugende Wesen des Begriffes – der Gedanke – und das abschliessend begrenzende desselben Begriffes.
Im andern Fall, beim jüngern Sohn, ergeben sich 2 Wesensgestaltungen, die den einheitlichen Begriff aus zwei ganz verschiedenen und darum auch unterschiedlichen Richtungen begründen und auffassen, die einander so nicht begegnen können Darum ergibt dabei sich rechnerisch die Zahl "2", in welcher sich zwar zwei mal eine Einheit, in Zahlen: "1" ausspricht, das aber so nie eine Einheit, in der Zahl "1" ergibt. Darum auch trennte sich der zweite, jüngere Sohn, verlangte sein Erbe (die Einheit) von seinem ursprünglich mit ihm vereinten Grunde für sich selbst heraus und formte es eigenliebig zu einer neuen (zweiten) Einheit. Das ging so weit, bis er endlich in der Praxis zu begreifen und lebenstief zu spüren begann, dass er selber eben doch keine wirklich von der andern unabhängige Einheit sei und dass seine Ordnung und Betrachtungsweise der Dinge ihn verarmen machte, seine Lebens- und Liebewärme in der Zerstreuung verbrauchte und in der durch die Trennung bedingten Vereinsamung erstarren liess.
Nun erst sah er ein, dass nur die Einheit durch das Licht aus ihrer gesammelten Wärme alles so ordnen konnte, dass damit allen gedient war. Er hatte keine Freude mehr an seiner eigenen Einheit und suchte und wünschte nur noch die Einheit an und für sich, wo immer sie zu finden sei. Darum kehrte er zurück zu seinem Vater, der schon gar lange auf ihn wartete, weil er ja für ihn verloren gewesen war, und der ihn auch gar herzlich empfing, weil er durch diese neue Vereinigung sowohl das Wohl des einen wie des andern Teiles in eben dieser Einheit kannte und darum auch unablässig anstrebte – jedoch eben nur unter der Voraussetzung der vollendeten Wesenseinheit. Zu dieser gehörte aber die absolute Freiwilligkeit. Denn so, wie Gottes Wille von allem frei ist, ebenso gestaltete er auch den Menschen, sein ausgesprochenes Wort, dem Wesen nach. Es musste wirklich frei wie Gott selber sein! Wie könnte er sonst sein Ebenbild sein (1. Mose 1, 27)? Der zurückgekehrte Sohn – also das "½" – wollte nicht mehr Sohn sein, sondern das "2" des "½" lieber ganz verlieren als das "1" desselben Bruches zu riskieren. Dieser herzenstiefe Wunsch wurde nun zum neuen Wesenszuge seines künftigen Lebens, was der Vater wohl spürte und eigentlich auch wünschte, weshalb er dann auch ein so grosses Fest veranstaltete. Der Sohn wollte nichts mehr für sich selber, sondern gab sich selber dem Vater zurück, empfand im Aufgeben seiner Eigenheit und in der Hingabe derselben an die Eigenheit seines Vaters die grösste Freude, die grösste Wonne und später auch alle Lust seines Lebens. Nun waren sie vereint. Zwar immer noch zwei Wesen, aber nun wieder vereint in der gemeinsamen Erkenntnis der allein möglichen Seligkeit in einer unbedingten Einheit. Zwar brauchte der in allem vollkommene Vater nicht die Erfahrung des Sohnes, um diese Erkenntnis erst zu erlangen. Aber der Sohn brauchte sie, ging also nicht dieselben Wege wie sein seit ewigen Zeiten vollkommener Vater, kam aber endlich zu demselben Ziel. Darum auch bleiben es zwei Wesen, so sehr sie nun in ihrem Wesen eins sind.
Der andere Sohn aber wurde erst durch dieses Ereignis in seiner Seligkeit gestört, indem er dachte, empfand und endlich auch zu seinem Vater sagte: "Stets habe ich dir gedient. Aber nie noch hast du für mich ein solches Fest gegeben!" Und der Vater belehrte ihn, dass er ja an seiner Seite stets an allem genug hatte und dass er selber jederzeit ein Fest hätte veranstalten können, wenn er sich dazu veranlasst gesehen hätte.
Der Sohn hatte also in seiner Erkenntnis, dass des Vaters Wille gut – auch für sein Gedeihen und Fortkommen gut – war, das Gute zu dem Seinen gemacht. Aber nicht so sehr, um den Vater zu erfreuen, sondern um in seiner vernünftigen An- und Einsicht ein ausgeglichenes Leben führen zu können. Er achtete seinen Vater und der Vater achtete ihn. Und eines Mehreren bedurfte es nicht. Er hatte, was er wollte und der Vater hatte auch, was er nur verlangen oder eigentlich voraussetzen konnte. Aber hatte vielleicht eben nicht, was er sich nur wünschen, aber gerechterweise von niemandem verlangen konnte. Dass sein Geschöpf nämlich sein Wesen aus purer Liebe zu ihm ganz aufgeben möchte, um in ihm wieder völlig eins zu sein, sodass nie mehr – wie in einem ausgesprochenen Worte – nur ein Begriff, aber zwei Wesen seien, sondern nur noch ein unausgesprochenes Wort, wie es eben nur das Wesen der Liebe kennt, das sich eigentlich gar nicht aussprechen lässt.
Und diese Aufgabe des Eigenen zugunsten der ursprünglichen Liebe hatte Jesus als Einziger in voller Freiheit vollbracht, als er im Garten Gethsemane den bittern Kelch nach dem Willen seines Vaters dennoch annahm. Denn er hatte – wie der wohlgeratene Sohn – jede Gelegenheit und jede Macht, die sein Vater hatte, von welchem er sie ja auch erhalten hatte, und dennoch gab er seinem Vater alles das freiwillig am Kreuze zurück, nur, um nicht mehr ausser ihm ein Wort zu bleiben, sondern in ihm selbst wieder voll unausgesprochener Gedanke zu sein – allerdings durch seinen Wandel als Mensch dennoch für alle Welt und für alle Zeiten ausgesprochen bleibend. Denn alles Geschehene mitsamt seinen Folgen kann nicht ungeschehen gemacht werden.
Zwar kam auch der verlorene Sohn frei- und liebewillig nach Hause. Aber er brachte nichts mehr von dem zurück, was er ursprünglich als Erbe empfangen hatte. Denn der freie Wille, der aus harter Erfahrung geformt wurde, ist zwar immer noch frei, das beweisen all jene, die trotz harter Erfahrung auf ihrem Eigenen, ihrem Ego beharren; denn sie zeigen, dass keine Erfahrung so hart sein kann, dass sie den ursprünglichen Willen beuge. Dasselbe zeigt auch die ganze Hölle, die ja nicht etwa von Gott aus verdammt oder gefangen genommen ist, sondern nur durch ihren eigenen Starrsinn, ihre Selbstsucht und den Hochmut, der als eine "1" neben der "1" seines Urgrundes bestehen will.
Aber ein aus harter Erfahrung erleuchteter Wille ist denn doch nicht aus sich selber erleuchtet und geordnet worden, sondern aus jener Erfahrung, die ihm durch die höhere Ordnung Gottes auf seinen Wegen, die er in völliger Freiheit begangen hatte, zuteil geworden ist. Infolge dessen ist er zwar noch immer frei, aber nicht aus sich selber, aus seinem ureigensten Liebewesen so gestaltet, sondern aus der Erfahrung, welche eine Folge der göttlichen Ordnung ist. Aus sich selbst und seiner eigenen Liebe – ohne jeden äussern Grund – brachte sich nur der Mensch Jesus wieder zurück zu seinem Vater. Dabei war er im Grunde in seiner Liebe stets so vereint mit seinem Vater, dass er sagen konnte: "Wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat" (Joh. 12, 45). Nur eben: die Möglichkeit einer Trennung musste zeit seines irdischen Lebens bestehen bleiben – wollte er wirklich (uns übrigen Menschen gleich) Mensch sein –, bis er ohne jede äussere Not oder Notwendigkeit sein ganzes Wesen aufgab oder übergab, indem er es in die Hände und die Bestimmung seines eigenen Urgrundes und deshalb seines Vaters legte. Ihm folgten vor allem die verlorenen Söhne – als letzter während seiner Erdenzeit der Schächer am Kreuz. Denn sie alle sind in ihrem Willen ihm gleich geworden, allerdings ohne ihr eigenes Verdienst, weil ja nicht die ursprüngliche Richtung ihres Willens sie dahin führte, sondern erst der durch die äussern Ereignisse und Erfahrungen von Gott bearbeitete oder gewandelte Wille.
Darum auch lässt der Vater die "gerechten" Söhne neben sich bestehen, sosehr er sich wünschte, sie kehrten aus ihrer puren Liebe getrieben vollständig in ihn zurück. Denn wie könnte er gerecht sein, wenn er nicht all jenen dasjenige selber Erworbene belassen würde, das er ihnen ja für den Fall verheissen hatte, dass sie seine Gebote halten. Er achtet sie und ihr Tun, wie ihn diese durch ihr Tun nach seinem Sinne achten. Denn die Achtung beinhaltet ein gewisses Zurücktreten vor der Freiheit des Andern. Darum auch stehen diese Menschen völlig frei und haben ein freies Verhältnis zu Gott, soweit sie nirgends gefallen sind. Das bestätigt Jesu mit seinem Ausspruch: "Unter allen, die von Weibern geboren sind, ist nicht (einer) aufgekommen, der grösser sei denn Johannes der Täufer; (jener,) der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist grösser denn er" (Matth. 11, 11). Weil aber im Allgemeinen kein Mensch ohne Sünde ist, so fallen zwar auch diese wohl in einem oder dem andern Punkte aus der vollständigen Ordnung. Weil sie es aber nicht wissentlich oder gar willentlich tun, ist ihnen verziehen und die Achtung ihres freien Willens durch Gott bleibt. Hingegen verspüren sie mit der Zeit, dass jede Form von Achtung niemals eine wirkliche Vereinigung zulassen kann, eben weil ja die Achtung eine gewisse Distanz beinhalten muss.
"Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht" (Joh. 8, 34), sagt Jesus zu seinen ungläubigen Widersachern. Also ist die Sünde jener Teil des Menschen, der ihm seine Freiheit und damit auch die Achtung vor seinem eigenen Willen frisst. Ist er aber dadurch schon einmal ein Knecht (vielleicht sogar in seiner äussern Stellung, wie der verlorene Sohn im Gleichnis) geworden, dann erst wird es ihm so richtig bewusst, was es heisst, Knecht zu sein (anstatt sein eigener Herr) und er erinnert sich daran, wie selig es sein müsste, wenigstens ein Knecht eines guten Meisters, wie etwa seines eigenen Vaters, zu sein. Er will fortan nicht mehr Sohn sein, der in seiner Willenshoheit eine Achtung erhält, deren Freiheit er wieder nicht würdig sein könnte, sondern will lieber Knecht bleiben, aber dafür in seinem Dienste völlig vereint mit seinem Vater. Er wird dabei Erfahrungen in der Innigkeit aller Liebe in ihrer völligen Vereinigung mit dem Geliebten machen, welche dem Geachteten versagt bleiben müssen.
Darum werden sich auf der Erde Menschen der einen Art nicht so leicht mit Menschen der andern Art verstehen können. Denn den einen fehlt das Dramatische, das Aufwühlende und Auflösende, aber dann auch das zutiefst gefühlte Vereinigt-Sein, und den andern fehlt die Gelassenheit und das Gefühl der Stärke und Grösse, sodass sie wie voneinander geschieden bleiben. Die einen kennen Knechtschaft und Erlösung, die andern nur eine andauernde Achtung; die einen eine lebenstiefe Vereinigung, die andern ein wohlverträgliches Nebeneinander, das bisweilen wie eine Vereinigung erscheinen mag, aber nur eine Vereinigung in der Ordnung bleibt, und nicht auch in der Liebe, die sich aufgibt zugunsten eines zweiten Höheren. In ihrer Art sind beide für sich selbst verloren. Die einen für die Ordnung, die andern für die Liebe. Jene, die für die ursprüngliche Ordnung verloren sind, können jedoch für die Liebe und ihr Wesen gewonnen werden. Jene, die für die Steigerung ihrer Liebe ungeeignet sind, sind durch ihre Ordnung gebunden, sodass sie die Steigerungsmöglichkeit ihrer Liebe verlieren und darum nie so recht von der Ordnung frei werden können, zwar dadurch nicht sündigen können, aber auch nicht aus der Sünde neu und liebekräftig erstehen können. Liebekräftig heisst in diesem Falle: kräftig nicht nur die Sünde, sondern auch die Starrheit der äussern Ordnung auflösen könnend zugunsten einer nur in grösster Gedankentiefe möglichen Einheit der vollen Liebekraft.
24.10.2005
nach oben
|