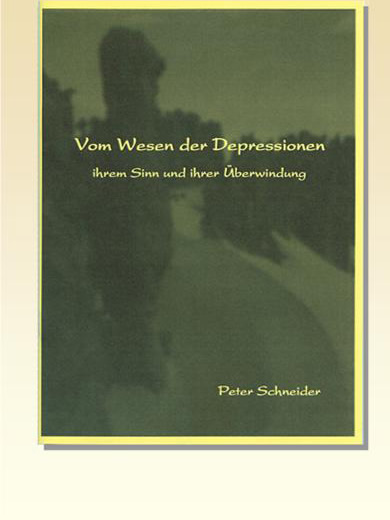 |
|
||||||
VOM WESEN DER DEPRESSIONEN |
|||||||
|
Es waren wirklich ganz herrliche Tage gewesen, die da ein Mann zwischen 30 und 35 Jahren Alters erlebt hatte. Er war einer, der das Leben nicht allzu kompliziert fand und darum sicher schon viele angenehme Tage erlebt hatte, trotz so mancher grauen Perioden, die nichts von dem Glanz der ach so schönen Welt an sich gehabt hatten, so, wie er sie zwischenhinein immer wieder empfunden hatte. Aber die letzten paar Tage waren wirklich das gewesen, was er schon immer gesucht hatte: die Erfüllung all seiner Wünsche. Er war in einer grossen, offenen Gesellschaft gewesen, die sich rührend um ihn kümmerte. Alle Tage war von morgens bis abends etwas los gewesen. Was ihm da alles begegnet war, was ihm alles vorgestellt wurde und was er alles zu essen und zu trinken bekam! Seltenste Hochgenüsse waren das und wahre Entdeckungsreisen in ein Reich exotischer Aromen, Düfte und Säfte. Überall brannten Lichter und alles schien in Bewegung zu sein und ihm – wie einem Zentrum – zuzuströmen. Kein unangenehmer Partner, keine unverschämten Anbieter, alle so korrekt und anständig, aber dennoch so lust- und lebensvoll, so interessiert auch und so zugänglich für all seine Wünsche und Vorstellungen. Auch die Gegend, in der er sich befand, war äusserst abwechslungsreich und angenehm gegliedert in sanfte Hügelzüge und herrlich weite Täler. Wahrhaftig, ihm fehlte nichts – ausser einem ewigen Leben zum fortwährenden Genuss all des vielen ihm Gebotenen. Es ist darum nicht verwunderlich, wie stark er eines Morgens erschrocken war, als er schlaftrunken seine Augen rieb und sich unverhofft mitten in einer Wüste sah, ohne Behausung und ohne alle Gesellschaft um sich herum. – Wie konnte das nur sein? Das war doch nicht die Möglichkeit! Er konnte doch nicht nur geträumt haben. Nein, wieso denn! Eher war das ein Traum, was er nun erlebte. Denn Sand hatte er noch nie unter seinen Füssen gehabt, ja noch nicht einmal in solchem Ausmass gesehen, wie es die Landschaft um ihn herum in sich hatte. "Ja, was ist denn das?!" fragte er sich. "Das ist ja unmöglich!" Langsam stand er auf und suchte mit seinen Augen den Horizont nach dem Ende dieser Wahnwelt ab, die ja gar nicht wirklich sein konnte. Eine Wüste – er und eine Wüste!! Wie käme er auch dahin? – Aber, – so sehr er sich auch abmühte und seine Augen anstrengte, er sah nichts als endlose Wüste. Keine Menschen weit und breit. Keine Pflanzen oder Tiere, ja nicht einmal einen Käfer oder Wurm. Auch die Sonne schien noch nicht über dem Horizont zu sein, obwohl der Himmel mit mattgrauem Schimmer erhellt war. "Ja, aber was ist denn das? Was ist denn los?! Das kann doch nicht einfach so sein und bleiben!?" fragte er sich verzweifelt. Dann überlegte er, dass er vielleicht noch nicht so recht wach geworden sei und dass er von einer so genannten "Morgenvision" umfangen sei. Dieser Gedanke beruhigte ihn ein wenig. Denn es braucht einfach eine kleine Zeit, bis er endlich wieder ganz wach werde. Schliesslich geschieht ihm ja nichts in dieser Wüste. Eine Zeitlang fand er Trost in diesen Gedanken, aber bald einmal begann ihn die Zeit zu drängen. Ihn, der ja nichts Wichtiges vor hatte in diesen letzten Tagen, ihn wollte sie plötzlich mahnen, dass er noch Unerledigtes habe und noch Vieles zu tun hätte. Wieder plagte er sich mit dem Versuch einer vorläufigen Orientierung. Wieder befand er, dass es sich wohl noch immer um einen blossen halb-wachen Zustand vor dem endgültigen Erwachen handle. Und wieder, aber diesmal krampfhafter, versuchte er, ruhig zu bleiben; denn Panik wollte schon langsam über ihn kommen und ein leises Beben – einem leichten Schlottern gleich – spürte er fast noch bloss ahnungsweise in seinen Gliedern. "Nein, um Himmels Willen", dachte er, "ich hier in diesem Zustand, mutterseelenalleine, und es befällt mich immer mehr ein Unwohlsein. Nein, nein, das kann nicht sein!" Nun erfüllte eine heftige Panik sein Gemüt; er richtete sich auf und begann zu gehen, um sich etwas zu bewegen. Bald begann er zu laufen, um nur endlich aus dieser Gegend zu kommen, oder wenigsten zu einem bestimmten Punkt, nach welchem er sich orientieren könnte. Bald rannte er wie um eine Wette – wie um sein Leben! Seine Glieder wurden schwach vor Erregung und vor Anstrengung und sein Atem ging schwer. Bald einmal merkte er, dass ihn jede übermässige Anstrengung sein Los noch viel tiefer fühlen liess. Und er nahm sich vor, ruhig zu bleiben. Mit der Zeit allerdings fragte er sich, ob es – sofern er sich wirklich in einer Wüste befand – nicht besser wäre, einfach nur mässig zu gehen, um doch möglicherweise einmal ihr Ende erreichen zu können. Eine Zeitlang tat er das. Doch dann kam ihm in den Sinn, dass er in der Schule einmal gelernt hatte, dass Menschen ohne Orientierung dazu neigen würden, sich in einem grossen Kreise fortzubewegen. Also beschloss er, lieber seine Kräfte zu schonen, als möglicherweise nur nutzlos umher zu gehen. Bald einmal aber merkt er, dass – wenn sonst nichts Weiteres geschehe – beides nichts bringe. Denn: blieb er, so musste er in dieser Wüste früher oder später den Tod finden; und ging er umher, aber wohl möglicherweise im Kreise, so blieb ihm dasselbe Schicksal aufgespart. Eigentlich wollte er wieder in Panik verfallen, aber, so dachte er: nur keine unnötige Erregung oder Anstrengung; sie macht mich nur untauglich! Mit grosser Mühe ob der lähmenden Angst ging er schliesslich mit langsamen Schritten vorwärts, weil er im Vorwärtsgehen denn doch noch eine grössere Chance sah, diesem Zustand zu entrinnen. Vielleicht würde er ja nicht im Kreise gehen – wer weiss? Nach längerem mühsamen Gehen sah er plötzlich in der Ferne sich etwas bewegen. Etwas schneller schritt er darauf zu. Und er hatte Glück, es war ein Mensch! Er sprach ihn an und fragte ihn, was er hier wohl tue. "Merkwürdige Frage", sagte dieser, "was tun denn Sie?" – "Ich weiss nicht, wie ich hier her gekommen bin", antwortete ihm unser Mann. – "Wieso wollen Sie denn das wissen?" fragte der Fremde interesselos. – "Ja, Herrschaft noch einmal, ich muss doch wissen, wie ich hier wieder hinauskomme." – "Wieso und wohin wollen Sie denn hinaus? Ist doch wohl recht hier – oder nicht?" – "Ja, was zum Teufel machen Sie denn hier?" bestand der Mann auf seiner Frage. – "Ich sehe zu, wie sich alles entwickelt." – "Ja, hat es denn noch andere Menschen hier?" fragte der Mann verwirrt. – "Ja, gewiss, sehen Sie denn das nicht?" – Unser Mann blickte sich umher, und er sah tatsächlich bald noch etliche weitere Menschen. Alles Erwachsene. – "Ja aber, was machen sie denn hier?" fragte er voller Verzweiflung wieder. – "Wir sind bereit, jemandem unsere Dienste zu leihen. Haben Sie einen Wunsch?" – "Ja, ich möchte aus dieser Wüste heraus", begann der Mann zu stöhnen. "Ja, wie wollen Sie das?" fragte der Fremde. "Kein Mensch weiss etwas anderes. Also, was suchen Sie eigentlich?" – "Ich suche da heraus zu kommen!" schrie der Mann verzweifelt. – "Ja, da müssen Sie selber schauen, wie; uns genügt das hier." – "Was wollen Sie mir denn für einen Dienst leihen, wenn Sie mich hier nicht hinausführen können?" – "Ich kann Sie begleiten oder Ihnen die Haare schneiden, oder Ihnen etwas bauen aus diesem Sande hier, oder Ihnen auch ein Tal durch eine der Dünen graben." – "Was nützt mir ein Tal durch eine Düne?" fragte unser Mann nervös, gereizt und gespannt. – "Ich weiss nicht, ich sagte ja nur. – Vielleicht haben Sie Gefallen daran, so einen Verkehrsweg einmal zu sehen." – "Wenn ich aber da hinaus will, was nützt mir Ihr Verkehrsweg, wenn er doch nicht zu einem Ende führt?!" – "Na, dann eben nicht", war die lakonische Antwort des Gesprächspartners. "Ich kann mich auch mit Ihnen unterhalten oder Sie belehren; ganz wie und was Sie wünschen." – "Was soll eine Unterhaltung oder Belehrung, wenn Sie nicht um das Ende dieser Wüste wissen?!" bohrte der Mann erregt mit seiner Frage in das völlig interessenlose Wesen ihm gegenüber. "Haben Sie mir wenigstens etwas zum Trinken?" kam es ihm wie durch einen Geistesblitz. – "Ja freilich, wenn Sie bezahlen können." – "Was soll es kosten?" – "Was haben Sie?" Der Mann zückte sein Portemonnaie und sah nach. "Ich gebe Ihnen 10 Franken dafür." – "Das ist viel zu viel, zwei Rappen genügen." – "Gut, dann geben Sie mir ein Glas voll." – "Wir haben keine Gläser hier, aber Sie bekommen Ihren Trank." Er winkte einem andern, der gab ihm aus seiner hohlen Hand drei, vier kleine Schlückchen. Nie, wirklich gar nie sonst hätte unser Mann aus der hohlen Hand eines andern getrunken; aber hier, in diesem Zustand und in dieser Gegend fand er es besser, es zu tun, als zu unterlassen. Er zahlte die Taxe und entfernte sich, weil es ihm zu dumm schien, diese Unterhaltung fortzusetzen. Als er sich von ihm wandte, gewahrte er mehrere an der Arbeit, wie sie einen Graben quer durch eine Düne zogen. "Für was ist denn das gut?" erkundigte sich der Mann. – "Für was soll es denn gut. sein?" gaben sie die Frage an ihn zurück. – "Wieso macht ihr's dann, wenn ihr nicht wisset, für was es gut ist?" erkundigte sich der Mann weiter. – "Wieso sollen wir es nicht tun; ist es dir wohler bei deiner Art, die Zeit zu vertreiben?" – Schweissperlen drängten sich aus allen Poren unseres Mannes, sosehr beengte ihn die fragende Antwort der andern. Wer noch nie eine Depression gehabt hat, dem müsste man hier die Schilderung fortsetzen, bis er sich endlich ganz und gar in die Lage unseres Mannes versetzt fühlte und zu verzweifeln begänne. Wir wollen aber nicht, dass Gesunde in depressive Zustände geraten, die alles andere als angenehm sind, wie sich aus dieser Geschichte leicht erraten lässt. Vielmehr wäre es gut, sich vor innern Zuständen in der Art der geschilderten Wesensgestaltung schützen zu können und den da hinein Verirrten wieder hinaus zu helfen. Und zu diesem Zweck ist nicht notwendig, diese Beschreibung ellenlang fortzuführen. Es genügt, noch einige Betrachtungen unseres Mannes mitzuverfolgen, die diesem in der Gefangenschaft seiner Wüste erst nach Tagen oder Wochen gekommen, sind, nachdem er tagtäglich dieselben Sinnlosigkeiten, Albernheiten und vor allem Teilnahmslosigkeiten mit ansehen und mit erleben musste, ohne dass er etwas dagegen zu tun vermocht hätte. Denn während einem der vielen Male, die er sich fragte; wie er denn nur in eine solche Wüste habe gelangen können, kam ihm ein Gespräch in den Sinn, welches er in seiner guten Zeit davor einmal geführt hatte, bei welchem er seinen Gesprächspartner fragte, ob es denn in dieser Gegend, in welcher sie sich damals befanden, und die sehr trocken war, keine Quellen gebe. Er bekam damals die Antwort, dass ganze unterirdische Seen – allerdings sehr tief – unter dieser Gegend lägen, was ihn äusserst stark überrascht hatte: So ein trockener Landstrich mit so viel Wasser unter sich! Die Kultivation jenes Landstriches war aber nicht seine Aufgabe, und jene Menschen dort mussten ja irgendwie zurecht kommen. Dabei ging ihm nun auf, dass die damaligen Menschen, die er später auch in der Wüste wieder fand, keine Unwahrheit gesagt haben, sondern dass er in seinem damaligen Erlebnisrausche sich nur zu wenig Rechenschaft darüber abgelegt hatte, ob diese Zusicherung für ihn wirklich zu einer Versicherung über Leben und Fortbestand werden könne, oder nicht. Auch die Billigkeit der Preise in dieser Wüste, die ihn anfangs äusserst überrascht hatten, begann er dadurch zu begreifen, dass er sich klar wurde, dass all seine Habe in einer Wüste, der er früher oder später erliegen muss, am Ende so oder so den andern zugute käme, wenn er endlich gestorben sei. Zwar begriff er noch nicht, wieso die Menschen da trotzdem so human waren, ihm so bescheidene Preise zu verlangen. Wenn er aber dann wieder an seinen eigenen, unerträglichen Zustand dachte, wurde ihm klar, dass es nur um ein Erträglicher-Machen dieses Zustandes ging, wenn sich diese Menschen zu irgendeinem Dienst anerboten. Lange begriff er auch nicht, wie er in diese Wüste habe gelangen können, die denn doch irgendwo sein muss, weil sie fortan zu seiner Lebensgrundlage wurde. Aber da merkte er, dass auch in einer Wüste hin und wieder ein kümmerliches Pflanzenleben vorhanden war und dass es Oasen gab, welche kurze Unterbrechungen der eigentlichen Wüste darstellten. Wer – geschickt, oder dann auch dumm genug – von einer solchen Stelle, einer solchen ''Oase", zur andern gelange, dem komme dieselbe Wüste nicht wüst und leer vor für so lange, bis er sich dann endlich einmal doch in ihr verliere und dann die Hauptmerkmale einer Wüste kennen lerne, anstatt nur die Ausnahmen, so wie sie ein stellenweiser spärlicher Kräuterwuchs oder gar ganze Oasen darstellen. Unterdessen war ihm auch klar geworden, dass jene, die er in der Wüste traf, auch vorher schon mit ihm waren, aber die Oasen nicht kannten, weder ihrem Standort, noch ihrem Wesen nach, weshalb sie sie auch als natürliche Gegebenheit betrachteten. Und das Wasser, das sie ihm reichten, war kein Grundwasser, sondern. spärlich vorkommender Tau gewesen. Er kannte aber vorher auch Menschen, die er in der Wüste nicht traf; die mussten wohl um die Oasen gewusst haben; und die waren es wohl auch, die um die Wüste gewusst haben mussten. Denn erstens waren sie jetzt darin nicht zu entdecken, konnten sich also nicht in sie verirrt haben; und zweitens waren sie in der vorherigen, glücklichen Zeit wenig zugegen und sie waren damals für ihn die Unangenehmsten, da sie ihn vor vielen Fröhlichkeiten warnten und ihm viele Unternehmungen widerrieten, wenngleich der eine oder andere irgendeinmal trotzdem an irgend einer teilgenommen hatte. Ganz wenige Male traf er wirkliche Menschen in der Wüste. Er nannte sie so, weil sie gleich fühlten wie er und auch ebenso unglücklich und heimatlos – eben depressiv – waren wie er selber. Einer war ein alter Schulkollege, mit dem er seinerzeit öfters Zukunftspläne geschmiedet hatte, und der nun noch beinahe misslicher daran war als er. Eine war seine ehemalige Freundin. Sie hatte ihm nichts mehr zu sagen, so wenig wie er ihr. Gemeinsam, trauerten sie, aber jedes für sich, um den Reichtum, der ihnen beiden abhanden gekommen war. Die meisten aber waren Fremde. Nur ihren innern Gefühlen nach, die sie haben mussten, waren sie ihm bekannt. Aber die Niedergeschlagenheit, die sich zu Beginn einer Begegnung mit solchen Menschen oft etwas hob, verdichtete sich mit der Zeit etwaiger Gespräche dennoch stets wieder mehr als in der Gesellschaft der eigentlichen blossen Wüstenbewohner. Das wurde ihm klar, als seine Freundin ihm erzählte, dass sie es erfahren musste, dass es eine einzige Möglichkeit für sie gab, etwas mehr als blosses Wasser – etwas Essbares – von den Wüstenbewohnern zu erhalten. Das war dann der Fall, wenn sie sich ihnen hinzugeben bereit war. – Als er das hörte, da erst wurden in ihm Gefühle wieder wach, die er früher, in seiner Jugendzeit, Mädchen gegenüber haben konnte und in denen – ihrer eher positiven Natur wegen – irgendein Schimmer der Hoffnung lag. Nun jedoch verdüsterte sich seine Stimmung aufs tiefste, als er empfand, dass dieser sterbende Leib noch das einzig Begehrenswerte in dieser Wüste war, weil sonst für ihn nicht etwas Essbares angeboten würde, obgleich doch anderseits ein solcher Leib, den die Seele bereits zu verlassen im Begriffe ist, alles andere als Gefühle der Hoffnung aufkommen lassen konnte für jene, die nach ihm begehrten. Wie arm mussten also wohl jene sein, die hier an so etwas noch ein Restchen von Essbarem vergeuden! Und dennoch mussten sie es auch wieder leichter haben als die wirklichen, weil noch fühlenden, Menschen dieser Wüste, indem sie um ihren eigenen Zustand gar nicht wissen konnten – wenn sie doch den bald schon toten Leib schon als einen Gewinn ansehen. Nun erhebt sich aber die äusserst wichtige Frage: Sind denn die Menschen in dieser Wüste – ist denn unser Mann wirklich krank, dass sie so sehen und so empfinden? Ist mit andern Worten eine Depression ein krankhafter Zustand, und falls ja, ist es ein krankhafter leiblicher Zustand, oder ein krankhafter seelischer Zustand? Gemessen an den unbekümmerten Wüstenbewohnern, die unser Mann erlebt hatte, sind sie sicher krank. Denn ihnen fehlt doch offenbar etwas, das jene haben: die Ruhe und Gelassenheit. Natürlich liesse sich ebenso umgekehrt fragen: Sind denn die Wüstenbewohner in einem krankhaften Zustand? Gemessen an den Menschen in dieser Wüste sicherlich auch, denn ihnen fehlt das Gefühl für ihr Sein und Leben und damit das Leben selbst, denn Leben, das sich nicht fühlt, ist nicht wirklich Leben! Diese zweite Frage aber nur nebenbei! Denn, wollen wir wirklich klarer erkennen, was eine Depression eigentlich ist, was sie auslöst und was sie allenfalls heilen kann, so müssen wir nach ähnlichen Umständen im Leben sonst normaler Menschen suchen. Da finden wir schon im frühesten Kindesalter Säuglinge, die auf den Wechsel ihrer Pflegerin – zumeist der Mutter – so stark und so intensiv und lange reagieren können, dass sogar um ihre leibliche Gesundheit gefürchtet werden muss, wenn sie als Folge dessen in ihrem Schmerz und ihrer Verletztheit jegliche Nahrung entweder verweigern oder aber nicht richtig verdauen und wieder erbrechen müssen etc.. . Dann finden wir aber anderseits auch Menschen, die ihr Liebstes verloren haben – sei es durch eine Absage oder durch den Tod. Die fühlen und verhalten sich ähnlich oder beinahe gleich wie die vorerwähnten Säuglinge: Alles um sie herum ist ihnen einerlei, so wie die Wüstenbewohner und ihre Tätigkeit dem Manne einerlei waren. Beiden Fällen ist gemeinsam, dass solchen Menschenwesen eine Voraussetzung zum Leben zu fehlen begann und dass sie sich unter den neu gegebenen Voraussetzungen nicht zurecht finden konnten. Wenn wir nun erweisen könnten, dass den Depressiven, welche die Ärzte als seelisch krank zu bezeichnen pflegen, obwohl sie ihnen dann körperlich wirkende, materielle Mittel als Medizin verschreiben, ebenfalls eine Voraussetzung abhanden gekommen sei, ohne die sie sich nicht mehr zurecht finden können, so wären sie nicht mehr als Kranke anzusehen. Was aber könnte ihnen abhanden gekommen sein? Denn vielfach handelt es sich bei ihnen um Menschen, die in geordneten äussern Verhältnissen leben. Wäre es wohl möglich, dass ihnen bloss innerlich etwas abhanden gekommen ist und – wenn ja – sind sie dann wirklich den in den vorigen beiden Beispielen Erwähnten gleichzustellen, denen ja augenscheinlich auch etwas – wenn auch nur äusseres – abhanden gekommen ist? Das wollen wir einmal an diesen beiden Fällen untersuchen: Wenn einem Kleinkinde die Mutter fehlt, so denken wir, sei ihm etwas Äusseres abhanden gekommen. Da aber die Mutter vor allem seine Pflegerin war, und das Kind danach von einer andern Pflegerin mit denselben Mitteln weiter gepflegt wurde und mit derselben Nahrung versorgt wurde, die ihm schon seine Mutter gab, können wir nicht eigentlich mit gutem Gewissen sagen, es sei ihm etwas Äusseres abhanden gekommen, da es ja, im Gegenteil, gerade eine äussere Kontinuität erfahren konnte. Beim zweiten Beispiel, dem Verliebten, der sich in allem Äussern schon lange selber versorgen kann und sich wohl bis dahin auch selber versorgt hat und darum keine weitere Pflege mehr braucht wie ein Kleinkind, ist in der Person des Liebsten auf den ersten Blick wohl doch schon eher etwas Äusseres abhanden gekommen. Nur gibt es ja ebenso viele Frauen wie Männer, die sich leicht finden und wechseln können und es kann ja darum an der äussern Voraussetzung nicht liegen, dass der Verliebte schwermütig wird, weil es unendlich viele andere Individuen des andern Geschlechtes gibt, die für das eine verlorene Individuum Ersatz bieten können. Es muss also dennoch in beiden Fällen ein innerer Wert gewesen sein, der da den Betroffenen verloren ging. Nur – und hier kompliziert sich unsere Frage noch einmal – war das Innere, das als Voraussetzung verloren ging, ein Fremdes oder ein Eigenes? Betrachten wir wieder zuerst unser Kleinkind: Es hatte eine sorgfältige Mutter, die sich viel mit ihm abgab, weil sie es liebte und ihr Herz ganz von ihm erfüllt war. Die nachfolgende Pflegeperson aber war ebenso sorgfältig und gab sich ebenso viel und ebenso herzlich mit ihm ab. Ja, im Gegenteil, je herzlicher und inniger sie sich mit ihm abgab, desto schlimmer wurde des Kindes Zustand. Wieso denn das? Für ein innigstes Verhältnis zwischen zwei Menschen braucht es ein gegenseitiges Harmonieren der Gefühle. Je tiefer nun zwei Menschen fühlen, desto intensiver müssen sie notgedrungen auch jedes Verhältnis fühlen. Und je intensiver sie ein Verhältnis zu fühlen fähig sind, desto schwerer und störender wirkt sich schon eine kleinste Verschiedenheit aus. Also können wir annehmen, dass je inniger und gleichartiger die innere Verbindung zwischen Mutter und Kind war, desto schmerzlicher wird nachher das Kind die Verschiedenheiten empfinden, selbst wenn sie nur geringer Natur wären. Daraus folgt aber auch: Je inniger und sorgfältiger der Pfleger auf den Pflegling eingeht, desto mehr erspart er ihm die Arbeit einer Anpassung, desto verwundbarer lässt er ihn einmal zurück. Denn die Anpassung geschah dann stets vom Pfleger aus, sodass eben die mangelnde, weil nie geübte Anpassung alleine zum wirklich Abhandengekommenen des Pfleglings wird. Diese war zwar wohl von Mutters Seite gekommen, müsste aber im Pflegling selber auch vorhanden sein. Und weil sie es nicht ist, weil sie nie gefordert wurde, deshalb vermisst der Säugling sie – seinem Gefühle nach – im Wesen des neuen Pflegers; in der Wirklichkeit allerdings nur in sich. Der Verliebte aber kennt ja – als eben erst Verliebter – seine Liebste noch nicht völlig. Wenn diese also unschlüssig ist, sich aber keine Gelegenheit vergeben will, so lächelt sie stets und widerspricht in nichts. Dieses Verhalten erzeugt ein Bild im Verliebten, das nicht der Wahrheit entspricht. Es erscheint wie tiefste Zuneigung und volles Einverständnis, während es in Wirklichkeit unbelebte Anpassung sein kann – nur vorläufige Anpassung aus der Unschlüssigkeit entspringend. Verliert nun der Verliebte in der Liebsten, wenn diese endlich schlüssig wird und sich von ihm wendet, wirklich das Inwendige seiner Liebsten – also ein fremdes Inneres –, oder bloss nur das eigene Bild – die Illusion – über seine Liebste? Wird nicht in beiden Fällen nur das Eigene als Abhandengekommenes im Unglücklichen durch seine Niedergeschlagenheit offenbar? Wenn aber solches denkbar möglich, so fragt sich sehr, was es denn noch braucht, einen Depressiven für völlig normal, und nicht für krank zu erklären. Dazu bräuchte es allerdings bloss dasjenige in ihm vorhanden gewesene, nun aber verloren gegangene oder zerbrochene Innere, das ihm zu fehlen beginnt, sei es ein Bild wie beim Verliebten, oder eine innere Eigenschaft wie beim Kinde, oder beides zugleich. Und das zu suchen und zu finden, soll unsere nächste Aufgabe sein. Es gibt daneben allerdings auch die Möglichkeit eines eher leiblich Verlorengegangenen. Es ist das normale Spiel der Nerven, sodass nämlich eine ursprünglich gewollte nervliche Spannungszunahme nach deren Notwendigkeit nicht mehr gebremst werden kann und umgekehrt ein starker Spannungsabfall, bis zum Schlaf hin, nicht verhindert werden kann. In einem solchen Leibe ist es kaum mehr auszuhalten. Da fehlt die Voraussetzung zu ordentlichem Bleiben. Aber solange wir das Spiel der Nerven solchen Menschen nicht wieder in die Hand geben können, solange befinden auch sie sich in einer Wüste, in welcher jede Arbeit des Suchens zur Qual wird. Sie sind seelisch ebenso überfordert. Darum kann auch ihnen die nachfolgende Erklärung helfen, mit der wenigen, ihnen noch verbliebenen Kraft doch wieder zu einem erträglichen, ja sogar fruchtbaren Zustand zu gelangen. Um unsere Aufgabe aber so bildhaft als möglich zu lösen, weil das Bildliche eher begriffen, wird und besser im Gedächtnis haften bleibt, so wollen wir dem Manne in seiner Wüste weiter folgen und dabei sehen, wie er zur Erkenntnis des ihm Abhandengekommenen finden konnte, und was es eigentlich war, das ihm abhanden gekommen war: Ihn beschäftigte stets mehr die Erkenntnis, dass es ihm bei den wirklichen Menschen anfangs einer Begegnung immer leichter wurde, mit der Zeit jedoch unerträglicher als bei den Wüstenbewohnern. Dabei fand er heraus, dass alle wirklichen Menschen – wie er sie nannte – ihm durch ihr Mitfühlen bestätigten, dass seine eigenen Gefühle seiner Lage angemessen, und deshalb nicht nur verständlich, sondern sogar folgerichtig waren. Nur: mit dieser Bestätigung erreichte er immer nur ein noch vertieftes Fühlen seines Zustandes und der Hoffnungslosigkeit seiner Lage, sosehr ihn – anfangs wenigstens – die übereinstimmende Beurteilung darin beruhigen konnte, dass er keiner Täuschung erlegen war – wie er sich oft zu glauben genötigt fühlte, wenn er die Teilnahmslosigkeit der Wüstenbewohner – dem seinen und ihrem eigenen Geschicke gegenüber – empfand. Begegnete er aber den Wüstenbewohnern und hatte Kontakt mit ihnen, so beengte ihn zwar anderseits die Frage, ob denn wirklich sie, oder vielleicht doch er selber, die Situation richtig erkennen und einschätzen. Denn obgleich zwar beide in derselben Wüste waren, so machten sich diese dennoch nichts daraus, bestanden aber ebenso gut und ebenso lange darin wie er selber und fühlten sich nicht einmal schlecht dabei, während er selber sich grämte und unruhig nach einem möglichen Verlassen dieser Gegend strebte, ohne jedoch die geringste Aussicht auf Erfolg zu haben. Er musste also erkennen, dass eine Ignoranz – dieser Situation gegenüber – zwar seinen Gefühlszustand erleichtert hätte, jedoch anderseits seinen steten Orientierungsbemühungen zuwider liefe, während tiefes Mitempfinden anderer ihm zwar wiederum die Gewissheit seiner richtigen Lageeinschätzung brachte und ihm darin Ruhe verschaffte, ihn jedoch eben diese missliche Lage noch um vieles deutlicher empfinden liess. Das war für ihn ein scheusslicher Kreis, in dem er sich fortwährend bewegte. Die Lüge und die Ignoranz trieben ihn an, sich und seine Lage stets von neuem genauer zu bestimmen und klarer festzuhalten und ermüdete ihn sogestaltig. Wenn er aber dann zur Bestätigung seiner Lage durch das Mitempfinden anderer kam, so legte sich zwar das Gefühl des Hinundhergetriebenwerdens, aber es kam eine so grosse Last der fürchterlichen Erkenntnisgewissheit über ihn, die ihn sosehr lähmte, dass er nur noch den letztendlich vor ihm stehenden Tod in grausam unausweichlicher Art zu fühlen begann. Dieser teuflische Kreislauf ist ein typisches Merkmal der Depression. Es ist die Verzweiflung! In dieser seiner grössten Verzweiflung traf er einmal auf einen Menschen, der ihn etwas anders dünkte als alle andern bisher. Zwar hatte er tiefes Mitgefühl, wie alle andern auch, aber er schien irgendetwas in seinem Hintergrunde zu haben, das beruhigend auf ihn einwirkte. Seine Nähe tat ihm wohl, denn er erkannte, dass dieser Mensch zwar die Lage selber ebenso fühlend einschätzte wie er, aber sie dann irgendwie anders beurteilte, was ihm offenbar auch die von ihm empfundene, aus ihm ausströmende Ruhe verlieh. Dieser sagte im Verlaufe eines Gespräches einmal zu ihm: "Diese Wüste wirst du niemals erfassen und begreifen können, so sehr du dich auch darum bemühst; und sie ist auch so gross, dass du sie aus eigener Kraft nicht verlassen kannst, das habe ich selber schon vielfach erfahren und erprobt. Die grossen und allgemeinen Verhältnisse lassen sich im äussern vom Menschen beinahe nie ändern, die liegen in Gottes Hand. Aber die innern Verhältnisse kannst du ordnen und beleben; sie sind der einzige Kontrast zu dieser Wüste hier." Unser Mann fragte ihn, wie er das meine, und er erklärte ihm weiter: "Das heisst, du musst nicht fortwährend diese Wüste ansehen und sie durch ihr Bild auf dich einwirken lassen, sondern du musst über ihr Wesen nachdenken und sie dadurch in ihrem Innern zu erfassen trachten, anstatt dich in ihrem äussern Bild versinken zu lassen." – "Was lässt sich über Sand schon denken?" warf der Mann ein, und sein Gegenüber sagte: "Über den Sand lässt sich vielleicht nicht so viel denken als über das Leben selbst in diesem Sande. So habe ich zum Beispiel überlegt, wieso ich denn mit dem wenigen Trank mein Leben so lange fristen kann. Und mir ist dabei aufgefallen, dass ich ohne Nahrung so lange ausgehalten habe, dass es meinem Verstande als unmöglich vorkommen muss. Folglich geht es hier nicht nach dem Rat unseres Verstandes zu und her, sondern nach einem höheren Rat. Und um diesen höhern Rat müssen wir uns zu kümmern beginnen, wenn wir Erfolg haben wollen, und zu einem Fortschritt kommen wollen. Dabei war mir klar, dass der spärliche Tau dieser Wüste ein Geschenk des Himmels ist zur Fristung unseres Lebens. Und ich suchte darum nach einer Möglichkeit, diesen direkt vom Himmel her zu erhalten, anstatt aus der Hand der Wüstenbewohner, die denn trotz ihrer scheinbar billigen Preise Wucherer sind, weil sie das gratis Erhaltene verkaufen wollen. Und dabei merkte ich, dass an gewissen Punkten sich die Feuchtigkeit der Luft mehr kondensierte als an andern; und unter diesen suchte ich einen aus, der mir am angenehmsten war. Er war am Grund einer grossen Wand, vor welcher sich der Sand des Bodens etwas vertiefte, wie wenn grosse Luftwirbel, die sich im Sturme über der Wand ergaben, den Boden dort weggetragen hätten. Anfangs war ich nur während der Nacht und morgens früh dort, wenn der Tau als kleinstes Rinnsal die Wand herab lief und sich unten in der Mulde eines hohen, aber flachen Steines sammelte. Mit der Zeit aber begann ich diesen Platz, der zwar der düsterste war, weil er gegen Norden lag und die Wand südlich davor stand, dennoch als einen Wohnplatz zu lieben, weil mir da so viel des himmlischen Taues zukam, dass ich ohne Hilfe der Wüstenbewohner mein Leben fristen konnte. Und ich entfernte mich nur noch ganz selten von ihm. Mit der Zeit kam er mir auch etwas wärmer vor und ich begnügte mich von da an, auf ihm zu verweilen und meine Betrachtungen über alles Vorhandene anzustellen und wurde dabei oft recht heiter sogar wenn ich mir vergegenwärtigte, wie wohlversorgt ich doch bei aller Kargheit dieses Lebens bin. Die Wüste kann und will mir zwar nicht gefallen, aber mir gefällt, dass ich darin gar nichts mehr zu suchen und zu sorgen habe, sodass ich sie auch gar nicht mehr anzusehen brauche; ich nutze sie nur an ihrem günstigsten Punkte zur Fristung meines Daseins." Nun wollte aber unser Mann wissen, wo sich denn diese Wand befinde und wieso er denn diese Wand nun verlassen habe. Der andere gab ihm folgende Antwort: "Du musst dir nicht eine Wand in den Himmel hinein vorstellen, sondern eine Feste im Boden! Die Wand, die mir Schutz gibt, ragt nicht viel mehr als eine Mannshöhe aus diesem Sandmeer heraus, aber wie gesagt, der Wirbel der Winde grub sie einseitig aus, so dass sie mir einen geschützten Platz gewährt. Ich kann sie dir darum nicht zeigen, weil du sie nicht finden könntest zufolge deiner noch völlig falschen Vorstellung. Du würdest sie nicht er-kennen, auch wenn du sie sähest. Aber Ich weiss es, dass es überall in dieser Wüste solche Stellen gibt, denn schliesslich war vor dieser Zeit einmal ein weites Felsmassiv an dieser Stelle, das erst mit der Zeit so sehr verwittert wurde, dass so viel Sand und Wüstenschutt auf ihm zu liegen kam. Darum auch lässt es sich schon finden, wenn man danach sucht. Verlassen habe ich meinen Platz aber nur kurz, um dir das zu sagen, weil ich dich schon mehrere Male umherirren gesehen habe." – Das erschien unserem Mann allerdings etwas merkwürdig. Dennoch aber erwärmte und belebte ihn die Schilderung derart, dass er sich ordentlich wohler fühlte als je zuvor in dieser Wüste. Es verging zwar noch einige Zeit, ehe er sich dann allen Ernstes völlig zur Suche nach einem geeigneten Platz zum Bleiben in dieser Wüste aufraffen konnte. Aber als er einmal allen Ernstes wirklich zu suchen begann, entschlossen, sich einen Bleibeplatz in dieser Wüste einzurichten, da fand er dann noch bald einmal eine kleine Vertiefung im Boden hinter einer leichten Düne, bei deren Untersuchung er merkte, dass eine kleine Wand ihre Ursache war. Dort liess er sich nieder. Zwar nicht mit dem dankbaren Gefühl, das ihm der andere von sich geschildert hatte, aber dennoch mit einer kleinen Genugtuung, darin seinen eigenen festen Platz gefunden zu haben. Da endlich verliess ihn die Unruhe durch das vergebliche Suchen ein wenig, und er begann sich des Morgens über den spärlichen Tau zu freuen, der sich in einer Nische der Wand gesammelt hatte. Er kümmerte sich weniger mehr um die Verhältnisse in der grossen Wüste, sondern viel mehr um die kleine, um ihn liegende Welt seiner Mulde, die ihm bald einmal wie von seinen eigenen Hoffnungsgedanken erfüllt erschien, sodass sie für ihn wie eine freundliche Rückstrahlung all seiner positiven Gedanken wirkte. Darin genas er so weit, dass er sich etwas stärker fühlte und mit dieser Stärke auch wieder das Sinnen nach Verlassen der Wüste in ihm aufkam. Als er dann eines Tages sich entschloss, von neuem aufzubrechen und diesen Ort, der trotz seiner Vorzüge das Gefühl eines Gefängnisses in ihm erzeugen konnte, zu verlassen, erlebte er von neuem diese Wüste, wie sie wirklich war. Sodass er äusserst geschwächt und beunruhigt am späten Abend wieder zurück in seine Mulde fand, die ihm aber nicht mehr so voll und wohnlich erschien, sondern leerer und nüchterner wirkte. Warum auch hatte er alle seine Gedanken von ihr abgezogen gehabt und gesammelt zum Start in eine ungewisse Reise?! Nun konnte er wieder von vorne beginnen. Es verstrichen etliche Tage und Wochen, bis er sich endlich wieder mehr zu Hause fühlte, so sehr hatte dieser einmalige Fluchtgedanke sie ihm entfremdet gehabt. Aber nun begann er sich tiefer zu besinnen und er fand in sich die Entdeckung seines früheren Lehrmeisters bestätigt, dass über dieser Wüste dennoch eine andere Ordnung bestehen müsse. Wie sonst hätte er sein Leben mit blossem Wasser fristen können. Lange dachte er über diese Verhältnisse nach. Dabei fiel ihm auf, dass er dieselbe Wüste um sich herum weniger als Wüste empfand, als die grosse, weite Wüste, in der er sich befand. Also müsste in ihm selbst etwas sein, das dem Allgemeinen dieser Wüste abging. War es die Erkenntnis der rechten Ordnung, in welcher das Erkennen lag, dass alles lebensnotwendige aus dem Himmel kommt, und nicht aus dieser Erde, so wie der Tau, dieser Trank zum Leben – so fragte er sich. Zu dieser Zeit besuchte ihn zum ersten Mal jener Mensch wieder, der ihm den Ratschlag erteilt hatte, sich einen stillen Platz in dieser Wüste zu suchen. Und er bestätigte ihm seine Vermutung und vertiefte seine Erkenntnis noch dadurch, dass er ihm erzählte, dass er empfunden habe, dass auch der äussere Himmel, obwohl zwar für den im Innern blinden Menschen Symbol des wahren, innern Himmels, bloss nur materiell sei und deshalb zwar Wasser zur Fristung des Lebens habe, aber niemals Nahrung zur Stärkung des innern, wahren Menschen. Und da habe er begonnen, zum innersten Punkt dieses Himmels seine Gedanken zu erheben, der ja Gott sein müsse, welcher durch all seine Gedanken erst die tote Materie als Unterlage für seine Menschenkinder geschaffen habe. Und er habe ihn gebeten, ihm einmal eine stärkende Kost zukommen zu lassen. Da seien einmal in einer Nacht Körner hernieder gefallen, die er am Morgen erstaunt aufgefunden habe und deren Verzehr ihm ungemein wohl tat und ihn auch gestärkt habe. Endlich seien nun bei ihm schon auch kleine Kräuter gewachsen. Er, der Mann, solle doch nur probieren, auf die Kraft und Macht Gottes zu vertrauen, und sich alles von ihm erbitten, und es nicht von der stummen und leeren Erde erwarten. Dieses Gespräch tat unserm Manne äusserst wohl. Bestätigte es doch seine bisher noch vagen Vermutungen und erfüllte seine bisherigen unbestimmten Gefühle mit genauen, ihnen entsprechenden Bildern. Und in der Folge richtete er sich nach dem Ratschlage, beschäftigte sich stets mehr mit Gott, der ihm bald wie ein liebender Vater vorkam, anstatt mit der Wüste dieser Welt. Es verging zwar noch eine geraume Zeit, bis auch er einmal das Brot aus dem Himmel bekam, denn er bat anfänglich doch noch mehr ums Angenehme des Brotes als um den Segen der göttlichen Kraft, der alleine das wahre Brot ist, das den Menschen erfüllt. Aber mit der Zeit erkannte er auch diese Umstände stets mehr und besser und es begannen auch bei ihm Kräuter zu wachsen und begrünten seinen kleinen Teil der Wüste mit der Zeit so sehr, dass er die übrige Wüste nur noch durch die grünende Vegetation seiner eigenen Mulde erblicken konnte, sodass ihm am Ende das Gefühl der Wüste ganz benommen war. Denn eine Wüste, die nicht mehr bis zu ihm selber dringen konnte, empfand wenigstens er auch nicht mehr als seine eigene Lebensgrundlage. Seine Grundlage war Gott, dessen Geist zwar über dieser Wüste wirkend schwebte, sie aber überall als das beliess, was sie war, und nur in den Herzen der Menschen sie füllte mit dem Licht und der Wärme seines eigenen Wesens und sättigte mit der Kraft seiner Liebe, die alles hergibt, wenn es nur des Menschen Seligkeit in der Freiheit der Liebe zu ihm erhöht. Auf diese Art war dann nicht nur seine Prüfung zu ende, sondern es begann sein Hineinwachsen in den inwendigen Himmel. Nun, was also hatte diesem Manne gefehlt; was war ihm abhanden gekommen, dass er so depressiv wurde, bis er um sich herum nur noch eine Wüste sah? War es nicht die rechte Ordnung, die dem Geistigen oder der Kraft den Vorzug vor dem Irdischen, der Materie, einräumt und dadurch zum bestimmenden Element all seiner Gefühle, Gedanken und am Ende auch all seiner Handlungen macht? Und war es nicht seine Unfähigkeit, dem Wirken dieser Kraft, genügend Verständnis und Liebe entgegenzubringen, um ihre Vorteile gegenüber toter Materie klar zu erkennen? Nur – so lässt sich fragen –, hatte er diese Ordnung denn vor seiner Depression überhaupt gehabt? Fast jeder Mensch hat aus seiner Jugendzeit her eine gewisse Ordnung durch seine – wenn auch manchmal noch so schlechte – Erziehung erhalten und findet darin einen Dienst am Höhern, über ihn Hinausragenden. Solange diese Ordnung, wenigstens in den grossen Zügen auf das Wohl des Ganzen ausgerichtet bleibt, solange auch besteht eine Verbindung, zwischen dem Individuum mit dem Idealen, und darum auch – wenn auch unbewusst – mit Gott, und über ihn auch wieder mit der Allgemeinheit. Es kann allerdings bei ganz schlechter Erziehung auch geschehen, dass ein Kind mit der Zeit den Eltern seinen Gehorsam verweigert, weil es einsieht, dass die geforderte Ordnung nicht dem allgemeinen Wohle dient; sodann verlässt es zwar die äussere Ordnung, die nur seinen eigennützigen Eltern gedient hätte, aber es wird durch eine neue, in seinem jugendlich empfänglichen Gemüt durch seine Liebe aufgefundene Ordnung dennoch mit dem Idealen und dadurch mit dem Wohl der Allgemeinheit verbunden bleiben. Diese Ordnung kann allerdings wieder gestört werden:
Das sind drei Möglichkeiten, welche die anfängliche, wenn oft auch noch so jugendlich unvollkommene Ordnung zerstören können, während beim Erhalt einer solchen Ordnung diese mit der Zeit stets verbessert und vervollkommnet werden könnte. Eine blosse Störung – nicht Zerstörung – hingegen verursacht zwar Probleme, kann dadurch aber auch zu neuen Einsichten führen. Daneben gibt es aber noch eine weitere Möglichkeit: Eine solche Ordnung kann auch – ungestört – versanden in blosser Äusserlichkeit, die nur noch zum Scheine den andern dient. Das ist dann der Fall, wenn eine ganze Gesellschaft durch gute Verhältnisse verleitet wird, vorzüglich den äussern Verhältnissen Sorge zu tragen, weil sie nicht mehr erkennt, dass es bloss die innere Ordnung ist, welche äussere Verhältnisse angenehm zu gestalten vermag. Menschen, bei denen das geschieht, gehören zu den bedenkenlosen Wüstenbewohnern, die alles tun, als wäre es zu etwas nütze, und die sich nicht daran stossen, dass alles vergeblich ist. Sie haben ein System, in das sie eingebunden sind. Sie sind nicht mehr sich selber und fühlen sich auch nicht so. Vielmehr sind sie wie die andern und darum auch nie alleine und nicht einsam. Bei allen Störungen einer Ordnung hingegen ergibt sich eine Abkoppelung vom Ideal – wie immer es ausgesehen haben mag – und dadurch dann auch von den andern und ergibt so eine gewisse Sinnlosigkeit des eigenen Seins. Denn alles was nichts nützt und auch in sich selber keiner Wandlung im Sinne einer Entfaltung und Entwicklung mehr fähig ist, das ist dem Sandkorn in der Wüste gleich, das ohne jede Bindung neben den andern Sandkörnern liegt. Wäre nur schon Wasser vorhanden, so würde sich das Sandkorn ändern können durch seine Wechselwirkung mit dem Wasser. Aber es hat eben keine Strukturen oder keine solche innere Ordnung oder Aufbau, welcher das Wasser aufnehmen und damit zum Bleiben nötigen könnte. Solange die äussere Hülle, das ist der Leib eines Menschen, intakt bleibt, solange auch bemerkt das innere, seelische Wesen des Einzelnen dieses Losgelöstsein weniger, denn es ist ja mit seinem Leib verbunden, der ihm fortlaufend Eindrücke vermittelt und damit Genüsse und Abwechslung verschaffen kann. Wird jedoch die äussere Hülle in irgendeiner Weise tangiert, so lockert sich die Bande zwischen dem Kern (der Seele) und ihrer Hülle (dem Leib). Aber ohne diese Hülle ergibt sich im Leben des Kerns dann keine Abwechslung mehr, und darum auch kein Genuss mehr, weil der Kern für sich nicht entfaltet und entwickelt worden ist und darum für sich selbst keiner Veränderung mehr fähig ist. Zudem spürt er die Beziehungslosigkeit, weil es eine Beziehung – ausser jener zum leiblich Materiellen – gar nie wirklich gegeben hatte. Das Erleben und Erkennen dieser Tatsachen ist Folge einer Veränderung im Verhältnis zwischen dem Kern und seiner Hülle, seinem Leib, so wie es darum auch Menschen, die kurz vor dem Tode stehen, empfinden können, wenn sie sich während ihres Lebens an nichts gebunden haben, das über ihnen steht. Das Bestehen dieser empfundenen Sinnlosigkeit hingegen liegt in der Zerstörung der Ordnung einer Verbundenheit mit dem höhern Zweck des Ganzen – war also schon lange vor dieser Empfindung existent. Das also ist der Vorgang und das Gefühl dabei, wenn eine Störung oder Zerstörung dieser Ordnung im Individuum selbst stattgefunden hat. Liegt die Störung oder Zerstörung in der Allgemeinheit, so kann beim einzelnen Individuum – besonders in seiner Jugendzeit – bereits ohne eine seelisch-körperliche Veränderung ein depressiver Zustand eintreten, weil das einer innern Ordnung noch angehörende und darum mit dem Wohle der Allgemeinheit noch verbundene Individuum seine Bindung an die andern verspürt und darum bei einer Sinnlosigkeit dieser Verbindung auch ihr Versagen. Wenn solche Menschen aufgeklärt werden können, dass der vorwiegende Sinn einer Ordnung in der innerlichen Weiterentwicklung besteht, mithin also erst jenseits der Hülle – oder jenseits des leiblichen Zustandes – offenbar wird, so können sie sich an jene höhere Ordnung binden, die ihre Entwicklung garantiert, und können dann durch ihr Vorbild den andern immer noch eine Chance geben. Es finden sich in der Bibel mehrfach Aussagen, dass sich die Liebe des Menschen vor allem auf Gott, auf die Vollendung, richten soll und erst in zweiter Linie der gedeihlichen Verbindung, untereinander. So gesehen ist das in der Liebe festgehaltene Ziel erst der Garant einer bleibenden gedeihlichen Verbindung der Menschen untereinander. Liegt die Störung im Ungleichgewicht der Mittel gegenüber den Pflichten des Einzelnen, so besteht sie fast immer in einer Verkennung sowohl der Mittel, als auch der Pflichten. Kein Mensch kann von Gott, dem Vollendeten, gehalten sein, mehr zu tun, als ihm möglich ist. Also sind entweder die Ansprüche, die andere an ihn stellen oder ihm implizieren, zu hoch oder gar grundfalsch, oder er versteht im gegenteiligen Falle nicht, seine Mittel richtig anzuwenden. Erstes Mittel ist und bleibt stets der gute und feste Wille. Reicht dieser bei aller daraus resultierenden Regsamkeit und Tätigkeit nicht aus, so gehört auch eine Ergebung in einen offenbar höheren – vollendeteren – Willen Gottes zu den möglichen Mitteln. Denn, wer weiss schon, was Not alles Gute zu bewirken imstande ist?! Wer weiss demzufolge aber, wo und wann eine Not zu beenden ist, als alleine der Vollkommene. Haben wir den Ernst und den Willen zur Beendigung einer Not bei den andern und auch die Mittel dazu, so tun wir das uns Mögliche. Haben wir hingegen die Mittel nicht und werden uns auch keine gezeigt, so ist offenbar die äussere Not das angezeigte Mittel zur Beseitigung einer innern Not – eines Notstandes in der Entfaltung des wahren Lebens – so, wie es ja der Depressive an sich selber erleben muss. Solange der Mensch gesund ist, meint er, selber schon alles zu können und auch recht zu machen. Man kann es ihm nicht verdenken. Wenn er aber nicht mehr selber fähig ist, das ihm Gutscheinende zu tun – warum versucht er nicht mindestens dann, ob nicht doch über ihm noch andere, vollkommenere Kräfte sind, und ob er sich mit ihnen nicht in Verbindung setzen kann durch das einzige Mittel, das einer Bindung überhaupt fähig ist: durch seine Liebe – nicht durch Grübeleien seines Verstandes! Wer es lebenstief spürt, dass er ein Ziel, einen Beschützer, einen Vater nötig hat, der kann ihn doch zu lieben beginnen, sofern er in seiner Not nur zu erkennen beginnt, dass nicht der Vater schuldig ist an seiner Isoliertheit, sondern er selbst durch seine Sorglosigkeit ihm gegenüber bei all seinem bisherigen Tun. Wem dieses Lieben gelingt, dem wird auch werden, was er braucht – vielleicht nicht sofort und nicht vollumfänglich; zuerst nur nach und nach, sodass ihm seine Liebe auch als begründet erscheinen kann, und dann erst – bei einer Steigerung der Liebe durch ihr Erfülltwerden – auch stets umfänglicher. Je tiefer ein Mensch all seine Fehlhaltungen fühlend und begreifend einsieht, desto mehr erkennt er auch die Notwendigkeit einer grösseren Kraft, die seine Belange wieder in Ordnung bringen kann, und mit desto mehr Liebe kann er sie umfassen, sofern er weiss, dass diese Kraft, an der er durch bisherige Ignoranz so schuldig geworden ist, ihm nichts nachträgt, sondern seine Rückkehr gar mit Freude erwartet. (Für diese Tatsache steht in der Bibel das Gleichnis vom verlorenen Sohn, der von seinem Vater herzlich empfangen wurde, als er elend, aber mit aufrichtiger Reue wieder zu ihm zurückgekehrt war.) Zu dieser innern Annahme und Vereinigung mit der göttlichen Kraft bedarf der Mensch keines Priesters und keiner äussern Kultushandlung, sondern nur seiner liebebegeisterten Erinnerung an das Wesen eines gütigen Vaters, der pur Liebe ist ("Gott ist Liebe"[1. Joh. 4. 16]), aber in dieser Liebe auch jedem die Freiheit lässt, sosehr den Menschen diese dann auch quälen kann, wenn er sie missbraucht hat. Aber – er kann sie ja anderseits dann auch wieder benutzen, wieder zurückzukehren in die Liebeordnung Gottes. Wenn wir das Dargestellte voll in uns wirken lassen, so müssen wir erkennen, dass die Depression nicht selber eine seelische Krankheit ist, sondern nur ein tieferes Einsehen und Fühlen der gestörten innern Ordnung – durch eine krankhafte Schwächung des leiblich-seelischen Verhältnisses erst ermöglicht –, das, wenn es länger anhält, auch zur Chance einer endgültigen, innern Heilung werden kann – wenn auch Dauer und Verlauf des Heilungsprozesses sehr von der höheren Ordnung Gottes abhängen und vor allem von der Intensität unseres Wunsches und Willens, zu ihr alleine Zuflucht zu nehmen und ganz zu ihr zurückzufinden. Grössere und kleinere Abweichungen von der innern Ordnung sind allerdings bei einem jeden Menschen mehr oder weniger vorhanden – weil wir ja alle erst vollkommen werden müssen –, sodass also ihr Erfühlen und Erkennen jedem zur Chance werden könnte, obgleich anderseits nicht alle schon während ihres irdischen Lebens mit ihnen, oder ihren bildhaften Rückwirkungen auf sie, konfrontiert werden. Wenn wir eine Depression also als eine Krankheit behandeln wollen, so versuchen wir nichts anderes, als dem Sehenden in einer Wüste die Augen zu verbinden, anstatt ihn aus seiner tatsächlichen Wüste zu führen oder zu befreien. Es gibt in der Tat einige Möglichkeiten, die Augen solcher Sehenden zu verbinden. Die erste und natürlichste ist die Ablenkung von der Wahrnehmung ihres innern Zustandes durch eine äussere Betätigung und mit äusseren Darbietungen, was bei leichten Depressionen auch versucht wird. Sie ist sogar (vor dem vollen Ausbruch einer Depression) eine Zeitlang ohne weiteres wirksam durch den normalen aber extra betonten Lebensablauf der äussern Welt, sodass solche, die sich eigentlich schon darin befinden, ihren Zustand vorerst nur mehr vermuten als wirklich erkennen oder gar vollumfänglich wahrnehmen. Da aber der Zustand einer solchen Wüste ein innerer ist und deshalb nur der puren, von ihrem Leibe mehr getrennten Seele nachhaltig deutlich werden kann, so liegt eine gewisse Möglichkeit im leiblich-medizinischen Bereich, solche Purheit der Seele durch geeignete Mittel – durch Wiederverknüpfung mit dem Leib – wieder aufzuheben. Wer die Verhältnisse einer Depression in diesem Sinne überprüfen wird, und zudem die Problematik solcher Medikamente kennt, der wird leicht erraten, dass es sich dabei wirklich um eine blosse Augenbinde handelt, die durch eine Veränderung im Körperhaushalt die Seele wieder fester an ihren Leib bindet, sodass sie die äusserst subtilen Empfindungen ihres eigenen Zustandes nur wenig mehr wahrnimmt. Die logische Folge davon ist, dass sie ihre Mankos, ihre vom Verstande hergeleiteten Fehlbilder und ihre Schwächen nicht mehr erkennt, sie also weiterhin in sich behält oder gar weiter ausbildet und schlussendlich einmal mit ihnen von neuem konfrontiert wird, was dann meist einen schlimmeren Zustand bewirkt, als der erste war. Denn erstens wird eine solche Seele mit zunehmendem Alter nicht tüchtiger, sondern nur untüchtiger, und zweitens verbaut sie sich für das jenseitige Leben Chancen, die sie nur während der Tragung ihres Leibes – also diesseits nutzen kann. Gewisse seelische Zustände vor dem nahenden Tode lassen sich auf dasselbe Geschehen zurückführen, weil in dieser Phase, durch die Anstrengung der Krankheit bedingt, aber auch durch den Kräfteverschleiss durch übermässige Angst bedingt, die Seele sich mehr von ihrem Leibe zu lösen beginnt und dadurch eher ihre wirklichen, innern Verhältnisse zu ahnen und zu fühlen anfängt. Es muss gerade aus dieser Sicht der Dinge von Seite des Arztes viel eher darauf geachtet werden, dass eine solche Lockerung der Verbindung von Seele und Leib nicht etwa durch irgendwelche äussern Mittel verursacht worden ist, welche den Menschen einfach an den Rand seines äussern Lebens gebracht haben, wo er dann – beim Fortwirken solcher Mittel – gar leicht auch seinen Tod finden könnte. Insbesondere sind Vergiftungen jeglicher Art, besonders schleichende, also beispielsweise auch durch längere Zeit eingenommene Medikamente bedingte, oder durch gewisse Nahrungs-mittel verursachte, aber auch durch schleichend, schwächende Krankheiten bedingte, fähig, einen Menschen an einen solchen Punkt zu bringen. Es ist klar, dass wir einerseits alles überprüfen müssen, was diesen Zustand der Depression herbeiführen konnte, denn eine im Äussern verschuldete Depression dürfen wir keinesfalls einfach bestehen lassen, sondern müssen deren erkannten Grund beseitigen. Nur wird das besonders bei chronischen Vergiftungen nicht so schnell zum Verschwinden der depressiven Erscheinungen führen. Und diese Zeit müssen wir nutzen, im innern Feld eines Menschen so viel wie möglich ordnen zu helfen, damit er mit der völligen Wiedergesundung im leiblichen Bereich dann möglicherweise auch gerade sein inneres Feld geordnet hat. Wie leicht kann es dabei geschehen, dass er noch während seiner leiblichen Schwäche wieder zuversichtlicher und liebevoller, aufmerksamer und hingebungsvoller wird, sodass er zu einem ruhigeren Erleben kommt, und dadurch auch die leibliche Wiederherstellung rascher als üblich fortschreiten kann. Also wollen wir lieber sehen und erkennen, was eine Seele vor allem zu tun hat, um diese ungemütlichen innern Zustände für immer – weil grundlegend – loszuwerden. Eigentlich ist dieser Vorgang samt dessen Wirkung auf die Seele bereits in der Forterzählung des Bildes dargestellt, sodass es genügt, dieses Bild in seiner Entsprechung zu erklären und zu begreifen: Dass der Seele – als dem alleine empfindenden Teile des Menschen – ihr innerer Zustand ihrem Gefühle nach einer Wüste gleicht, wie die meisten Depressiven bestätigen können, oder dann einer Nacht, hat seinen Grund darin, dass zufolge des Fehlens einer höheren (also allen dienenden) Ordnung alle ihre Empfindungen, Gedanken und Gefühle nicht mehr in einer ordnungsmässig organischen Verbindung zueinander stehen. Diese Verbindung wäre die geordnete Liebe und das aus solcher Liebe fliessende Licht. Darum auch sind Nacht und Wüste sehr ähnliche Bilder für ein und denselben Zustand. Denn in der durch Wanderdünen schnell sich ändernden Wüste ist eine Orientierung ebenso unmöglich wie in einer sternenlosen und deshalb stockfinsteren Nacht. Die allseits losen, weil nirgends geordneten und festgehaltenen Sandkörner gestalten die Landschaft je nach Wind, Sturm und Wetter in kürzester Zeit anders, sodass die stets ändernden Bilder dem Menschen ebenso wenig zur Standortbestimmung dienen können wie die völlig lichtlose Nacht. Dasjenige, was eine Landschaft festigt und belebt, ist das Wasser, und dasjenige, das den Menschen – seinem Erkennen nach – mit der Landschaft verbindet, ist einzig das Licht. Fehlt also einer Landschaft das Wasser, so wird sie vegetationslos, leer, und ihr Boden ist allen Winden preisgegeben bis diese ihn weggefegt haben, sodass der darunter liegende Fels und Stein der glühenden Sonnenhitze ebenso ausgesetzt ist wie der Kälte der Nacht, welche starken Gegensätze ihn so sehr beanspruchen, dass er in sich zerrissen wird und nach und nach zu zerbröckeln und zu zerfallen beginnt bis in die kleinsten Sandteile, die wiederum zum Spiel der Winde werden. Da kann kein Leben mehr walten. Fehlt dem Menschen das Licht, so steht er in jeder Landschaft wie in einer Wüste, denn wie das Wasser den losen Sand verbinden könnte zu einem Brei, dem mit der Zeit wieder Pflanzen entwachsen könnten, ebenso verbindet das Licht durch seine Fülle von Strahlen und Widerstrahlung den Menschen durch sein Aufnahmeorgan des Lichtes – das Auge – mit allen Gegenständen um ihn herum und damit also mit einer ganzen Landschaft, die er dann völlig folgerichtig zu erkennen vermag, indem er genau wahrnimmt, was ihm zunächst sich befindet und was weiter weg von ihm ist und wie allenfalls der Boden beschaffen ist, der zwischen ihm und den ihm zunächst sich befindenden Gegenständen, aber auch den weiter weg sich befindenden, sich ausbreitet. Gäbe es diese Lichtstrahlen nicht, die durch ihre Widerstrahlung von den nahen und fernen Gegenständen wie ein Echo vom menschlichen Auge aufgenommen werden, wie könnte er sie auch wahrnehmen und ihrer Ordnung nach erkennen?! Müsste er nicht zwischen ihnen herumirren wie ein Wanderer in der Wüste? Wie der Mensch mit der äussern Landschaft durch das Licht verbunden ist, so ist er inwendig in seiner Gemütslandschaft durch die Anteilnahme mit der Gemütsgestaltung anderer Menschen verbunden. Diese Anteilnahme erfolgt aber erst bei einer gewissen Erwärmung seiner Liebe über den Gefrierpunkt hinaus. Beides also, Wüste und Nacht, sind deshalb Bilder oder Ausdruck ähnlicher seelischer Zustände, welche dadurch zustande kommen, dass die wahre Bewegung, der Austausch und die Verbindung in ihm fehlen, und dadurch auch eine geregelte Tätigkeit, die dem wahren Fortschritt oder der innern Harmonisierung dient. Fehlt einer Seele das rechte Mass an Liebe, so wird das Lebenswasser in ihr erstarrt bleiben, wie das Eis in den Öden der Polargebiete erstarrt bleibt. Ist diese Liebe aber insoweit, das heisst bis zu jenem Grade von Wärme vorhanden, die das Eis zum Schmelzen bringt – was eben noch keine besondere Wärme für das menschliche Empfinden darstellt –, so kann sich das Leben entwickeln, das heisst sich in immer höheren Formen zu ergreifen beginnen, was in der Natur stets nur durch das Wasser geschehen kann. Denn dieses löst die toten Salze des Gesteines und hält sie dem ersten und noch primitivsten oder einfachsten Leben in den Infusionstierchen zur Verfügung, die sie ihrer primitiven Ordnung gemäss verwenden zum Aufbau ihres Körpers. Die Ordnung oder die Verbindungen in solchen dienen dann, wenn das Leben aus ihnen gewichen ist, schon einer höheren Pflanzenklasse zur Lebensgrundlage, deren Überreste dann wieder den Nährboden für das Wachstum nächst höherer Klassen bildet, welche dann bei ihrem Absterben die Humusdecke über dem kahlen Gestein schon beträchtlicher mehren, bis schliesslich eine üppige Vegetation die ganze Landschaft überzieht, die durch ihren regen Gebrauch des Wassers, dieses Sinnbildes allen Lebens, eben dasselbe Wasser festhält in der jeweiligen Ordnung ihrer Wesensart, aber auch selbst noch im Humus, diesem Gebilde aus dem verwesenden Kleid des vorhergehenden Lebens. Wäre aber diese Ordnung nicht – nicht schon in kleinsten und primitivsten, ersten, bloss einzelligen Lebewesen –, wie hätte sich die gediegenere Ordnung in einem höheren Wesen entfalten können, und wie gar die zusammenhängende Ordnung einer ganzen Vegetation, in welcher eines das andere unterstützt und eines dem anderen dient. Und wie hätte das spätere tierische Leben ermöglicht werden können, wenn nicht durch die ordnungsgemässe Vorarbeit der Pflanzen, deren materieller Teil eben diesen Tieren zur Nahrung dienen muss. Also kann nur Bewegung, Austausch und Verbindung, aber nur in einer von Gott, dem Ursprung, gewollten Ordnung – und nicht nach dem Zufall in der Natur – den nackten, noch unbelebten Stein bedecken und ihn schützen vor der Zerstörung durch die Übermässigkeit von Wärme und Kälte und gleichzeitig dessen innere Kräfte frei machen für ein künftiges, organisches Leben. Dasselbe muss auch im menschlichen Gemüt geschehen, dieser Grundlage zu einer möglichen Entwicklung, hin bis zur Gottähnlichkeit. Wenn es in ihm einmal durch eine Sammlung der Liebe um ein gewisses höheres Ziel zur Wärme gekommen ist, welche das Wasser lebendiger Anteilnahme aus der Starre der frühkindlichen Phase zu schmelzen beginnt, so entwickeln sich in ihm Gedanken, Vorstellungen und Ideen. Auch hier vorerst in allerprimitivster Form. Durch reichliche Betätigung nach diesen ersten Vorstellungen und Ideen werden diese stets gediegener und beginnen sich zu vervollkommnen. Das sehen wir daran, wie ein Kind mit den Dingen umgeht. Am Anfang einer jeden Liebesregung steht die Selbstliebe, die sich alles einverleiben will. Darum nimmt das Kleinkind alles in den Mund. Daraus beginnt es zu erkennen, dass nicht alles Nahrung ist, oder nicht alles bestimmt ist, in seinen Bauch zu gelangen, sondern die Bestimmung hat, ihm etwas zu zeigen, es also bloss geistig zu nähren. Die Würfelform eines Bauklotzes beispielsweise ist da vorzüglich geeignet, ihm die ersten Begriffe von Geometrie und Physik zu vermitteln. Es beginnt zu erkennen, dass er mehrere Seiten hat, die es durch ordentliches Anfügen weiterer solcher Würfel in die eine oder andere Richtung vergrössern kann. Es lernt, dass es leichter ist, eine Reihe dieser Würfel in der Waagrechten zu bilden als in der Senkrechten – wie es entsprechend auch leichter ist, nebeneinander her zu arbeiten als miteinander, wo jede Vorarbeit zur Grundlage der nächstfolgenden wird und bei welcher Betätigungsart dadurch auch gediegenere Produkte entstehen als bei blosser Betätigung einzelner Menschen nebeneinander her, also ohne Berücksichtigung und Zuhilfenahme der Leistungen der andern. Das aufmerksame Kind fühlt und erkennt, dass die Würfel in senkrechter Aneinanderreihung – zufolge ihrer Schwerkraft – fester zueinander halten, also inniger verbunden sind als bei waagrechter Aneinanderreihung. Es erkennt die grosse Kunst des senkrechten Aneinanderreihens als eine Kunst des Beachtens aller möglich wirkenden Formen der Schwerkraft und erlebt und ahnt so schon das Wesen der Freiheit, die sich einmal aus seinem späteren senkrechten Stande ergeben wird, voraus. Das alles gleicht der Bildung von Humus und Vegetation über dem harten Gestein, der Festigkeit seiner noch unerprobten und zumeist noch auf sich selbst bezogenen Liebe, welche durch solche Erkenntnisse schon einen Teil ihrer Starre zu verlieren beginnt. Später wird es versuchen, seine Erkenntnisse, die es beim Spielen gewonnen hat, für andere anzuwenden, indem es Gegenstände, die umgefallen sind, wieder aufstellt, oder Dinge, die heruntergefallen sind, wieder aufhebt und so zu platzieren versucht, dass sie nicht mehr fallen (also beispielsweise nicht an der Kante des Tisches, sondern mehr in seine Fläche hinein gerückt) etc.. . Diese Phase gleicht dann schon der tierischen Entwicklung, welche aus den früher gewonnenen Erkenntnisinhalten (pflanzliches Vorleben) schon eine freiere, eher gestaltende Tätigkeit ermöglicht. Die verschiedenen Verhältnisse der bloss physikalischen Erkenntnisse zu den hinzukommenden, freieren und gestalterischen Erkenntnissen, die schon in den Dienst des Zusammenlebens gestellt sein können, gleichen den Verbindungsstrahlen des Lichtes von und zu den verschiedenen Gegenständen untereinander und vor allem zum Auge des Betrachters hin. Durch diese rege Art der Betätigung des Erkennens einerseits und der Anwendung anderseits wird es also Licht im Gemüte eines Menschen, genau gleich, wie die stete Potenzierung der Wärme schliesslich zu einer matten Glut führt und endlich gar zum hellen Licht. Denn: auch ein abspringender Funke von zwei aneinander geschlagenen Steinen ist nichts anderes, als der aus grosser örtlicher Reibungswärme entstandene "Lichtblitz" des am Ort des Schlages äusserst erwärmten Teilchens, das dabei abgesprengt wurde. Und ein kaltes Eisen wird unter den steten und schnell folgenden Schlägen eines Dampfhammers glühend, allein durch die stete Bewegung der Moleküle untereinander, die sich dabei, an sich reibend, erwärmen – eben bis zur Glut, also bis zur Entstehung des Lichtes. Nur sind in den genannten beiden Beispielen der Wärme- und Lichtenwicklung noch sehr träge und negative Liebearten (Trägheit, Starre oder mit andern Worten: Liebe zur Ruhe) eher zur Tätigkeit gereizt als hergelockt worden. Denn nur äussere Bedrängnis (Schläge) liessen die innere Kraft in den Dingen zu dieser Tätigkeit kommen, während in den Pflanzen und Tieren bereits der nur mässige Schein der Sonne ihre in ihnen wohnende weiter entwickelte Liebe (Assimilationsbedürfnis) eher zur Tätigkeit lockt; und beim Kinde ist es gar die Form und Gestalt – also das bildliche Wort der Liebe –, das lockend wirkt. Wer aber keine so rechte Freude an dieser Entwicklung in sich selbst – schon in Kinderjahren – gehabt hat, sondern die Dinge einfach ohne Anteilnahme so akzeptierte, wie sie waren, oder gar nur leichtsinnig spielend mit ihnen umging, der konnte sie ja nicht tief und ordnungsgemäss genug erfassen, sodass sie in ihm genügend Gedanken erzeugt hätten, die sich dann zu Ideen gedrängt hätten, welche dann, schon nach einer Ordnung verlangend, ihn beleben würden. Oder: die verschiedenen Erlebnisse wurden für ihn nicht so lebenstief, dass sein Lebenswasser der Anteilnahme in sie gedrungen wäre und sie verbunden hätte zu einer lebendig verwobenen humosen Decke einer höhern Ordnung, die den noch starren Stein seiner auf sich selbst bezogenen Liebe besser zu lösen vermocht hätten als die allzu derben, äussern Einwirkungen von Hitze und Kälte, die nur über grosse Spannungen den Stein zu brechen vermögen, ohne dass er dadurch auch schon ordentlich gelöst worden wäre. Alle äussern Eindrücke, welche den innerlich Geschäftigen zur Lockerung seiner Liebe zu sich selbst geführt hätten, indem sie seine Kraft für die Ordnung der daraus resultierenden Erkenntnisse gebunden hätten, vermögen das Gemüt eines weniger mit dem Wesen des geistigen Lebens Erfüllten nicht zu bearbeiten, sodass er allmählich, selber ins Leben überginge, sondern zerteilen ihn bloss in seinem ursprünglichen Bestreben nach eigenliebiger Ruhe, sodass die Wirkungen solcher Vorkommnisse – oder erlebter Erfahrungen – dann wie toter Sand auf der Oberfläche seines Gemütes liegen bleiben. Und ihre Häufung vermehrt dann die einmal entstehende Wüste, weil kein sie bindendes Wasser der lebendigen Anteilnahme in den einzelnen Eindrücken steckt. Solange nun im Leben eines Menschen stets neue, ihn oberflächlich mehr oder weniger erheiternde oder wenigstens ablenkende, weitere Vorkommnisse sich dazu gesellen, merkt er nicht, wie lose das alles verbunden ist und wie wenig fest und tragfähig die vorläufige Ordnung in ihm ist. Bei einem grossen Lebenssturm aber, der seine Lebenskraft ordentlich verzehrt, gewahrt er erstmals, wie lose all das Seine geordnet und miteinander verbunden ist. Lässt der Sturm dann aber wieder nach, so fühlt er sich unter dem Schutz des losen Sandes wieder wohlgeborgen und ändert nichts in der Landschaft seines Gemütes. Nun gibt es aber grössere und länger anhaltende Stürme, welche den Sand so sehr bewegen, dass die menschliche Seele durch diese Ereignisse aus ihrem "Schlafe" im Leibe geweckt wird und angstvoll an die Oberfläche oder ins bloss äussere Erkenntnislicht ihres Wesens getrieben wird, wo sie voller Verzweiflung die volle Wüste erkennt. Ihr Versuch, wieder zurückzukehren in die Ruhe ihrer innern Tatenlosigkeit gelingt ihr nicht mehr, weil sie in sich nichts zu finden vermag, was dieser äussern, toten Kahlheit Einhalt zu gebieten vermöchte. Ihre Orientierung nach äussern Gesichtspunkten hilft ihr dabei nicht, weil keine Linien in die Tiefe ihres eigentlichen Wesens führen und darum "aussen" stets aussen bleibt. Wohl sieht der Mensch in dieser Situation Tausende anderer Menschen, die sich im Sande derselben Wüste tummeln, ohne sich Sorgen zu machen. Es sind jene Wüstenbewohner, die nur in ihrem Äussern, im blossen Verstande, leben und deshalb keine Orientierung brauchen, weil in ihrem äussern Zustande ja alles aussen ist. Sie kommen nie nebenab. Sie fragen nie. Sie sind das Treiben im Wüstensturm gewohnt, sie brauchen, als selber tot, keine Ruhe, nach der sich der eben in die innere Wirklichkeit seines Lehens Erwachte sehnt. Ein Depressiver sieht zu, wie sich andere um Nichtigkeiten zanken und reissen, die, angesichts der innern Leere, in welche auch diese – spätestens mit ihrem leiblichen Tode – zurückfallen müssen, lächerliche Grössen darstellen. Was spielt es denn beispielsweise einem Menschen für eine Rolle, ob er gut gekleidet ist, wenn sein Leib todkrank ist? Ja, was spielt es gar für eine Rolle, ob der Leib überhaupt gesund oder krank ist, solange die Verzweiflung über die Sinnlosigkeit sein Gemüt ergriffen hat? Was spielt die äussere Stellung eines Menschen für eine Rolle, wenn er daran ist, an sich und der Welt zu verzweifeln? Sehen ihn die andern nicht nur noch fragender an, wenn er eine höhere Stellung innehat, als wenn er in einer unbedeutenderen geblieben wäre? Hat er in einer höhern Stellung nicht viel mehr Neider, die ihm das im Geheimen sogar noch wünschen? Hat er nicht wesentlich mehr Anwärter für seine Stelle, denen sein Zustand äusserst gelegen kommt, als ein anderer in einer unbedeutenderen Stellung? Spürt er vielleicht nicht zusätzlich zur Erkenntnis seines eigenen innern Zustandes noch die Möglichkeit, solchen Zuständen auch in den ihm Untergebenen – vielleicht durch seine bisherige Art der Führung – noch Vorschub geleistet zu haben?! Wird anderseits von ihm in solcher Stellung nicht noch viel eher verlangt, in dieser äussern Wüste agierend zu verbleiben, als von einem kleinen Manne, den niemand kennt? Oder: Was nützen einer Frau ihre vielen Bewerber während einer Depression? Ist nur einer imstande, ihren Zustand zu verbessern?! Oder sind sie wohl wenigstens doch noch bereit, ihr immerhin in den äussern Verhältnissen behilflich zu sein, angesichts ihres verheerenden Elendes in ihrem Gemüt? Hatte sie wirklich nötig, gehabt, durch ständig neue Kleider, andere Frisuren und stete Wechslung ihrer Gesichtsmasken, die man Make-up nennt, so viele Männer für sich zu gewinnen? Sind sie alle im jetzigen Zustand für sie da? Und was können sie ihr wirklich geben? Was nützt es dem Menschen, dass er alles hat: Eine Familie, ein Haus, ein Auto, ein Fernsehen, ein Telefon, sogar ein Mobiltelefon; wird man ihn damit erreichen in seiner Wüste? Oder erreicht vielmehr er die andern noch aus seiner Wüste heraus? Das alles gehört zum Sand der Wüste im Gemüte eines Depressiven und das alles denkt ein Depressiver nicht etwa nur; nein, er fühlt es vielmehr lebenstief! Er sucht verzweifelt nur nach dem Allernötigsten und weiss doch nicht, was es ist. Er sucht das Ende (der Wüste), anstatt den Anfang (einer wachsenden Ordnung). "Im Anfange war Gott,....", heisst es in der Bibel; aber wo ist er jetzt? Gut wäre es nun schon, das zu wissen; das empfindet der Mensch. Denn wenn ihm schon alle Menschen nicht helfen können, auch er sich selber nicht, so müsste es ein Gott sein. Was aber sagte denn Gott durch den Mund Jesu – so man schon willens wäre, an ihn zu glauben? Sagte er nicht, dass alles, was vor der Welt gross ist, vor Gott ein Gräuel sei. Wie sind aber dahingegen die Menschen bestrebt, voreinander gross zu erscheinen und gross zu sein. Wie gross ist auch unsere Wirtschaft und Industrie schon geworden, dass sie nicht nur die Gemüter der Menschen zerstört, sondern auch gerade den ganzen Planeten. Wie gross und Staunen erregend ist die menschliche Intelligenz gezüchtet worden, dass sie das menschliche Gemüt derart niederdrücken kann? Wie gross stellt die Werbung selbst die nichtigsten Dinge dar, dass wir nur noch über sie zu denken und zu reden haben, anstatt über die innere, bleibende Beschaffenheit unseres Gemütes?! Ist durch dieses Streben nach Grösse heute nicht sogar jedes Fleckchen Haut eines Menschen so grosswichtig geworden, dass es extra noch poliert und gebräunt werden muss und mit Sprays auch wohlriechend gemacht werden muss, während der Träger dieser Haut mit der Verzweiflung zu ringen beginnt! Fragte nicht Jesus, Gottes Sohn: "Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewänne, an seiner Seele aber schaden litte?" Empfahl er nicht Demut und Gehorsam, sogar der weltlichen Obrigkeit gegenüber, und verlangt Gott nicht von den Kindern, Vater und Mutter zu ehren. Früher wurde die Ehre der andern denn wenigstens dem Äussern nach noch gewahrt, und es gab weniger Depressive. Heute ist Ehre nur noch etwas, das man für sich selber beanspruchen will. Es verlangt die Bibel auch im neuen wie im alten Testament, Gott (und seine Ordnung, die er uns in den Geboten gab) über alles zu lieben, und seinen Nächsten wie sich selbst. Wie aber will ein Verzweifelnder lieben können? Wie will ein Ertrinkender in seiner Todesangst sogar seinen möglichen Retter lieben können?! Ja, nach ihm schreien, das wird er wohl noch können; aber lieben? Sich in voller Liebe ihm hingeben? – Nein! In solchen Momenten fliessen einem Depressiven oftmals irgendwelche Gedanken zu – ob von Menschen ausgesprochen, oder von höherer Macht ihm zugespielt –, die ihn aufmuntern, in seinem Unglück ruhig zu werden; in stiller Demut zu seinem innern Zustand zu stehen in der Hoffnung, dass ihm durch seine Aufrichtigkeit mehr Licht zufliessen würde und dass das lebendige Wasser innerer Anteilnahme in der Ruhe sich eher wieder bei ihm sich sammelnd kondensiere in seiner nördlich widrigen Stellung zu allem Äussern. Ein solches Wasser kommt stets vom Himmel her. Kann der Betreffende an Gott glauben, oder: kann er glauben, dass Gott auch ihn in Jesus aufsuchen und annehmen wird, so kann es ihm bald einmal leichter geschehen. Kann er das weniger, so muss er dennoch versuchen, die Anordnungen Gottes in seinem Leben als gut zu erkennen, was in seiner Lage wohl nicht allzu schwer halten sollte, wenn er merkt und bedenkt, wie sehr seine von ihm bis jetzt unbeachtet gebliebenen Worte angetan gewesen wären, all das zu verhindern, was bei ihm sich nun vorfindet, und all das vorher aufzuzeigen, was er jetzt erst durch die Erfahrung erleben kann und erkennen lernen muss. Dieses demütige Erkennen und Anerkennen seines Zustandes und die möglichst grösste Bereitschaft, sich in ihn zu fügen, entspricht jener Mulde im Sande, welche dem Manne angeraten wurde, zu suchen. Sie befindet sich für einen jeden genau dort, wo die Winde und Stürme der Weltleidenschaften über den harten, aufragenden Grat seiner Eigenliebe hinwegfegend durch ihre Wirbelbildung in seinem Gemüte den lästigen Sand etwas hinweg getragen haben, das heisst entsprechend dort, wo all die bisherige Weltgeschäftigkeit als blosser Sand im Gemüte der Seele erkannt, empfunden und dann fallengelassen wird. Dort, wo die ursprüngliche Härte und Starre seines Felsens zwar noch intakt, aber auch noch unberührt geblieben ist. Dorthin soll er sich fügsam begeben, so wird ihm dort sein eigener Fels der Anteilnahmslosigkeit vor seinen Augen offenbar bleiben. Und der Tau der Erbarmung, das Kondensat des Wassers himmlischer Anteilnahme, hervorgerufen durch eine seine Fehler tief empfindende Reue wird sich zu sammeln beginnen in den sich bildenden Ritzen solcher Reue in seinem ursprünglich harten und unzugänglichen Gemüt und wird ihn dadurch erquicken und beleben. Und er wird mit der Zeit empfinden wie jener Mensch, der unserem Manne in seiner Wüste begegnet ist, der es so formuliert hatte: "Mit der Zeit aber begann ich diesen Platz, der zwar der düsterste war, weil er gegen Norden lag und die Wand südlich, also vor dem einfallenden Lichte, stand, dennoch als einen Wohnplatz zu lieben, weil mir da so viel des himmlischen Taus zukam, dass ich ohne Hilfe der Wüstenbewohner mein Leben fristen konnte, und ich entfernte mich nur noch ganz selten von ihm. Mit der Zeit kam er mir auch etwas wärmer vor und ich begnügte mich von da an, auf ihm zu verweilen und meine Betrachtungen über alles Vorhandene anzustellen, und wurde dabei oft recht heiter sogar, wenn ich mir vergegenwärtigte, wie wohlversorgt ich doch bei aller Kargheit dieses Lebens bin. Die Wüste kann und will mir zwar nicht gefallen, aber mir gefällt, dass ich darin gar nichts mehr zu suchen und zu sorgen habe, sodass ich sie auch gar nicht mehr anzusehen brauche; ich nutze sie nur an ihrem günstigsten Punkte zur Fristung meines Daseins." Was aber heisst das nun, dass sich der Tau der Erbarmung der Himmel zu sammeln begann in den Ritzen der Reue seines ursprünglichen, harten und unzugänglichen Gemütes? Es heisst, dass ihm die Erkenntnisse über den Grund und die Handlungsweise seines bisherigen Wirkens in einer sein Herz erweichenden Form zufliessen wird. Er wird beispielsweise erkennen, wie die Oberflächlichkeit der Wüstenbewohner – seiner innern Bedürftigkeit gegenüber – ihn noch mehr ängstigen und erschrecken musste und wie er darunter zusätzlich litt, dass andere offenbar einfach mit Dingen fertig wurden, die er nicht zu bewältigen vermochte. Das wird ihn über innere und äussere Anteilnahme nachdenken lassen und er wird aus der dermaligen Sicht der Dinge auch seine (frühere) Handlungsweise durchgehen und durchsuchen und vieles entdecken, das ihn aus der jetzigen Sicht stark berühren wird, sodass sein ganzes früheres Wirken in Frage gestellt wird, also bildlich gesprochen Risse erhält, über die er Tränen der Reue zu vergiessen bekommt. Beispielsweise könnte er erkennen, wie leicht er die Ängste und Bedenken seiner eigenen Kinder bei etwelchen Vorkommnissen nahm und sich nicht bemühte, sich in ihrem noch kindlichen und unerfahrenen Denken so zurecht zu finden, dass er ihnen aus dem Schatze ihrer bisherigen Erfahrungen hätte Hilfe und Trost bieten können, so wie er es seinerzeit von den Wüstenbewohnern – allerdings vergeblich – erhofft hatte. Er wird erkennen, wie er selber seinerzeit seine Kunden bedient hat, oder wie er seinem Arbeitgeber gedient hat; wie ihm alle Extrawünsche zuwider waren, ungeachtet dessen, ob sie berechtigt und sinnvoll waren oder nicht; denn blosse Extravaganzen würde er auch in dieser neuen Erkenntnislage seines Gemütes nicht gutheissen können. Und umgekehrt würde er als Arbeitgeber erkennen, wie gleichgültig ihm das Wohl und die etwaigen Bedürfnisse seiner Arbeiter gewesen sind, wie unberührt er bei etwaigen familiären Engpässen seiner Untergebenen geblieben war. Die Wünsche der puren Vorteil-Jäger unter ihnen würde er allerdings auch in seiner jetzigen Erkenntnislage nicht berücksichtigen; ja er würde ihnen gar noch entschiedener begegnen, weil sie – aus purer Ich-Bezogenheit zustande gekommen – mögliche Zeitreserven für echte Engpässe anderer ausgeschöpft hätten. Auch wird er erkennen, dass er mit seinem fast jedem Menschen eigenen Imponierverhalten und mit seinen extravaganten Anschaffungen die andern Menschen dazu verleitet hatte, sich ebenfalls nur ihrer Erscheinung wegen – anstatt ihrer wahren Bedürfnisse wegen – Dinge anzuschaffen oder etwas zu tun, das niemandem nutzen konnten, wohl aber andere zu ärgern vermochte. Denn mit einem solchen Verhalten diskreditierte er jene Hersteller, die sich ehrlich Mühe gaben, sinnvoll Praktisches in harmonischer Bescheidenheit in ihre Produkte einfliessen zu lassen, und begünstigte mit seinen Käufen anderseits die Anbieter sinnleerer und verschwenderisch hergestellter Produkte. Ebenso half er auch durch den angeberischen Gebrauch von Fremdwörtern mit, die Muttersprache – die Sprache, die vom Herzen kommt – zu verfremden und zu verfälschen und half damit auch, sie endlich ganz zu töten. Denn wer in Fremdwörtern spricht, spricht um seiner Erscheinung und seines Erscheinens vor den andern willen, und nicht seiner Bedürfnisse und innern Angelegenheiten halber. Kein Mensch kommt auf die Idee, einem Gleichsprachigen seine Leiden und Sorgen, seine äussern und schon gar nicht seine innersten und darum tiefsten Bedürfnisse mit Fremdwörtern darzustellen, oder gar jemandem seine Liebe einzugestehen. Fremdwörter sind schon selber wie der Wüstensand: Von weither kommen sie auf die Zunge und werden von da dann auch sofort und unbedenklich weitergegeben; mit eigentlichen innern Leben haben, sie nichts zu tun! Und letztendlich wird ein Mensch, dessen Selbstachtungsfels schon beträchtliche Risse im Selbstverständnis und auch tiefe Spalten durch innig empfundene Reue erhalten hat, einsehen, wie er aus lauter Gleichgerechtigkeitssinn alle die Natur zerstörenden, technischen Möglichkeiten, die er eifrig nutzte, bedenkenlos dadurch entschuldigt hat, dass er sagte: Was nützt es, wenn ich es nicht tue; die andern tun's ja doch alle, und somit hilft mein Abseitsstehen nichts! Just an diesem so unschuldig und wohlberechnet erscheinenden Beispiel wird er nun erkennen, wie eine (innere) Wüste entsteht: Wenn nämlich die Bäume, Sträucher, Blumen und sogar die Gräser während eines Sturmes spüren müssen, wie sehr der Wind und Sturm an ihnen zerrt und ihre Kräfte verbraucht, und daneben erkennen könnten, wie leicht es in dieser Situation dem Staub und Sand der Erde geht, der sich sorglos in die Lüfte erheben lässt und sich ebenso sorglos, beim Rückgang des Sturmes, sich wieder absetzen lässt, vielleicht eine herrliche Blume zudecken helfend, sodass er ihr zu einem Grabe wird, so könnten alle Pflanzen – hätten sie eine freie Erkenntnis und einen freien Willen – sich plötzlich für das Wesen des Sandes entscheiden, würden dabei zerfallen und sich in kleinste Partikel auflösen und sich ebenfalls dem Wind übergeben. So wäre dann die Wüste komplett, nur weil sich niemand mehr die Mühe nähme, der alten, gottgewollten Ordnung zu dienen, die ihrerseits der Entfaltung allen Lebens dient. Natürlich haben es die Pflanzen bei dieser gottgewollten alten Ordnung ungleich schwerer als der tote Sand – besonders in einer Wüste oder auch an deren Rand. Aber sie halten aus, nützen dadurch allen Lebewesen, ja sogar der geistvollen Menschenseele – durch ihr schönes, ruhig und unverändert bleibendes Bild – und werden ihr zur Hoffnung. Und für sich selber bleiben sie Geschöpfe Gottes, denen ihr Ausharren nützen wird, indem die in ihnen gereifte Kraft einmal – nach dem Vergehen ihrer äussern Form – von ihm eine weitere, höhere Aufgabe zugewiesen erhält, die sie dann in einer bereits weiterentwickelten, andern und höhern Form zu ihrer eigenen Bereicherung erfüllen kann und wird. Alle diese aufgezählten und zu bereuenden Fehler gehören mit vielen weitern zusammen ja nur zu den kleinen Dingen, die ein sonst "anständiger" Mensch tut, die aber dennoch für die innere Entwicklung schwerwiegende Folgen haben. Gar nicht erwähnt bleiben da so manche, weit über diese hinausgehenden Schwächen und Fehler, wie Betrug in der Ehe und im Geschäft; Intrigen, Gewalttätigkeiten etc. Das alles lässt Gott einen Menschen also in dieser seiner jetzigen Stellung – in einer Mulde einer Wüste, vor der Wand seiner erstarrten Liebe gelegen – auffinden, sofern er diese Stelle auch liebend angenommen hat und ihr auch treu verbleibt. In sein Leben aufnehmen aber kann er diese Erkenntnisse vorläufig allerdings nur in Form von guten und festen, weil aus der verletzten Liebe seines Herzens heraus begründeten, Vorsätzen, die zur neuen Kraft seines Lebens werden, wenn sie gesammelt bleiben in aller Liebe zur Ordnung Gottes, die alleine dem Ganzen dient. Erst wenn durch die stete weitere Bekräftigung dieser Vorsätze vor allem durch Taten und auch durch stets neue, weitere solche Erkenntnisse eine gewisse Festigkeit zum Guten in ihm entsteht, wird er ruhiger und kann dann schon behaglicher aus seiner Mulde heraus in die übrige Wüste schauen. Nur muss er in dieser Mulde verbleiben und darf nicht voreilig die Wüste aller andern beleben helfen wollen; denn die bloss vorläufige Festigkeit seines Liebewillens ist in der Praxis noch lange nicht genügend erprobt. Wie leicht könnte er sich da auf sein so mühselig und auf dem blossen Erbarmungswege erworbenes Wissen etwas zugute halten, das ihn hernach wieder eitel und dadurch vom Guten Gottes abwendig machen könnte. Vielmehr sollte er zum Lebenswasser seiner Anteil nehmenden Liebeerkenntnis sorge tragen, sodass es in ihm einmal in lebendigen Formen der grünenden Hoffnung zu einem neuen Wesen wird, gleich den Pflanzen, die aus dem vorhandenen gesammelten Wasser in solch einer Wüste zu spriessen beginnen und dadurch das Wasser weiter speichern helfen und völlig ungewollt ihre ersten Samen des Vorbildes in die nähere Umgebung verstreuen, von denen einige auf- und durchkommen. So kann er mit der Zeit und der Hilfe von oben her die ganze grosse Wüste begrünen helfen. Wobei aber für ihn stets nur seine eigene Grube als die ihm alleine zugehörige verbleibt. Das heisst: Dieses stille Wirken, vorerst im Gemüte des Depressiven bloss, wird ihn kräftigen und entlasten. Dabei soll er sich aber vermehrt Gott und dem Guten zuwenden, und nicht wieder der äusseren Welt, so wird in ihm eine neue Landschaft entstehen – eben das Reich Gottes, das dann für die weniger Geschäftigen in der Wüste der äusseren Welt schon kleine Erkenntnissamen abwirft, die ihr Gemüt beleben, sodass sie, ohne es sich vorerst bewusst zu werden, zu erkennen beginnen, dass und wie Gott in den Schwachen mächtig ist, und dadurch – der Verwunderung voll – weniger stark auf das Aufgeblähte der grossen und lärmenden Welt achten und somit auch selber ruhiger bleiben und dergestalt möglicherweise der grossen Wüste in sich selber entgehen, in die sie dem äussern nach doch auch gestellt sind, und in welcher sie tätig sind. So wirkt Gott, als die Liebe, stets im Stillen und breitet sein Reich – von der grossen Welt völlig unbeachtet – im Herzen der ihm (wenn auch nur durch äussere Not getriebenen) Treuen aus. Und für alle jene, denen die Blendung, ihrer innern, tief blickenden (Erkenntnis-) Augen, durch das grelle Weltlicht bedingt, benommen wird – entweder durch die Trennung von ihrem Leibe (dem leiblichen Tod), oder durch die Schwächung ihrer Verbindung zu ihrem Leibe, wie bei den Kranken, Überforderten und Depressiven – wird dieses Reich sichtbar, wo es nur vorhanden ist – wenn auch oftmals erst im Entstehen begriffen. All diese Erklärungen, samt dem Bilde der Wüste, würde für alle, die mit der Liebewärme ihres Herzens zum Licht der Erkenntnis kommen, auch in der Bibel nachzulesen sein. Und dadurch erst bekäme die Bibel auch wieder das belebend Nahe, das sie für die Christen eigentlich haben sollte. Denn so, wie der Einzelne, so geriet vor langer Zeit auch einmal ein ganzes Volk in die Wüste dieser Welt, also in die Wüste bloss intellektuellen und eigenmächtigen Handelns aus der beschränkten Sicht des Individuums heraus, nachdem zuvor schon Adam diesem Fehler erlegen war und damit all seinen Nachkommen diese Wüste erblich hinterliess. Es war das Volk der Israeliten, das in der ägyptischen Gefangenschaft – das entspricht der Gefangenschaft in bloss äusserer Kultur, im bloss äusseren Suchen und Trachten – in seinem Innern sosehr verwüstete und vertrocknete, dass es sogar seinem äussern Wesen nach 40 Jahre lang in der Wüste umher irren und dabei seinem Äussersten nach abgeödet werden musste, bevor ihm wieder ein Stück gesegnetes Land zu eigen werden durfte – entsprechend einem belebten und vollen Anteil nehmenden Gemüt. Wie aber hätte dieses damals undankbare Volk schneller und leichter wieder zu besserem Grund und Boden finden können? Eben dadurch, dass es sich die äussere Wüste – als eine Entsprechung seines innern, auf bloss Materielles gerichteten Zustandes – gefallen lassen hätte und in der Mulde oder Grube völliger Demut beim Felsen seiner Härte verharrt hätte, bis der Herr das Wasser der himmlischen Erkenntnis aus diesem Felsen hervorgerufen hätte, was ohne vorherige Risse der Reue nicht leicht möglich gewesen wäre. Anstatt dessen murrte es ständig und begehrte dem schlechtern Wesensteile nach sogar auf, hing sich gar an die äussere, den Menschen oft so golden erscheinende Form ihres eigenen Unverstandes in geistigen Dingen – äusserlich sogar dargestellt in der Form des verfertigten goldenen Kalbes – und erlitt dabei grosse Verluste an Menschen aus diesem Volk – wie entsprechend jeder einzelne Mensch durch eine solche Gesinnung und Handlung viel Menschliches aus seiner Seele verliert. Der übrig gebliebene Rest dieses Volkes aber wurde nach der langen Zeit von 40 Jahren endlich wieder in bessere, äussere Verhältnisse geführt. Dass dem damals so war – und in der Seele eines heutigen Menschen auch nicht viel anders ist –, erhellt aus der Episode dieses Volkes mit Moses, als es ihm vorwarf, was es alles Gutes in Ägypten hätte zurücklassen müssen nur, um in dieser Wüste nach vieler Entsagung und grossem Ungemach endlich ganz zu Grunde zu gehen. Damals schlug dann zwar Moses auf Gottes Geheiss mit seinem Stabe an den Fels, und er musste auch sein Wasser hergeben. Aber eben – es war nicht der eigene Fels der starrsinnigen Seele dieses Volkes, aus welchem das Lebenswasser zu quellen begann, sondern der Fels der Treue und Erbarmung Gottes, der dabei angerührt wurde, weshalb auch für die Juden vorerst nur in fremdem Lande Milch und Honig floss, und Moses, der durch seine Erfahrungen mit Gott wohl mehr des Glaubens und der willigen Fügung unter seinen Willen hätte haben sollen, sodass in ihm selber schon lange zuvor der lebendige Quell reichlich hätte fliessen können, bekam von Gott bei dieser Gelegenheit den Verweis, dass er das gelobte Land zwar sehen könne, nicht aber betreten dürfe, weil für ihn – den so weit Gereiften – kein äusseres Land zu seiner gänzlichen Entfaltung mehr nötig war, sondern nur die völlige Annahme und Kultivierung seines eigenen Gemütes (das allerdings gemessen am Gemüte eines heutigen Menschen schon als sehr vollendet erscheinen muss). So war diese "Strafe" eigentlich dennoch ein Segen Gottes für ihn, denn was sucht der, der Gottes Reichtum in sich auszubreiten beginnt, noch in der Fremde der äussern Welt?! Denn auch Moses vertraute im Geheimen dennoch immer wieder eher der äussern, als der innern Kraft, suchte das Äussere für sein äusserlich gewordenes Volk, indem er das Murren des Volkes dadurch übernahm, dass er es vor Gott brachte, anstatt er ihm vollernstlich das innere Ziel Gottes mit diesem Volke eröffnet hätte. Denn bei einem solchen Verständnis ihrer Situation hätten ihn die Juden dann weniger gedrängt, sondern eher und leichter in der Wüste geduldig und demütig verharrt, bis aus ihrer Mitte (ihrem Gemüt) ihnen ein Land erwachsen wäre, in welchem Milch und Honig fliessen würde. Trotz aller dieser Widerspenstigkeiten gegen Gott und trotz späterer, weiterer Gefangenschaft dieses Volkes in Babylon erweckte Gott aber später dennoch mitten in seiner innerlichen Wüste, der Wüste seines innerlich teilnahmslosen und dadurch bloss äusserlichen Judentums ein ewig grünendes Reich der Gnade – in Jesus Christus. Er kam, alle aufzunehmen in das in ihm und durch ihn sich unter den Menschen ausbreitende Gottesreich; aber die damaligen Menschen flohen ihn grossenteils, verwünschten ihn und kreuzigten ihn gar und flohen damit ihr eigenes Leben, ihren ewigen Quell. Wohl ist dieses Gottesreich dafür wenigstens dem Wortlaute und dem Buchstaben nach bis ins Abendland gekommen und da sogar der äussern Form nach heimisch geworden. Aber wo sind jene, die in sich selber diese Quelle auf Grund der Bibelworte wieder zu erwecken suchen, indem sie die leichten Gebote halten und auf die Kraft Gottes, die in ihnen dadurch freier und wirksamer werden könnte, vertrauen und hoffen – – wo, wo nur sind diese geblieben?! Wer das auch nur ahnend zu erfassen vermag, der spürt die Richtigkeit dieser Bilder und ahnt den Weg und die Nähe der rechten Möglichkeit, wird zuversichtlich und mutiger, den von noch so wenigen begangenen Weg zu gehen – was jedem nur zu wünschen ist. Und der Depressive hat die leichteste Mühe dabei, indem ihm erstens die Verworfenheit des heutigen äussern Lebenswandels klarer ersichtlich wird und ihm dadurch jede Möglichkeit benommen wird, sich wieder zu verlieren im Äussern – oder gar darin sein Heil zu suchen – wenigstens für so lange, als er depressiv bleibt. 4.11.1994 |