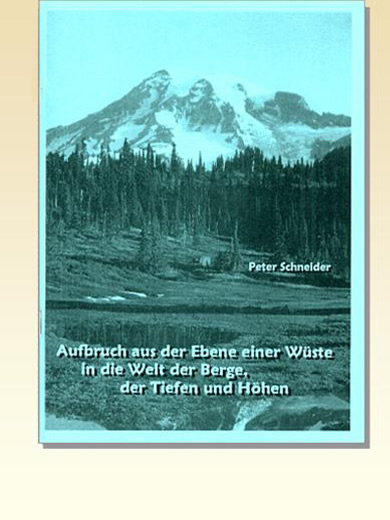 |
|
||||||
| AUFBRUCH AUS DER EBENE EINER WÜSTE IN DIE WELT DER BERGE, DER TIEFEN UND HÖHEN |
|||||||
|
Schon längere Zeit hatte sie – die als Vorgesetzte in einem wissenschaftlichen Institut Angestellte – keine rechte Lebensfreude mehr gehabt. Alles schien ihr mehr oder weniger grau zu sein. Nicht nur der Alltag mit allen seinen Erscheinungen, sondern auch die bisher noch herausragenden Besonderheiten dieses Alltags der hundert-, ja tausendfältigen Erscheinungen und Vorkommnisse begannen vor ihr zu verblassen, indem sie hinter alledem noch so einmalig Erscheinendem vermehrt die billigen Gründe erkannte, die soviel Umstände oder soviel Worte in keiner Art und Weise rechtfertigen würden. "Wie schön haben es doch die ungebildeten Leute; die können wenigstens ungehinderter ihres Weges gehen", dachte sie manchmal, wenn man ihr während ihrer Arbeit Dinge, Beurteilungen oder Fragen vorlegte, bei welchen sie wusste – aber seit einiger Zeit auch immer stärker verspürte –, dass sie nur der guten Ordnung halber auch von ihr selber noch begutachtet werden mussten. Selbst die Farben – die ihr übrigens nie soviel bedeutet haben, wie sie etwa einem Maler bedeuten könnten, der aus Liebe zu ihnen oder ihrer Aussage ganze Bilder zu malen beginnt – hatten bei ihr schon einige Zeit nur noch den Eindruck der Nützlichkeit zur bessern Differenzierung der Gegenstände voneinander hinterlassen. Auch Blumen beispielsweise, für die sie sich in jüngeren Jahren noch am ehesten erwärmen konnte, waren für sie im jetzigen Zeitpunkt und in der jetzigen Verfassung ganz einfach flüchtige Naturerscheinungen zwischen der Reife einer Pflanze und der Reife ihrer Frucht. Auch Komplimente waren für sie, statt wie früher Höhepunkte, nur noch Höflichkeiten, die entweder zum Alltag der gehobenen Schichten gehörten oder mit denen man bestenfalls den damit Überhäuften für die eigenen Begehren offener oder willfähriger machen konnte – mithin also nichts als Werkzeuge der Selbstsucht. Unlängst musste sie im Anschluss an eine Versammlung von Mitarbeitern Zeuge sein, wie ein nicht mehr ganz junger Mitarbeiter eine Mitarbeiterin durch Komplimente zu einem privateren Gesprächsverlauf zu verleiten begann. Sie selber war zu müde, zu enttäuscht und zu sehr mit sich selber beschäftigt, als dass sie aktiv am Gespräch hätte teilnehmen mögen. Da aber der Zeitpunkt der offiziellen Beendung der Versammlung durch die Absegnung eines Mitgliedes der Firmenleitung noch nicht gekommen war, musste sie dennoch davon Zeugin sein, wie der Werbende der Geworbenen eine schale Bemerkung um die andere machte, jedoch so geschickt, dass die Umworbene, die eben auch nicht ganz abgeneigt war, neben dem Geschäftlichen her auch private Engagements zu haben, am Ende irgendeine festere terminliche Zusage zu einem gemeinsamen Unternehmen machte. Sie empfand es so stark und präzise wie in früheren Jahren nie – oder war sie es sich früher einfach nie so klar bewusst geworden? –, dass keines der beiden etwas für das andere übrig hatte. Beiden ging es vordergründig nur um die bessere gesellschaftliche Verflochtenheit, welche ihre Stellung sichern helfen sollte, und im Hintergrund mochten beide auch noch den Wunsch gehegt haben, etwas amüsantes erleben zu können – jedoch ohne jedwede innere Anteilnahme, sondern bloss, um die Eintönigkeit des Alltages und die Länge der Zeit etwas belebend zu verkürzen. Sie spürte, wie zu keiner Zeit des menschlichen Lebens irgendeine Aussage den andern treffen oder gar betroffen machen konnte. Alles war stets nur ins Leere geplaudert, bloss geeignet, die Zeit zu füllen – aber niemals einen Menschen zu erfüllen. Wie wäre das auch möglich! Denn auch der andere braucht in seiner gelangweilten Leere nichts für sich selbst, sondern nur, um weitergeben zu können, um durch die seichte Gabe sich des weitern, ebenso seichten Interesses seiner Umgebung zu versichern. Der Kummer oder die Last der andern aber ist jedem gleichgültig; und wer sie nicht mehr zu tragen imstande ist, der wird ausgeschieden, umgangen, verlassen. Das spürte sie gerade jetzt wieder. Niemand kümmerte sich um ihre Teilnahmslosigkeit, "Gott sei Dank", dachte sie. Denn sie brauchte ja ebenfalls – wenn in ihrer Lage auch nur noch des Verdienstes zum Lebensunterhalt wegen – diese Einbezogenheit in die Gesellschaft, die ihr anderseits doch so viel Mühe bereitete, nicht nur ihres Überdrusses und ihrer Kraftlosigkeit wegen, sondern auch der stets klareren Einsicht halber, wie nutz- und wertlos all das war – sinnlos wie das Leben überhaupt. Zum Glück lebte sie alleine. Sie war, nach mehreren Bekanntschaften, die alle nicht lange gehalten hatten, weil die Männer zu sehr allem, was weiblich, oder doch sonst irgendwie verlockend oder anziehend war, nachjagten, sodass sie sich mit der Länge einer solchen Beziehung oder gar gemeinsamen Wohnung immer mehr zu einem zwar manchmal nützlichen, aber dennoch eher fünften Rad am Wagen vorkam, alleine geblieben. Sosehr sie sich einsam fühlte, so hatte sie doch eher dieses Gefühl der Einsamkeit in der Gesellschaft als in ihrer Wohnung, wenn sie wirklich alleine war. Zwar nagten alle Gedanken an ihr, wenn sie alleine war, und zehrten dabei von ihrer Kraft, sodass sie oft hilflos schwach werden konnte; aber die Art oder der Lauf der Welt beengte und beelendete sie in weit grösserem Masse, wenn sie mit ihr in Kontakt stand, als ihre eigenen Gedanken. Und das, obwohl sie, die zwar erst Mitte der Dreissig war, sah, wie verloren, sinn- und zwecklos der weitere Verlauf ihres Lebens sein musste, wenn er bloss zwischen Arbeitsleistung und Ruhe verlaufen musste wie die Horizontlinie einer Wüste, die im leichten Auf und Ab ihrer Dünen dennoch nur eine waagrechte Linie darstellt, von der einen Unendlichkeit des Himmels und der unter ihm ausgebreiteten Erde bis hin zur ebensogleichen, gegenüberliegenden Unendlichkeit sich ziehend, als Scheidelinie zwischen Himmel und Erde gespannt. Zwar berühren sich dabei Himmel und Erde ständig, aber ohne, dass sie sich etwas zu sagen, sich etwas mitzuteilen hätten. Denn – was der Himmel an köstlich erfrischendem und belebendem Nass allenfalls auch alles beinhalten könnte, fast nie kommt dieses unendlich ersehnte Gut der Wolken über eine Wüste zu stehen. Und sollte es auch einmal über eine Wüste kommen und sich gleichsam als reichlicher Segen über sie ergiessen, wenn es in Strömen regnet – wo hätte die Wüste in ihrem allen Lebens baren, lockern Sand eine Einrichtung oder Vorkehrung getroffen, welche diesen Segen des Himmels zurückbehalten könnte zur Belebung ihrer öden Natur? Sie hatte zwar noch nie – wie in ihren Kreisen sonst üblich – grössere Reisen unternommen, und schon gar nicht in eine Wüste; und dennoch schien sie sich in letzter Zeit stets mehr mit ihr zu befassen und sie so stark zu fühlen, dass sie unter ihrem Einfluss mächtig zu leiden bekam, obwohl dieser ja nur ein aus ihrer Vorstellung oder vielleicht Einbildung hervorgehender sein konnte. Diese Erkenntnis, oder das sich Bewusstwerden dieses Umstandes, beunruhigte sie aber noch mehr und flösste ihr manchmal regelrechte Angst ein. Denn sie dachte dabei an die Möglichkeit, einer Art Wahn verfallen zu sein, vielleicht sogar schizophren zu werden, hilfebedürftig also, sodass sie sich einmal zur Pflege in die ungeschickten Hände der ihr immer fragwürdiger erscheinenden Menschen begeben müsste; in die Hände jener also, die es nötig finden, all ihr Tun bei einem andern absegnen zu lassen, so, wie das ihre Untergebenen aus ihrem eigensten Innern heraus bei ihr tun mussten, um entweder der Höflichkeit zu genügen oder dann, um alle Verantwortung auf andere überwälzen zu können, um damit der eigenen Faulheit, Sinnlosigkeit und Selbstsucht mehr Raum zu verschaffen. Vielleicht war sie ja auch etwas ungerecht in ihrem Urteil, dachte sie manchmal in ihrer Not der Einsamkeit und der Isolation von allem, was menschlich warm war. Sicher war zum Beispiel das ihr Zulächeln eines Lehrlings oder eines neu Eingestellten noch ein echtes "Entgegenkommen". Aber bald nach dem Auftauchen eines solch belegenden Bildes für die Richtigkeit ihres Zweifels an ihrer üblichen Betrachtungsweise erkannte sie jeweils mit fast gesetzmässiger Regelmässigkeit durch die Schärfe ihres Verstandes, dass nur die Unsicherheit der gegenwärtigen Stellung oder Position des Neulings ihm ein solches "Entgegenkommen" abgenötigt haben konnte. Denn sie erinnerte sich dabei ihrer eigenen Handlungsweise in ihren früheren Jahren und fand mit dem Spürsinn eines Detektivs äusserst leicht und klar die Beweggründe ihrer eigenen, damaligen Handlungs- oder Verhaltensweise. Und: jene der andern nicht mit den ihren vergleichen zu können, erschien ihr abwegig, da gar nichts, aber auch wirklich gar nichts Anlass zu einer gegenteiligen Beurteilung zuliess. Im Gegenteil, das innerliche, betrachtende Verfolgen der weitern Entwicklung solcher Personen bestätigte ihr stets von neuem, dass höchstens die Unsicherheit des Neulings den Menschen zu einer eher verbindlichen Beziehung zu seinesgleichen bereit werden lässt. So etwa wie kleine Kinder, als Neuankömmlinge auf dieser Welt, diese verbindliche Beziehung (zu ihren Eltern) noch brauchen und auch suchen. Aber sobald sie sich einmal zurechtgefunden haben in den noch so misslichen Verhältnissen dieser Welt, beginnen sie, sich von den andern abzugrenzen und ihrer eigenen Selbstsucht zu leben. Das erlebte sie an den Kindern ihres Bruders und ihrer Schwester gleichermassen. Merkwürdig aber war, dass sie sich in all den Jahren solcher Kinderentwicklung ihrer Nichten und Neffen dieser Problematik nie so recht bewusst zu werden vermochte. Erst nun, seit der innerlichen Veränderung ihres Wesens, konnte sie solche Dinge äusserst leicht nachempfinden, obwohl sie ja nun bereits eher der Vergangenheit angehörten, was wenigstens die Entwicklung der Kinder ihrer Geschwister anbelangte. Es war äusserst mühsam, sich all dieser Umstände und Verhältnisse bewusst und ständig noch bewusster werden zu müssen, und sie erhöhten natürlich noch ständig das Gefühl des Alleinseins bis zu einer Art innern Verzweifelns; und dennoch hinterliessen sie mit der Zeit auch ein Gefühl der Orientierung, das sie zwar weniger zu verspüren bekam, wenn sie alleine war, aber umso mehr in Anwesenheit anderer, deren Handlungsgründe sie stets mehr zu durchschauen vermochte. Natürlich musste ihr ja in ihrer Einsamkeit wohler sein als in der Gesellschaft von Menschen, die das Gefühl des Verlassenseins noch viel mehr in ihr hervorriefen – eben, weil sie erst in Gesellschaft so recht von neuem, gewisserart frisch, verspürte, wie sehr sich jeder nur selbst der Nächste ist. Aber dann kam ihr die Empfindung, wenigstens zu wissen, wo sie sich befindet – in einer Wüste der Beziehungslosigkeit durch die auf sich selbst konzentrierte Selbstsucht hervorgerufen –, als ein kleiner Trost und als Stärkung vor, weil sie sie doch empfinden liess, dass sie selber den andern wenigstens darin eine wesentliche Nasenlänge voraus sei, dass sie zumindest wisse, wo und wie sie sich befinde – im Gegensatz zu den andern, die sich noch gut vorkommen mochten, wenn sie vor den andern glänzen konnten durch ihre Höflichkeit und die Anstände ihres Anstandes. Denn sie war sich mit der Zeit sicher, dass auch die andern alle einmal zu einer solchen Einsicht, und mit ihr zu diesem sie plagenden und vernichtenden Gefühl des Verlassenseins kommen mussten, sobald sie sich einmal weniger durch den Reiz äusserlicher Wirkungen gefangen nehmen lassen. – Aber nach einer solchen Empfindung ihres Vorzuges der Orientierung beim Vergleich mit andern, überkam sie oft – wenn sie wieder alleine war und Zeit zur Beschauung hatte – eine grosse Not, ja gleichsam eine grosse Reue; denn sie merkte, dass sie durch die genüssliche Innewerdung ihres innern Abstandes zu den andern nur noch isolierter dastand als sonst, und dass sie – wenigstens bei diesem Gefühl – selber die Schuld daran trage. Weshalb musste sie sich denn abheben wollen? Nun war sie, als Folge davon, erst recht allein, trug aber dazu noch alle Schuld ganz allein auf ihren Schultern. War sie nun nicht ebenso wieder ganz frisch und neu wie die andern alle, wie die ganze Welt geworden - auf sich und ihre eigene Leistung konzentriert? Es war für sie die Hölle, in welcher sie, ihrer Meinung nach, Gottes Verdammnis verspürte. Wollte sie sich dann aber wieder – wie eben vorher – über den in ihr stets vermehrt vermuteten gerechten Grund ihrer gefühlten Isolation klar werden, um möglicherweise davon los zu kommen, so widerstrebte sie doch offenbar dem Satan, dem sie durch die Abneigung gegen die Selbstsucht eine Absage erteilen wollte und der sie dann durch ihr dabei wieder erwachtes Selbstgefühl zu peinigen begann, sodass sie nun – bereits ohne Gemeinschaft mit Gott – auch dessen Gemeinschaft entbehren musste dadurch, dass sie sich von Satan nachsagen lassen musste, dass auch sie sich über ihn und alle andern erhebe, wie er selber damals über Gott. So sehr sie also einesteils den Wunsch hatte, die Gemeinschaft mit der Selbstsucht zu meiden, so sehr erschien ihr anderseits gerade dieses Bestreben nichts anderes als wieder Selbstsucht zu sein. Indessen war sie keine Gläubige, und so waren auch nicht die Bilder von Gottes Vollkommenheit und des Satans Verworfenheit eine zusätzliche Last für sie, sondern nur der Umstand an und für sich, dass sie sich durch ihr Abhebenwollen von der Selbstsucht eben gerade wieder selbstsüchtig benehmen musste. Nur - es drückte sie diese Erkenntnis genauso, wie sie vermutlich das Gleichnis der Schrift gedrückt haben würde, wenn sie es gekannt hätte, das aussagt, dass dem einen Knechte, der sein Pfund nicht vermehrt, sondern vergraben hatte, am Ende auch dieses eine Pfund noch genommen wurde und jenem übergeben wurde der zuvor schon zehn aus dem zuerst empfangenen einen gemacht hatte. Denn ebenso hob sie ja nun das eine Pfund der Erkenntnis über den Grund der Liebe- oder Beziehungslosigkeit der Menschen aus dem Schmutze ihres eigenen bisherigen, selbstischen irdischen Lebens, und doch wird es ihr, durch ihr eigenes Urteil - als wieder eine Selbstsucht - als Verdienst abgenommen und sie selber damit wieder unter all die andern verwiesen, von denen oder von derer innern Armut sie eben loskommen wollte. Längst war sie inzwischen schon zur Erkenntnis gekommen, dass diese ihre Zustände von den andern – den Wissenschaftern, den Unbeteiligten also – mit dem Wort "Depression" bezeichnet werden. Gewiss, das war eine Depression, eine Druckminderung also, wenn einem Menschen nicht der geringste Reiz – oder eben Druck – übrig bleibt, irgend etwas zu tun, weil er erkennen muss, dass stets nur Selbstsucht, Genusssucht und Zerstreuung in die Wüste der äussern, vergänglichen Erscheinungen der Grund all seiner Reize und Dränge (oder eben seines Druckes) sind. Was aber kann denn das Leben für einen Sinn haben, wenn jede Tat eine Selbstsucht zum Grunde hat und jedes Nichtstun dem Tode gleicht, der ja auch nichts tun kann; nur mit dem Unterschied, dass der wirkliche Tod wenigstens sein Nichtstun oder seine eigene Sinnlosigkeit nicht verspüren muss wie der Mensch, der zwischen ihm und der Hölle zu wählen hat - wie es ihr stets bestimmter vorkam. Einen Gott würde sie, die mittlerweile fast Verzweifelnde, gerne annehmen, wenn es nur einen geben könnte. Aber wie könnte er auch nur denkbar möglich sein, vor der geläuterten Vernunft, die in der Reihe der stummen Natur ein Ding aus dem andern hervorgehen sieht wie eine endlos lange Kette, an deren Schluss der sich selbst bewusste Mensch gesetzt ist, damit er die Verdammung in die Nutzlosigkeit allen Seins durch sein Selbstbewusstsein auch empfinde, und damit den Fluch aller Natur. Niemand konnte sie befreien aus solchen Ansichten. Sie waren begründeter und stärker als alle Gegendarstellungen. Zu den Ärzten oder Psychologen mochte sie kein Vertrauen fassen, kannte sie sie doch durch den Umgang mit ihnen während der Ausübung ihres Berufes; und bei den Gläubigen irgend einer Gemeinschaft mochte sie auch nicht Rat suchen, da ihr diese oft als zu naiv erschienen. Mit der Annahme oder gar der Liebe zu einem Gotte ging es also durchwegs nicht, sosehr sie sich manchmal zu Zeiten gewünscht hätte, dass es einen gäbe, weil ihr auch ein noch so ungenau erkannter Sinn oder Zweck des Lebens erträglicher vorgekommen wäre als die Sinnlosigkeit allen Werdens und Vergehens in der Natur. Dachte sie dann aber wieder an die Glaubensgemeinschaften, so empfand sie eine Art von Scham, sich Gott so verdrehbar vorstellen zu können, wie er von den verschiedenen Glaubensrichtungen verdreht, und damit verunmöglicht wurde. Mit der Liebe zu den Menschen aber ging es ohnehin nicht, denn wer diese in ihrer Selbstsucht liebt, der liebt ja das Schlechte selbst – wie will er dann von ihm loskommen? Und so konnte sie Gott nicht lieben, weil er ihr nicht nur unsichtbar war, sondern auch undenkbar – bei den Verhältnissen auf dieser Welt; und den Nächsten konnte sie nicht lieben, weil er schlecht war, und sie von seiner Schlechtigkeit ja eben gerne losgekommen wäre. Überall suchte die nun schon mehrere Jahre Schwergeprüfte einen Sinn, und fand doch keinen. Zu ihrem Leidwesen kam, dass kein einziger ihre inwendigen Verheerungen sehen konnte, die sie innerlich zu einem Krüppel oder einer Lahmen machte, die aus ihrer Sicht der Dinge an nichts mehr Freude haben konnte, sich auch zu keiner Handlung mehr entschliessen konnte, da sie in einer jeden doch nur Selbstsucht als Grund erkannte; vielmehr wurde sie ihrer Stellung wegen noch beneidet. Dabei hätte sie sie recht gerne aufgegeben, könnte man nur ohne Geld leben! Denn es war ihr trotz ihrer Leere oft lieber, nichts tun zu müssen, was sie dann aber die Sinnlosigkeit alles Tuns erst recht spüren und fühlen liess. Und dennoch gab es Beschäftigungen, die sie manchmal etwas von ihren sie quälenden Gedanken abzuziehen vermochten. Es waren just jene, von denen sie sich in ihrer Jugend am meisten zu distanzieren versuchte: monotone Handlungen, wie sie wohl Akkordarbeiter verrichten mochten, zum Beispiel das Lochen von Akten, die bereits geordnet waren, oder auch die stets wiederkehrenden Haushaltarbeiten, aber auch das Stricken von Hand, besonders, wenn es nur möglich gewesen wäre, wenn damit einer Not leidenden Mutter eine Arbeit abgenommen würde. Aber eine solche Not gab es schon lange nicht mehr, und deshalb auch nicht mehr viel Grund oder Sinn, etwas von Hand zu stricken. Einmal auch wandte sie sich in ihrer Verzweiflung den so genannt aufbauenden Künsten zu und suchte in Handarbeiten und Malen einen Ausweg aus ihrer Situation. Aber sobald sie merkte, dass ja alles und jegliches ihres Tuns nur darauf gerichtet war, sich selber zu dienen – mit dem Ziel einer möglichen Erlösung aus ihrem Tief der Depression –, erschien ihr fortan auch diese Tätigkeit als sinnlos. Was sollen all die vielen Bilder beispielsweise, die Menschen nur darum gemalt hatten, um von sich selber loszukommen? Wenn sie anderseits aber wieder die Bilder in Kunstbüchern betrachtete, die sie sich in ihrer innern Not einmal anzuschaffen begann, so ersah sie darin vielfach nichts anderes als das Festhalten einer Schönheit zum ständigen Genuss. Die vielen Akt-Darstellungen waren dafür ein schöner Beweis. Die Landschaftsdarstellungen waren aber im Grunde ebenso ein blosses Schwelgen in Licht und Farbe, ein sinnliches Prassen sozusagen zur Sättigung der sinnlosen Gier nach noch mehr. Ein Festhalten auch eines Augenblickes, der sich nicht festhalten lässt, weil das einzige, das des Festhaltens wert gewesen sein könnte, in einer innern Anteilnahme – eben am andern – bestanden hätte, und nicht in der Zusichnahme oder Vereinnahmung des andern. Solche Gedanken aber brachten denn doch manchmal Stimmungen in ihrer innern Wesensleere zustande, die zu ihrer Logik, ein gewisses Gegengewicht zu erzeugen vermochten. Wohl waren solche Gefühle oder Stimmungen verschwommen, ungenau und äusserst unstet – etwa wie der Gottesbegriff unter den verschiedenen Glaubensgemeinschaften, oder gar unter den Alltagsmenschen, wie sie überall sind. Und dennoch kamen ihr dabei manchmal Ahnungen vor, die ihrem manchmaligen Wunsche, dass es einen Gott geben möge, recht ähnlich sahen. Einmal sah sie dann in einem Foto-Kunstbuch eine Teilaktfotographie, die Brust einer Jungfrau von vorne zeigend, wie sie sie mit ihren beiden Händen schützend zuzudecken versuchte. Dabei waren natürlich nur die jeweils ganz unmerklich und sanft beginnenden Erhebungen zur weiblichen Brust hin fast ganz zu sehen, von der Wölbung der eigentlichen Brust aber nur die mehr gegeneinander liegenden, also dem eigentlichen Busen zugewandten Seiten. Die Brustwarze war von den beiden Händen ganz verdeckt. Hals- und Bauchpartien waren nicht mehr ersichtlich. Irgendwie hatte diese Fotographie sie getroffen! War es wohl der grosse Unterschied dieser Sanftheit und Behutsamkeit des Ineinanderfliessens der runden Form in ihre sie aufnehmende Fläche, das – durch ihre Abbildung von vorne her – nirgends mit einer Konturlinie ersichtlich werden konnte, sondern nur über den sanften Wechsel von Licht und Schatten miteinander erahnt, ja beinahe nur erhofft werden konnte – gegenüber den sonst eher harten und oft unvermittelt auf einander treffenden Konturlinien so mancher Stadt- oder Zimmeransichten desselben Buches? War es die Fülle der dem Betrachter entgegenquellenden, ja zuneigenden Form, im Unterschied zu der mit Sinnlosem gefüllten Leere der abgebildeten Strassen oder Zimmer anderer Abbildungen? Oder waren es die als zum Bilde äusserst unpassend empfundenen, so genannt gepflegten Hände, welche die unter ihnen liegende Fülle verbergen wollten, während sie doch nur die Sinn- und Nutzlosigkeit ihrer Pflege – angesichts der unter ihnen liegenden Fülle (wenigstens der Form) – zur Schau trugen? Oder war es das instinktive Erahnen, dass die durch die Form der Brust versinn-lichte Fülle, gerade über dem Herzen liegend, dessen Liebefülle symbolisieren könnte? Sie wusste es nicht. Aber an irgendetwas schien sie dieses Bild zu erinnern. Es liess ihr keine Ruhe. Manchmal empfand sie fortan beinahe so etwas wie eine Andacht, wenn sie an diese Abbildung nur dachte, in Zeiten, in denen sie sie nicht betrachtete. Das erschien ihr merkwürdig. Denn für sie war längst auch die weibliche Brust – wie alle äussere Form überhaupt – zum Gemeingut der Selbstsucht der Menschen geworden. Denn diejenigen, die sie haben (die Frauen), achten ihres eigenen Wertes oder gar Sinnes kaum, sondern nur der Möglichkeiten, die sie ihnen gibt, bei andern damit etwas erwirken zu können; und jene, die sie selber nicht haben (die Männer), trachten danach, wie sie möglichst ohne viel Aufwand und Verpflichtung auch das ihnen bis jetzt noch nicht zur Verfügung Stehende in die Gewalt und zur Verfügbarkeit ihrer tobenden Sinnengier bringen können. Und so wird alle Erscheinung oder äussere Form nur zu einem Treffpunkt all der vielen Selbstsucht der verschiedenen Menschen. Und doch, – immer wieder wurde sie berührt und wie von Andacht erfüllt beim Gedanken an diese Abbildung, bis sie sich eines Abends plötzlich, eines Jugenderlebnisses entsinnend, bewusst wurde, wieso ihr dieses Bild der menschlichen Brust so viel zu sagen hatte. Nicht sie selber war es nämlich, der bisher je eine Brust so hehr erscheinen konnte, wie ihre Andachtsgefühle sie nun vermuten lassen könnten, sondern einer, der seinerzeit in den Augen der andern nicht alles in seinem Gehirn geordnet hatte: Er war zwar in der Schule nicht eben zurückgeblieben, umso mehr aber in seiner so genannten Gesellschaftsfähigkeit. Immer war er allein. Und war er schon einmal unter andern, so sagte er kaum je ein Wort. Die meisten mieden ihn, ohne dass er ihnen zuwider war, einfach darum, weil aus ihm nicht draus zu kommen war. Man belächelte ihn wie ein gutmütiges Tier, ohne seine Gutmütigkeit anderseits auszunutzen. Und mit dem Gedanken an diesen Jüngling verband sich die Erinnerung an ein Erlebnis, dessen sie sich nicht gerne erinnerte. Berührte es doch eine Seite ihres jugendlichen Lebens, an die sie später, in der Nüchternheit ihrer Bildung und gesellschaftlichen Stellung, nicht mehr gerne erinnert werden wollte. Sie war – damals schon um die Gunst der andern so beflissen, wie später im Beruf, noch bis in ihre Depressionsperiode hinein – dem genusssüchtigen Willen frühreifer Kameraden gegenüber schon sehr offen und für die damalige Zeit auch zu vielem bereit gewesen – nur um ihrer Beliebtheit bei den andern willen –, ohne dass es allerdings je zu wirklichem Geschlechtsverkehr gekommen wäre. Und da geschah es einmal, während eines Spieles im Freien, als sie sich mit drei Knaben zusammen in einem Versteck befand, in welchem sie sich sicher wähnten, dass sie diesen drei auf ihren Vorschlag hin wenigstens die obere Hälfte ihres Körpers zur Schau preisgab. Aber gerade in jenem Moment, als die Drei nebst der Beschauung auch zur Befühlung kommen wollten, zwängte sich – wer weiss, wie und weshalb – gerade jener nicht eben gar zu Gesellschaftsgewandte durch den engen Spalt in das dämmerige Versteck, ohne dass er allerdings die Vier vermutet hätte – und natürlich noch weniger bei dieser Beschäftigung. Die Verlegenheit war allen zusammen gemeinsam ins Gesicht gezeichnet gewesen. Und die Vierergruppe war sofort irgendwie bestrebt, ihre nun offenbar gewordene Handlung dem neu dazugekommenen, zurückgebliebenen Blödling als etwas Selbstverständliches und Natürliches darzustellen, das er ganz einfach nicht zu fassen imstande sei. Sie wandten sich darum alle wieder von ihm ab und stellten sich in einem Halbkreis um das Mädchen, sodass es durch sie vor dem Neuankömmling etwas verdeckt wurde, und scherzten mit ihm, es gelegentlich kneifend, sodass es ein- oder zweimal, eher lustvoll als schmerzlich, aufmuckste, ohne dass der Neuling, der scheinbar fassungslos beim Eingang stehen geblieben war, sehen konnte, was eigentlich vor sich ging. Aber bald einmal drehten sie sich dann um und verzogen sich verlegen in die mehr dunkleren Ecken des Raumes zurück. Das Mädchen, nun völlig sich selbst überlassen und bei seinem Tun ertappt oder entdeckt, empfand die grosse Frage im Gesichte und in den auf es gerichteten Augen des ungeschickten Ankömmlings, der es wortlos anblickte. Und, um sich selber vor dem Einen eine Sicherheit vorzuspielen und seine gefühlte Schuld mit dem Neuen zu teilen, damit dieser nicht zum Verräter werde, lud es ihn ein, doch selber auch zu ihm zu kommen, wenn er schon einmal so günstig dazukäme. Dieser aber blieb wie angewurzelt stehen – ja, er schien sich nicht einmal regen zu können –, seinen Blick unverwandt auf das Mädchen gerichtet. "Na, glaubst du, dass ich dich beisse? So komm doch endlich!" sagte es einladend und, mehr aus Verlegenheit, lächelnd. Langsam ging der Ungeschickte zwei oder drei Schritte auf es zu, blieb aber knapp vor ihm wieder stehen. In seinem Blick veränderte sich etwas, eine ungemeine Bewegung schien in ihm vorzugehen, sodass das Mädchen ihn erneut aufmunterte, zu kommen, um nur endlich anschliessend aus dieser Situation befreit zu sein. Da ging der Ungeschickte noch den letzten Schritt auf es zu, blieb noch einmal kurz vor dem Mädchen stehen, bückte sich zu seiner entblössten Brust nieder und küsste sie, sie mit seinem Munde erst kaum berührend, dann aber mit einem kurzen, heftigen Druck, worauf er sich umdrehte und das Versteck verlassen wollte. "Wo gehst du hin?" fragten ihn die andern, aus ihren Winkeln auf ihn zukommend. - "Ich werde euch nicht verraten", gab er zur Antwort, "ich suche einfach ein anderes Versteck". Seinen Worten war leicht zu glauben – denn er sprach ja ohnehin nie – und so entliess man ihn. Aber den Vieren war dennoch nicht mehr wohl in ihrem gemeinsamen Versteck. Nachdem sich das Mädchen seine Kleider wieder angezogen hatte, verliessen sie alle ebenfalls ihr Versteck und zerstreuten sich, ein jedes sein eigenes Versteck suchend. – Eigentlich war das alles. Und es war nicht viel. Aber das Sich-zur-Schau-Stellen war bis dahin schon öfters einmal vorgekommen; seit diesem Missgeschick aber nie mehr. Denn erstens empfand das Mädchen, dass es sich damit an der äussersten Grenze befand, und zweitens zog es bald darauf mit seinen Eltern in einen andern Ort, wo es ihm leichter fallen konnte, ein neues Benehmen anzunehmen, weil keine Bekannten um es waren, die es, auf seine bisherige Schwäche weisend, hätten dazu überreden können. Fremden Begehren aber vermochte es nun schon besser zu widerstehen, indem es sich ohnehin für die emotionslose, gebildete Gesellschaft zu interessieren und zu entscheiden begann. Nun aber stiegen, nach dem Wiedererinnern an dieses Vorkommnis, Bilder in ihr auf und begannen Fragen sich zu melden, sodass sie an jenem Abend, als ihr die Erinnerung kam, sehr stark mit sich beschäftigt war. Immer wieder versuchte sie, sich den Blick des Ungeschickten vorzustellen, der auf sie gerichtet gewesen war, und sich ihre Gefühle zu vergegenwärtigen, die sie dabei empfand. Denn nun erst – bald zwei Jahrzehnte danach - empfand sie es, dass ihr das damalige Erlebnis durchaus tiefer gegangen sein musste, als sie es damals wahrnahm. Sie fühlte nun einerseits wieder die seichte Belustigung in den Gemütern der Drei und ihre eigene Befriedigung darüber, wieder einmal im Mittelpunkt des Interesses gestanden zu haben, und fühlte als äusserst tief empfundenen Gegensatz dazu den Ernst des Ungeschickten, ja in der letzten Phase des Geschehens sogar eine stumme Kraft, die in seinem ganzen Wesen zu erkennen war. Sie spürte eine gewisse Verehrung, die ihm – nebst der Überraschung natürlich – einen Abstand gebot; so, als sei er nicht würdig, sich dieser Erscheinung zu nähern. Und als Gegensatz dazu empfand sie in ihrer Erinnerung dann aber auch wieder den heftigen Feuerzug einer aufkeimenden und begeisterungserregten Liebe zu dem, was die Begriffe all seiner bisherigen Erfahrung wohl übertroffen haben musste und seine Sinne dadurch völlig überwältigt hatte. Sie spürte in ihrer neu erwachten Erinnerung die Zaghaftigkeit der Annahme dessen, was er vor sich sah, wohl auch das Bewusstsein, dass nicht sein war, was ihn so mächtig bewegte, so sehr es seinem eigenen Wesen auch entsprechen mochte; kurz, einen geheiligten Abstand und dennoch einen stets stärker werdenden Wunsch oder Zug, dem so sehr bewundernd Empfundenen etwas Wohltuendes anzutun – all seine Kraft ihm zu opfern. Bei den diese nachempfundenen Gefühle ausdrückenden Gedanken aber erschrak sie plötzlich, weil ihr bewusst wurde, dass zwar das Bild ihrer damaligen, erst im Anschwellen begriffenen Brust für das Auge und das Empfinden des Ungeschickten wohl ebenso schön, reizvoll und reine Gedanken an sachte und behutsam zart sich mitteilende Hinwendung erzeugend gewesen sein mag, wie sie es jetzt erst nachempfinden konnte; dass aber, im Gegensatz dazu, das Innere ihrer Brust schon damals äusserst schmutzig, schal und flach getreten durch die äussern Interessen gewesen sein musste, die sie gerade eben mit ihrer Zurschaustellung verfolgte. Nach dieser Erkenntnis und bestürzenden Gegenüberstellung der innern gegenüber den äussern Verhältnissen begann es ihr leid zu tun, dass der Ungeschickte sie geküsst hatte, dass er sein sicher reines und für das Schöne und Gute begeisterungsfähige Wesen an ihr verunreinigt hatte. Sie schämte sich und ihr ekelte vor ihrem eigenen Wesen, und in tiefer Reue begann sie zu wünschen, sie könnte sich – wenn vielleicht auch nur durch unsägliche Mühe und Schmerz möglich – so stark reinigen, dass sie nachträglich doch dieses Kusses würdig werden könnte, damit er nachträglich wenigstens dem liebeernsten Ungeschickten nicht zur Schande werden musste. Sie kam sich bei diesen Gedanken und Wünschen als völlig blossgestellt und verworfen vor, sodass sie sich kaum zu helfen wusste und ihr dadurch offenbar gewordener, innerer Zustand ihr keine Ruhe mehr liess. Erst nach einer geraumen Zeit begann eine neue Ahnung und Vermutung durch ihr Gefühl beruhigend auf sie einzuwirken: Sie war sich zwar ihrer damaligen, peinlichen Situation des Entdeckt-geworden-Seins – beim Eintritt des Ungeschickten – noch völlig bewusst und empfand darin alleine auch den Grund ihrer Aufforderung an ihn, sich ihr doch zu nähern; aber nun empfand sie in ihrer Erinnerung auch neu hinzu, dass sie nach dem Aussprechen ihrer Aufforderung – beim Anblick des mit sich selbst ringenden Ungeschickten – ein gewisses Mitleid für ihn empfunden hatte, und dass ihre zweite Aufmunterung wohl eher in diesem Mitgefühl begründet sein mochte, welches ihn aus seiner Isolation befreit wissen wollte. Dieser Gedanke – wenn auch bloss auf ihrer Ahnung beruhend – vermochte sie etwas zu beruhigen und ihr Wesen wieder etwas zu erwärmen. Sie verspürte dabei auch, dass in ihr durch ihre innere Beschäftigung mit dem damaligen Ungeschickten, eine gewisse Liebe zu ihm entstand; und plötzlich wurde ihr bewusst, dass sie nun, zum ersten mal in ihrem Leben, eine Besserung oder Veredelung ihres Wesens nicht um ihrer selbst willen wünschte, sondern um eines andern willen. Und sie begann zu ahnen, dass sie damit an einen Wendepunkt in ihrem Leben gekommen war – möglicherweise an das Ende ihrer empfundenen Wüste, die sie in sich selbst ebenso verspürte wie um sich herum. Denn all das erschloss sich ihr nun auf einmal, weil sie mit dem ganzen Gemüt und all ihren Gefühlskräften – wenn auch bloss in der Erinnerung – auf das Vorkommnis und besonders auch auf das Wesen der daran Beteiligten eingegangen war und dabei erst das Gute vom Schlechten wirklich, weil gefühlstief, zu unterscheiden lernte, dadurch erstmals zu echten Liebegefühlen und wahrer Neigung für das Gute und Reine kam, weil sie es als tief befriedigend schön, und doch so selten und in der Welt so gefährdet erkannte. – Wie wenig aber hatte der bei ihr bisher vorherrschend gewesene Verstand von demselben Vorkommnis für sie herab beissen können? Die leere Tatsache eines einzigen Kusses bloss – von einem Aussenseiter noch dazu –; eine flüchtige übliche Handlung also, die bei allen möglichen – passenden und unpassenden – Gelegenheiten von den aller verschiedensten Menschen aus den allerverschiedensten Gründen begangen wird. War es bei solcher Bewandtnis verwunderlich, dass sie sich bis anhin einsam und wie in einer Wüste vorgekommen war? Nur der sinnliche Reiz des in ihrer Jugendzeit noch neuen und unbekannten Äussern täuschte sie in frühern Jahren über die in ihr tatsächlich vorhandene Gefühls- und damit auch Lebenswüste hinweg. Noch längere Zeit, bis über Mitternacht hinaus, war sie in ihren Gefühlen und Gedanken mit ihrem damaligen Erlebnis beschäftigt. Aber erst am andern Morgen, nach einer relativ ruhigen Nacht, wurde sie sich einer Veränderung in ihrem Befinden bewusst. Es war ihr so, als hätte sie gestern Nacht sich einmal wieder satt gegessen und getrunken, nach einer ewig langen Fastenzeit und Dürre. Ja, es war ihr auch, als wäre sie einmal wieder in einem Zuhause gewesen, nach einer unendlich langen Zeit des Ausserhauses-Seins, nach einem äusserst mühsamen und leidensvollen Aufenthalt in der leeren, staubigheissen Ebene einer Wüste. Es war ihr auch so, als wäre sie in einer Gesellschaft gewesen, nach einer ewig-langen Zeitendauer der Einsamkeit. Und wieder war es ihr, als gehörte sie nun irgendwo hin; als sei sie eine, die von einem andern herkommt und zu diesem andern gehöre. Dieses Gefühl aber hatte sie merkwürdigerweise weniger, wenn sie an den bestimmten Ungeschickten dachte, mit dem sie sich in der gestrigen Nacht innerlich beschäftigt hatte. Vielmehr verstärkten sich diese Gefühle, wenn sie sich einfach dankbar über das gestrige Erlebnis erfreute. Zwar empfand sie bei Arbeitsantritt sofort wieder die unendliche Wüste der gesellschaftlichen Beziehungen. Heute allerdings spürte sie: Sie war ja nicht mehr Teil dieser Wüste, sondern eine Fremde, eine Lebende auch, die sich in das Reich dieses staubigheissen Todes verirrt hatte; aber eine – so kam es ihr vor –, die nicht verloren war, sondern einem gehörte. Sie wusste zwar nicht, wem – denn der Ungeschickte war es nicht –, aber dennoch hatte sie dieses Gefühl, das sie natürlich beseligte, wenngleich sie es nicht verstehen konnte. Etwa so, wie einer nicht verstehen kann, warum er ständig das Gefühl habe, allem nicht genügen zu können, wenn er keinen ersichtlichen Grund dafür findet, aber durch dieses Gefühl eben dennoch stark tangiert wird; so hatte sie, nur umgekehrt, ein sehr belebendes und die Dankbarkeit förderndes Gefühl, ohne einen ersichtlichen Grund dafür zu kennen. Sie hatte diesen Morgen Gott sei Dank leichte, eher administrative Arbeiten zu erledigen, sodass sie sich stärker mit ihrer veränderten, innern Situation auseinandersetzen konnte. Und da fand sie bald einmal heraus, dass sie dennoch durch eine Art Sympathie, die eher schon dem Beginn einer Liebe glich, mit dem Wesen des Ungeschickten verbunden war, dass aber nicht der Ungeschickte selber ihre Liebe erregte, sondern die Reinheit seiner Gefühle und die Uneigennützigkeit seiner Liebe, welch beide sie sich so zu Herzen gehen liess, dass sie immer stärker den Wunsch zu verspüren bekam, sie selber zu besitzen. Es war vielleicht eher die Dankbarkeit darüber, dass es ein solches Vorbild für sie geben konnte, das ihr das Gegenteil ihres bisherigen Lebensstils und ihrer bisherigen Gesellschaft plastisch darzustellen vermochte, die sie zur Liebe zu diesem Besseren erregte. War es bisher nur immer die Erkenntnis des Schlechten ihrer bisherigen Lage, die sie antrieb, sich selbst und ihre Lage ändern zu wollen, so war es nun erstmals nicht die blosse Erkenntnis, sondern die Liebe zum Guten – nicht mehr die Trennung vom Schlechten, sondern die Vereinigung mit dem Guten –, die sie antrieb, ja im Moment gar beflügelte. Warum auch konnte unter allen, die sie kannte, nur ein Ungeschickter das Gute und Wahrhaftige so rein erhalten, dass sie es in ihm erst zu finden und zu lieben beginnen vermochte? Am Nachmittag hatte sie zwei Besprechungen, eine mit Vorgesetzten zusammen und eine mit Gleichgestellten. Obwohl sie in gewohnter Weise daran teilnahm, so beobachtete sie dennoch verstohlen die Wirkung dieser Begegnungen auf ihre Gefühle und verglich sie, der Unterscheidung wegen, mit jenen vom Morgen. Zu was alles liess sich doch Gehirn und Verstand missbrauchen, dachte sie. Wie einfach und vollständig war doch ihre innere, bloss im Gefühl nachempfundene Begegnung mit dem Ungeschickten von gestern Abend, und wie kompliziert und dennoch äusserst unvollständig, ja beinahe fragmentarisch war dagegen die bloss intellektuelle Verständigung mit den Besprechungsteilnehmern – so empfand sie. Wie wenig brauchte doch der Mensch eigentlich zu seiner innern Entwicklung und Befriedigung, und ein Wievielfaches davon bietet er zumeist auf, ohne aber etwas Erkleckliches dafür zu erhalten – dachte sie. Ihr wäre im Moment das damalige Versteck ihrer Jugendsünden lieber gewesen als das grossartigste Versammlungs-lokal, und der Blick des Ungeschickten hätte ihr mehr zu sagen und zu geben vermocht als alle die vielen nutzlosen Worte der äusseren Verständigungsversuche, wo doch ein jeder nur vom andern denkt, dass er ihm könne. Obwohl sie sich ordentlich zusammennehmen musste, dass sie nicht ständig in ihren gedanklichen Erlebnissen verweilte, anstatt in der Besprechung, und es dennoch kaum fertig brachte, wusste sie merkwürdigerweise am Ende derselben mehr und genauer Bescheid als bei frühern Malen, obwohl sie dannzumal stets vieles dazu notiert gehabt hatte. Es war das Gefühl, das lebenstiefe Gefühl, das sie die Aussagen der andern ungleich tiefer fassen liess, als ihr Intellekt es je zuvor vermocht hätte. Es war der Massstab der Liebe auch, den sie an jedes vorgebrachte Votum legte, der ihr diese tiefen, gefühlsbedingten Aufschlüsse über Verlauf und Teilnehmer dieser Besprechung ermöglichte. Sie wusste es zwar nicht – sie konnte es ja gar nicht wissen –, aber in dankbarer Verwunderung der Veränderung innewerden, das konnte sie wohl; sie, die erst gestern wie ein Kind von diesem Massstab selber erstmals überrascht wurde, als sie seine Tiefe des Erfassens erfuhr. Zu Hause holte sie noch vor dem Nachtessen zuerst ihr Fotokunstbuch hervor und betrachtete wieder die abgebildete Brust der Jungfrau. Sie wurde dabei so mächtig ergriffen von der intensiv erahnten Aussage dieser einfachen, aber vollkommenen und harmonischen Form, dass sie sich ihrer Tränen nicht erwehren konnte beim vergleichenden Gedanken an das, was am Nachmittag, während der Besprechung, durch Rede und Bilder an sie herangetragen wurde. Wie so allerdemütigst einfach, prunklos und unschuldsvoll, aber dennoch lebenskräftig gestaltete sich doch die sachte Erhebung einer Brust – dieser Sammlung für die Nahrung eines kleinen, werdenden Menschenkindes – über der Fläche des Brustkorbes; und wie schön musste es erst sein, dazu noch das Heben und Senken des Brustkorbes, beim Ein- und Ausatmen, sehen zu können, dieses Sinnbild des Nehmens und Gebens in die Tiefe und aus der Tiefe des menschlichen Seins – so fühlte sie, ja ahnte sie mehr, als dass sie sich es schon bewusst denken konnte. Wer – ja wer nur könnte unter den jetzt lebenden Menschen so etwas – wenn auch nur in der toten Materie – erschaffen, geschweige denn erst im Leben selbst? Das war denn doch ein gediegen ausgesprochener Gedanke, der aus der tiefen, liebeerfüllten eigenen Brust aufstieg in ihr Haupt, und da zur Frage wurde, die sie nicht zu beantworten vermochte. Sie begann dabei zu erfassen, dass wohl nicht jeder Enthusiasmus eines Mannes beim Anblick einer weiblichen Brust bloss auf dem sexuellen Bereich seinen seichten Grund habe. Wohl hätte sie – als Frau – zwar an ihrer eigenen Vermutung noch zweifeln können, aber der Ungeschickte liess es sie ja just durch seine etwas unbewegliche Ungeschicklichkeit, die seine wahren Gefühle nicht zu verdecken oder zu verbergen vermocht hatte, erkennen, dass es Tieferes und Höheres in einem Menschen geben musste als die sinnliche Gier. Wie ein überwältigtes Kind war er vor ihr gestanden. Nicht vor ihr, sondern vor der vollendeten Form ihres damals noch jugendlichen Leibes. Er besah nicht sie – so empfand sie nun –, sondern das Werk eines Vollendeten, der Dinge schafft, denen sie in ihrer eigenliebigen Brust wohl kaum je gerecht zu werden vermag durch die Entsprechung ihres Wesens mit der Form ihres Leibes. Das empfand sie nun tief, und es brannte sie in ihrer Seele, diesen Meister nicht nur nicht zu kennen, sondern in ihrem vor lauter Erkenntnissen total verstaubten Verstande ihm nicht einmal die Chance seines Bestehens geben zu können. Das kann nicht die Natur sein, das muss einer sein, der die Liebe kennt; der aus solcher Liebe heraus schafft. "Der Ungeschickte wird ihn kennen!" dachte sie. Ja, gewiss, auch er war so einfach in seinem Wesen, so überwältigend einfach, dass seine einfachen Äusserungsformen von allen nur belächelt wurden, obwohl sie zu den eindrücklichsten gehörten, die sie je empfand – erst jetzt empfand, zufolge ihrer bisherigen Unerreichbarkeit über ihren Verstand. Unzählig viele Küsse hatte sie seither schon erhalten: Begrüssungs- und Abschiedsküsse, Kompliments- oder Anerkennungsküsse; niedrig sinnliche Küsse, begierdevolle Küsse, die eher dem Fressen der Tiere glichen als einer Liebesbezeugung; aber einen so viel sagenden, in andachtsvoller innerer Ergriffenheit gewachsener, ja durch seine Behutsamkeit erst so recht voll ausgereiften noch nie. Die Achtung, ja die subtilste Anteil nehmende Rührung und das Sich-Zurückhalten zugunsten des andern war sein Wesen, die Liebe zum Vollkommenen sein Grund! "Schade, dass du ihn an meinen schlechten Leib und auf meine, damals eigenliebiger Gedanken volle Brust geheftet hast", dachte sie. Aber mit all diesen Gedanken wuchs in ihr, ihr selber erst mit der Zeit bewusst werdend, die Liebe und das Verlangen nach einem grossen, vollendeten Meister, nach einem trauten Vater auch, der das stümperhafte Beginnen seiner Geschöpfe – sowohl im Erkennen, wie in der Tat danach – liebevoll zu vollenden bereit ist, so, wie er diese Vollendung schon vorbildend in alle äussere Form gelegt hatte. Aber sie fühlte auch, dass sie mit solch grossen und erhabenen Gedanken nicht für die Gesellschaft von normalen Gläubigen – anstatt Gottbegeisterten – taugen würde. Wo war wohl dieser von ihr stets mehr ersehnte Meister und Vater seiner unbeholfenen Kinder zu finden? Sie dachte, dass, wenn es ihn gäbe, er nun doch auch ihren ihm sicher angenehmen Wunsch empfinden müsse, indem er ja unmöglich so gefühlsstumpf sein könne, wie sie selber damals gegenüber dem Ungeschickten und wohl sogar bis in die jetzige Zeit hinein war, dass er, wie sie, nahe zwanzig Jahre brauchen würde, um ihre Not, ihren innersten, aber deshalb auch doppelt so stark empfundenen Wunsch, vernehmen und erkennen zu können. Kurz darauf, einmal bei der Arbeit, sollte sie aber dennoch darauf aufmerksam werden, wo und wie etwa ein solcher Vater zu finden wäre. Da machte einmal der Lehrling vor dem versammelten Gremium aller an einem Arbeitsvorgang Beteiligten auf einen Mangel aufmerksam, den alle schon lange suchten und nicht fanden, während der Lehrling, der eben erst dazugekommen war, diesen fast beiläufig erwähnte und sich verwunderte, dass man so lange und so aufwendig nach ihm suchen musste. Da gab ein stets lustiger Kauz, der einmal Kind überaus frommer Eltern war, jedoch selber nichts glaubte, aus dem Schatze seiner in der Kindheit oft gehörten Bibelzitate das Folgende zum Besten: "Ich preise dich, Vater, dass du solches allen Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart" (Matth. 11,25). Alle immer noch staunenden, wichtigen und weniger wichtigen Beteiligten brachen in schallendes Gelächter aus, als sie die wirklich treffende Stelle in die verwunderte Stille der Versammlung ertönen hörten. Auch sie selber lachte anfangs mit. Aber bald danach erfasste sie den tiefen Sinn dieser Aussage. Denn sie sah in sich wieder die egozentrischen und sich selbst überschätzenden Verstandestiftler, wie sie sie seit ihren Depressionen in ihrem Innern zu empfinden begonnen hatte, und erkannte zu ihrer Freude, wie sie alle zusammen von einem einfachen oder unmündigen Lehrling zurechtgewiesen wurden und wie all ihr voriges Bemühen ein vergebliches war. Und sah anderseits dann in der Erinnerung den Ungeschickten, der ihr ohne Worte Aussagen machte, von denen diese Eingebildeten nicht einmal etwas zu ahnen imstande gewesen wären. Gott, einen Vater hatte er ihr, ohne ein einziges Wort gesagt zu haben, als möglich – ja, als wahrscheinlich – erscheinen lassen. Und nun hat der Lehrling – freilich ohne sein Wissen – das seine dazu beigetragen, die Ineffizienz all solcher verstandesbetonter Selbstsucht durch seine einfache Beobachtung zu entlarven. Und ein Spassmacher und Sprücheklopfer hat ihr den sofort einleuchtenden Grund für all diese Erscheinungen geliefert mit seinem Bibelzitat, das besagt, vor wem Gott und die Wahrheit verborgen ist, und vor wem offenbar. Sie hätte den Sprücheklopfer und den Lehrling als ihre Freunde umarmen mögen. Sie war in einer Hochstimmung sogar und empfand die durch die Fenster einfliessenden abendlichen Sonnenstrahlen gleichsam als ein Segen spendendes, zustimmendes Lächeln eines gütigen Gottes zu diesen sie äusserst beglückenden neuen Erkenntnissen. Überhaupt lebte sie viel mehr in ihren Gefühlen als in ihrem Verstande seit der Zeit ihrer grossen Entdeckungen nach der Wiedererinnerung an jenen Vorfall mit dem Ungeschickten, die ihrerseits eine Folge der tief empfundenen Schönheit einer fotografierten Brust war. Soviel erhält der Mensch geschenkt, wenn er sich nur einmal den Werken der Schöpfung voll hinzugeben bereit und imstande ist, dachte sie. Und ihre beinahe kindliche Freude und Dankbarkeit erfrischte sie dabei manchmal so sehr, dass sie ihr zu Zeiten beinahe das Herz bersten machte. Indessen erfuhr sie mit der Zeit ihrer anfangs noch so stürmischen Entwicklung vom Verstande weg, in Richtung Gefühl und Liebe, auch einmal eine Verlangsamung und Minderung. Denn sie war ja eine im Verstande durchaus gebildete Frau und war infolgedessen durchaus fähig, Wirkungen und Folgen ihrer innern Wandlung auf ihre äussere Lage zu beurteilen. So hatte sie in ihrer anfänglichen Euphorie jenen Lehrling, der die Entdeckung des Mangels gemacht hatte, etwas zu sehr bevorzugt – in ihrer Achtung vor dem Einfachen und Unmündigen –, sodass sie bald zu spüren bekommen musste, wie dieser sich ihrer stets sicherer zu sein wähnte und diese Bevorzugung auszunützen bestrebt war. Auch wurde sie sich bewusst, was für Konsequenzen ein Leben nach den biblischen Forderungen nach sich ziehen konnte. Denn, stets die Wahrheit zu sagen, also kein falsches Zeugnis zu geben, wie in den 10 Geboten verordnet war, schien ihr in der höheren Gesellschaft ein unmöglich Ding zu sein. Als einfache Arbeiterin aber würde sie kaum mehr jenen Verdienst erhalten, der ihr bisheriges Leben, das allerdings seit ihren Depressionen kein verschwenderisches mehr war, garantieren könnte. Sie spürte auch, dass sie in ihrer Begeisterung für das Ärmliche und Unmündige selber naiv werden konnte – also geradezu ähnlich jenen Gläubigen, denen sie eigentlich nicht trauen wollte. Kurz, sie fühlte, dass sie sich an der Grenze zwischen zwei Reichen – Gefühl und Verstand – befand; dass sie eigentlich genau spürte, was sie wollte, aber dennoch zu Zeiten sich kaum getraute, das auch wirklich zu tun, was sie in sich als das Rechte verspürte. Aber zwei Orientierungspunkte konnte sie dennoch leicht in beiden Reichen ausmachen, zwischen denen sie stand – zwei Konzentrate oder Extrakte gleichsam: Auf der einen Seite die grenzenlose Ebene der Wüste aller Selbstsucht, die, den Winden ihrer Leidenschaften preisgegeben und den konzentrierten Strahlen des auf das eigene Selbst ausgerichteten Verstandes ausgesetzt, kein lebendiges und alles verbindendes Grün der Hoffnung aufkommen lässt; und auf der andern Seite die mühelose Kindlichkeit, die alles wesenstief erfasst und dadurch alleine fähig ist, das Gemüt wirkungsvoll verändernd zu durchdringen und zu veredeln. Es gab Zeiten, da nahm sie sich vor, dem blossen Äussern nach in der Wüste ihr Geld zu verdienen, dem Innern nach aber dem Ungeschickten gleich zu werden. Dachte sie dann aber wieder an den Ungeschickten, so überkam sie ob solcher Gedanken wieder eine tiefe Reue. Sie empfand, wie sie dadurch den Ungeschickten in all seiner Ungeschicklichkeit zeitweilig verlassen müsste und ihn der Welt preisgeben müsste, anstatt dass sie bei ihm bliebe, notfalls hungernd und frierend, aber seiner nicht missend und ihn niemals preisgebend. Sie hatte sich inzwischen eine Bibel angeschafft, las auch ab und zu darin, aber die besten Zitate daraus hörte sie stets noch von dem Sprücheklopfer im Betrieb, den sie darum geradezu in ihrem Visier hatte. Zu seinen Lieblingssprüchen gehörten nämlich gerade die kernigsten und aussagekräftigsten Stellen, wie etwa: "Es sei denn, dass ihr euch umkehret und werdet wie die Kinder" (Matth.18, 3.), was er oft dann zu sagen, pflegte wenn von den Oberen in einer Sache blinder Gehorsam verlangt wurde; oder auch: "Selig sind, die da geistlich arm sind" (Matth.5, 3.), wenn er dazukam, wie einer voll Eifer bei der Arbeit das pure Gegenteil von dem erreichte, was er beabsichtigt hatte; aber auch: "Wir wissen aber, dass denen die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen" (Röm. 8, 23.), wenn einer durch ein Ungeschick auf eine bessere Idee kam. Oder dann konnte er bei der Ertappung einer angehenden Liebesangelegenheit, zum Beispiel auf dem Korridor zwischen zwei Angestellten, auch sagen: "Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm." (l. Joh.4, l6.), kommt es euch in eurer Seligkeit nicht auch so vor? Bei Zurechtweisungen von oben her, die er nicht für gerechtfertigt hielt, pflegte er zu sagen; "Warum lässt ihr euch nicht lieber Unrecht tun?" (l. Kor.6, 7.). Immer waren seine Zitate zwar volle Treffer für die witzelnde Verstandesnatur des Menschen; aber ihr drangen sie seit jener Zeit oft tief ins Herz, weil sie es nun einmal der Liebe und dem Geringen und Verachteten zu öffnen begonnen hatte. Im Reichtum ihrer Liebe wurden dann aber diese wenigen Worte so gross und wirksam wie bei so manchen der ganze übrige Text der Bibel nicht, weil sie in ihrer Liebe all diese Worte in ihrem Herzen bewegte wie die Kinder ihre liebsten Sachen in ihren Händen, sodass sie von allen Seiten beleuchtet wurden durch die Sehnsucht ihrer Liebe, und dadurch ihr Wert vor ihr offenbar wurde, der ihr Gemüt so bereicherte und erfüllte. So sehr ihr Hin und Her zwischen Verstand und Gefühl, zwischen Welt und innerem Erleben, sie auch beanspruchen, ja zu Zeiten verwirren konnte, so fand sie aber dennoch stets ihre Orientierung dadurch wieder, dass sie sich sagen musste: In all der Zeit meiner tiefsten und schwersten Depressionen – in der Nacht meines Lebensüberdrusses – kam nicht ein einziger Lichtschein aus dieser so lichtvoll aufgeklärt scheinenden Welt der Vernünftigen und Gebildeten in meine Finsternis; ja, nicht einer von ihnen war imstande, meinen wirklichen Zustand zu erahnen. Zwar ahnte der Ungeschickte meinen damaligen innern, der Welt zugewandten Standpunkt auch nicht, aber dafür umso mehr meine und seine Bestimmung zum Leben aus der Liebe, die mir in die Form meines Leibes geschrieben war. Also konnte er alleine lesen und mir raten, während all die andern blind und taub blieben, ja sogar dumm wurden an dieser meiner mir gegebenen äussern Form. Und sein Benehmen war das erste Licht für meinen schon damals finsteren, innern Zustand, den ich nur deshalb noch nicht so zu fühlen bekam, weil in der Zeit der Jugend die scheinbaren Abwechslungen des äussern Erlebens betäubender und das Öde des Innern übertönender sind als in einem Alter, in welchem man leicht hinter allen noch so verschiedenen Erscheinungen und Erlebnissen nur immer wieder denselben Grund der Selbstsucht sieht. Und dieses Licht, das aus der Handlungsweise dieses Ungeschickten für mich hervorgeleuchtet hatte, überdauerte zwei Jahrzehnte – ohne die geringste Abnahme seiner Intensität. Wie weit leuchtet dagegen der Vernunftschluss eines so genannt Vernünftigen?! Er reicht zwar unter Umständen gerade aus, Gott vor einem kindlichen Gemüt zu verdecken; aber ihn und seine Werke und ihre Wirkungen auf den Menschen zu vernichten, reicht er in keiner Weise aus! Ein kleines Licht eines Unmündigen oder Ungeschickten, und schon wird der ewig Seiende und Schaffende dem kindlichen Gemüt wieder sichtbar. Solche Vergleiche brachten ihr zu Zeiten oft sehr zerklüftetes Gemüt wieder in eine ruhigere Verfassung und Ordnung. Denn das Erwachen der bisher noch nie belebt gewesenen Gemütskräfte konnte schon etwas durchaus Dramatisches und oft auch sehr Beengendes oder Überwältigendes an sich haben. Denn der Eindruck des Verachtetseins von aller Welt bei gleichzeitigem Fühlen der innerlichen Ewigkeiten der Wahrheit war für ein frisch belebtes Gemüt eine Diskrepanz, die es in den allerverschiedensten Bildern zu erdrücken drohten. Langsam begann sie auch zu ahnen, weshalb die Emotionen von jedermann geächtet und gemieden wurden und weshalb die Politik der Grossen und Mächtigen dieser Welt bestrebt war, die Emotionen zu dämpfen, ja, sie gar nicht erst aufkommen zu lassen. Emotionen – Gefühle – sind eine Kraft, eine ungemein starke Kraft, die imstande ist, ganze Ordnungen, oder gar das sich selbst bewusste Leben nahezu zu zerstören; die aber anderseits auch alleine fähig ist, ein von Hitze und Durst zerstörtes und vom Verstande flach getretenes Leben wieder aufzurichten, ja von neuem aufleben zu machen. Das hatte doch der Ungeschickte an ihr getan, als er – innerlich ringend – vor ihr gestanden hatte; und das hatte auch sie nun getan, als sie all ihre Gefühle auf sein damaliges Tun konzentriert hatte, nachdem sie sie zuvor schon auf die Form eines vom göttlichen Meister geschaffenen, äusseren Bildes konzentriert hatte. Manchmal wusste sie nicht, soll sie sich mehr den Emotionen hingeben oder mehr der Ordnung ihrer Kräfte. In den Momenten emotionaler Erregung konnte sie schwelgen im Glück. Aber bei nachheriger, nüchterner Betrachtung fragte sie sich dann, ob die aus den Emotionen entstehenden Taten unbedingt die richtigen seien. So konnte sie seit der Zeit ihrer innern Erweckung manchmal in sich selbst die Lust verspüren, die sie daran hätte, wenn sie von allen verachtet würde, wenn sie gedemütigt würde dadurch, dass man alle ihre geheimsten Regungen erkennen würde und sie dadurch vor jedermann lächerlich wirkte, sodass sie hilflos und abgeschnitten von aller Welt wäre. Denn sie spürte, dass dadurch ihre Liebe zu dem Geringen, so etwa, wie es Gott in der Person Jesu darstellte, als er in einem Stalle zur Welt kam, ungeteilter, inniger und sie durch und durch ergreifend würde. In solchen Momenten konnte sie sogar ihr ganz pervers erscheinende Vorstellungen entwickeln, dass sie zum Beispiel am liebsten als Putzfrau während der Arbeit der andern in ihrem Betrieb gearbeitet hätte, während die andern, sie dauernd sticheln und hänseln wollend, beengen würden alleine darum, weil sie von ihnen, und damit auch von ihren Idealen, abstand genommen habe. Sie stellte sich einmal sogar vor, ihre Mitarbeiter würden sie dann spasseshalber eine ganze Nacht in eine Kammer sperren, eben deshalb, weil man sich das mit einer Putzfrau noch am ehesten erlauben könnte. Sie konnte bei diesen Vorstellungen zwar die Beklemmung, die sie dabei fühlen würde, gut nachempfinden, aber sie empfand als grosse Lust zugleich das dabei zwangsweise innere Vereint-Sein mit den Schwachen dieser Welt, den Reinen, die in ihrem Innern dennoch Ruhe haben trotz – oder vielleicht gar eben wegen – den äussern Bedrückungen, sodass die an der Bedrückung Beteiligten unverhofft zu fühlen oder zu ahnen beginnen, dass an einer innern Ruhe vielleicht doch mehr gelegen sein könnte als an der Sicherheit einer äussern Weltstellung. Gewiss, das sind in den Augen von Normalen, das heisst solchen, die keine grossen Gefühle haben, sondern nur einen klar rechnenden Verstand, allermerkwürdigste Vorstellungen, Gedanken und Wünsche. Und gewiss würde man sie nicht mehr für voll nehmen, würde man ihre Gedanken kennen. Ja, man würde sich vielleicht fragen, ob ein solcher Mensch nicht besser in eine Klinik gehörte als in die normale Arbeitswelt. Aber was kann man nicht alles denken oder berechnen, das man nicht versteht, weil man von ihm keine Ahnung hat mangels des lebendigen und belebenden Gefühles. Und wie wenig sind und bedeuten doch solche berechneten Weisheitsschlüsse. Die Liebe aber findet in ihrem grossen Hang zum Geliebten stets neue Wege und erhellt durch ihre fortwährende Tätigkeit ihr Wesen mit stets neuen Erkenntnissen, die sie auf ihren Wegen gewinnt, auf welche sie der grosse Druck ihrer überschwänglichen Fülle drängt. Und so fand die nun der reinen Wahrheit und der glühenden Liebe Zugewandte bald einmal, dass diese ihre innersten, vor dem Urteil des blossen Verstandes noch so absonderlichen Wünsche sich im täglichen Leben zu verwirklichen begannen. Denn in ihrer Liebe zur Wahrheit konnte sie mit der Zeit immer weniger schlagfertig antworten, weil sie ja nicht mehr alleine dem Prinzip der Selbstbehauptung dienen wollte, sondern vielmehr vor allem der Wahrheit. Wurde sie nun etwas gefragt, so stand für sie nicht mehr – wie bei allen so genannt normalen Menschen – an erster Stelle der Antwortgrund, sich ja keine Blösse zu geben und sich ja keine Unsicherheit anmerken zu lassen; sondern es stand für sie nur noch ein Antwortgrund, nämlich erstens die Frage so umfassend als möglich zu erkennen und zweitens sie dann peinlich genau ihrer erkannten Wahrheit nach zu beantworten, das heisst mit andern Worten: nur bis dahin, wo sie noch ganz sicher sein konnte, sie auch mit all ihrer Erfahrung verbürgen zu können. Dabei fiel dann eine manche Antwort nicht mehr so elegant und selbstsicher aus wie früher, und sie fühlte sich dabei oftmals ein klein wenig blossgestellt – oder auch verraten, wenn es eher persönliche Fragen waren, die sie zu beantworten hatte. Die Gesellschaftssichersten des Betriebes merkten solche Kleinigkeiten bald einmal, nahmen sie – als Konkurrenz ihrer eigenen Stellung – nicht mehr so ernst und erdreisteten sich eher einmal, ihre Argumente oder Vorschläge zu übergehen, um dann durch die eigenen besser dastehen zu können. Denn in der neu gewonnenen Tiefe ihrer Gefühle erkannte sie, dass sie nicht mehr so wie bisher im gesellschaftlichen Spiele mitspielen dürfe, welches des Nächsten Fehler sorgsam aufzuspüren vorschreibt, um dann bei der Entdeckung eigener begangener Fehler durch andere, ihnen die ihren gegenüberstellen zu können und damit einen Tausch zu machen, indem man grosszügig beide Fehler totzuschweigen bereit war. Im Gegenteil, sie wollte zu den weniger Weltgewandten – den Ungeschickten – stehen, und in Gesellschaft zu ihrer inneren Wahrheit verbleiben. Denn die Wahrheit ist doch das Allerschwächste und Schützenswerteste unter den Menschen, weil sie diese Wahrheit schon der geringsten Weltvorteile wegen verlassen und verachten, ja sie sogar verfolgen. Durch diese ihre neue Haltung wurde sie im Prinzip dann auch tatsächlich gehänselt, so wie sie sich das manchmal wünschte, denn manch einer, der selber Fehler beladen war, genoss es, ihr irgend eine Kleinigkeit vorwerfen zu können, die sie sogar, sich entschuldigend, anerkannte, wenn der Vorwurf gerechtfertigt war, ohne dass er riskieren musste, von ihr ebenfalls einen wahrscheinlich noch viel grösseren, eigenen Fehler beanstandet zu bekommen. So sehr sie manchmal solche Situationen schmerzen konnten, speziell wenn ein arroganter und erst noch fahrlässiger Mitarbeiter es in einer bewusst eher beleidigenden Form vorbrachte; so sehr empfand sie anderseits eine Befreiung darin, dass sie nicht ständig nach Gegenargumenten suchen musste und auch nicht nach Gegenanschuldigungen, die sie anspielend hätte erwähnen können. Nein, sie konnte einfach dastehen und ihr ganzes Augenmerk auf die vor ihr stehende Person richten und dabei zu fühlen und zu begreifen beginnen, aus welchen innern Beweggründen diese so zu handeln genötigt wurde. Manch einer begann diesen auf ihm ruhenden Blick als unangenehm zu verspüren, weil er durch ihn sein Unrecht verstärkt zu empfinden begann. Diese wichen ihr mit der Zeit eher aus und zogen es vor, sie hintenherum anzuschwärzen. Damit aber wurde sie dann auch zur Putzfrau ihrer ihr als so pervers erschienenen Wünsche, die mit einem sanften und weichen Lappen der Duldung und des Geschehenlassens den Staub der eiteln, purer Selbstsucht dienenden Gepflogenheiten von den einzelnen Vorkommnissen wischte und damit die wahre Form der verschiedenen Verhältnisse und Menschen zutage förderte. Denn damit war jedermann einmal die Gelegenheit geboten, tiefer zu begreifen, wie normalerweise die Dinge liegen. Bei der gewöhnlichen Art, Unstimmigkeiten zu beheben, ist der Mensch nämlich zu sehr auf das ausgerichtet, was vom andern zurückkommt, und er hat daher keine Zeit, seine eigenen Worte tiefer oder eingehender abzuwägen. Bei ihr aber, die nicht ebenfalls mit Dreck zurückwarf, sondern ihn sich gefallen liess, blieb nachher deutlich die Menge des geworfenen Dreckes ersichtlich. Das konnte die einen ernüchtern und zur mässigenden Selbstkorrektur bringen. Andere wieder konnte es auch reizen, ihren angestauten Aggressionen von andern Begebenheiten her freien Lauf zu lassen und mit Freude und Genuss immer wieder darauf zurückzukommen und sie damit auszugrenzen oder eben – – einzusperren in die Nacht der Isolation. Einmal stand sie kurz nach Feierabend alleine und gedankenversunken am Fenster ihres Arbeitsraumes, die abendlichen Sonnenstrahlen geniessend, die sie so dankbar stimmten, weil ihr goldenes Licht sie so stark an ihr eigenes, verständnisvolles Erkenntnislicht erinnerte, das ihr seit ihrer Umkehr von aussen nach innen geworden war, so dass sie feuchte Augen hatte. Als sie dann einen Arbeitskollegen den Korridor entlang schreiten hörte und vermutete, dass dieser in ihr Zimmer kommen könnte, wollte sie einen Moment eine Ausrede für ihre leicht feuchten Augen finden, und sie fand sie auch in der Feststellung, dass die Sonne selbst noch bei ihrem jetzigen tiefen Stand die Augen noch so stark mitzunehmen fähig sei, dass sie beinahe zu tränen beginnen. Aber im selben Moment verwarf sie diese, weil sie erkannte, dass sie damit ihren Nächsten nur täusche und ihm damit die Gelegenheit nähme, einen sanften Hinweis auf das Leben im Innern eines Menschen erhalten zu können. Also blieb sie stehen und versuchte, sich zu sammeln und festzubleiben in ihrem Liebeentschluss, stets wahrhaftig zu sein und damit nur dem Guten und Schönen, auch im andern, zu dienen, das sie in ihm damit möglicherweise anspricht. Als dann der Arbeitskollege tatsächlich durch die halboffene Türe eintrat, wandte sie sich wortlos um und sah ihn an, gleichsam fragend, was er wünsche. Einen kleinen Moment stockte dieser und fragte dann über eine Anordnung für den morgigen Tag etwas nach. Sie gab ihm bereitwillig die gewünschte Auskunft, und er ging wieder hinaus. Sie spürte es, dass er etwas betroffen war, als er ging, und wünschte ihm von Herzen, er möge sich dadurch in seinem Innern etwas bewegen lassen, damit die Empfindung in ihm etwas wacher würde und das dabei erwachende Leben ihn aus der gesellschaftlichen Äusserlichkeit wieder etwas zurückkehren liesse zu sich selbst. Auf diese Art wurde sie immer mehr all ihrer so genannten Verpflichtungen der gesellschaftlichen Gepflogenheiten gegenüber los, und es änderte sich damit auch ihr Verhältnis in der Firma. Viele nahmen sie nicht mehr so wichtig, weil sie spürten, dass sie ihnen keine wirkliche Konkurrenz mehr sein konnte. Andere wieder suchten eine nähere Verbindung zu ihr. Es waren allerdings eher die Untergebenen oder doch die weniger Begabten, denn diesen war sie eher eine Hilfe; und das tat ihr wohl, das gab ihrem Leben Sinn. Sie hatte sich zwar seinerzeit – wie in der Gesellschaft üblich – "hinaufgearbeitet", wie man das so beschönigend nennt. Sie hatte mit Ehrgeiz und mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln, welche für diese Zwecke kaum die saubersten, immer aber noch gesetzliche waren, ihre Position verbessert, ohne weiteren Grund als jenen der Selbstsucht – wie sie nun, seit ihrer so schicksalhaften Erinnerung erkannte. Seither kam sie dafür in die Lage, aus ihrer gehobenen Stellung heraus den Schwächeren etwas zukommen zu lassen. Und das tat sie gerne, selbst auf die Gefahr hin, dass sie dabei einmal ihre Stellung verlöre, so sehr sie bei all ihrem Tun auch immer gewissenhaft den Vorteil der Firma nicht ausser Acht liess. Aber es tat ihr der Gedanke an die Möglichkeit des Verlustes ihrer Stellung nicht wehe. Sie war es ja vor ihren Augen nicht wert, diese Stellung zu bekleiden, denn sie hatte sie mit ihrer Schlechtigkeit erobert. Sie wollte sie nun nur, solange sie sie haben konnte, zum Wohle der andern benutzen. In diesem Zusammenhang dachte sie manchmal an das Leben einer Hure. Denn sie empfand diesen Stand dem ihren – so wie sie ihn sich "verdient" hatte – als nicht so unähnlich, indem er ebenfalls mit unrechtmässig an sich Gebundenem erst die Bereicherung bringt, und ersah anderseits doch auch, wie die Möglichkeit des "Abverdienens" darin bestehen konnte, dass eine solche, wenn sie einmal das Schlechte ihrer Art und die Vergänglichkeit ihres selbstsüchtigen "Dienstes" – durch Krankheit, Alter und Kummer bedingt – einsehen könnte, mit ihrem an sich durchaus nicht gutzuheissenden Dienste dennoch auch dem einen oder andern zu einer Hilfe werden könnte, wenn sie ihm ihr Gemüt mehr und eher öffnen würde als ihre Kleider – eben weil sie notfalls auch das letztere geschehen liesse, wäre der Drang bei einem besserungswilligen Schwachen noch allzu gross. Es wäre dann für die dabei Beteiligten eine Erfahrung der Anteilnahme, und nicht eine richtende Predigt von oben herab, wenn sie erkenneten, dass oft mehr das "Zuhause" als das Sexuelle der Grund ihres Suchens und ihrer Wünsche ist. Und für sie selbst wäre dabei ein sich hochmütiges Erheben, als Folge einer gelungenen Hilfe an einen Schwachen, in ihrer Stellung und mit ihrem Ruf weniger möglich, sodass sie selber dadurch nicht so leicht in eine neue Gefahr käme. Wenn sie dann aber wieder an ihre Arbeitskollegen dachte, die in ihrer unverbesserlichen Art alle Gelegenheiten ohne Bedenken zu ihren Gunsten auszunützen bestrebt waren, dann erkannte sie wieder die geringe Chance des Erfolges bei den andern, die einem noch so aufrichtigen Besserungswillen beschieden sein konnte, selbst bei noch so grosser Aufopferung der eigenen Interessen. Und sie schämte sich dann wieder, zuvor solchen Gedanken in ihr Raum gegeben zu haben. Anderseits aber musste sie ja auch erkennen, dass ausgerechnet bei ihr selbst eine wesentliche Besserung ihres bisherigen Zustandes – wenn auch erst zwanzig Jahre später – erst über eine sexuelle oder zumindest erotische Erfahrung möglich wurde, die eben durch einen wirklich Aufrichtigen zustande kam. Wie stark musste also dieser Erfahrung zufolge das Gefühl gerade dabei angesprochen werden. Und warum dann erst zwanzig Jahre später? War wohl der Missbrauch des Sexuellen, das in allen ihren Handlungen immer mehr der weltlichen Stellung oder dann der bloss sinnlichen Zerstreuung dienen musste, der Grund dafür, dass sie bisher dabei in ihrem Innern nichts empfand; dass ihr Herz oder Gemüt nicht berührt wurde, so wie nun, seit jener Erinnerung? Wie viel sagt doch ein jeder Vorgang, eine jede Handlung aus; und wie wenig wird ihren Wirkungen Raum gegeben, wenn bloss der Intellekt sie sich dienstbar machen will?! Solche Gedanken verwirrten sie sehr. Denn einerseits erschien ihr das nüchterne Verstandesleben von ihren Depressionen her schon als ein seelischer Tod, aber anderseits geriet sie durch ihre nunmaligen Gefühle auf Gedanken, deren Richtigkeit sie vor dem Forum ihres Verstandes nicht verbürgen konnte, so sehr sie von solchen Gefühlen in ihrem innern Denken auch belebt wurde. Es wurde ihr auch einmal bewusst, dass Maria Magdalena, eine Hure, Jesu vor den anwesenden Jüngern durch eine Handlungsweise ausgezeichnet hatte, auf eine Art, wie dazu die Herzen der Jünger in ihrem damaligen Zustand noch nicht bereit und fähig gewesen waren. (Sie netzte Jesu Füsse mit ihren Tränen, küsste sie und trocknete sie mit ihren Haaren. (Luk.7, 38.)) Aber sie ersah anderseits auch, wie gering diese bloss äussere Handlung gegenüber dem schweren nachherigen Amt derselben Jünger sich ausnahm. Manchmal steigerten sich allerdings ihre innersten Gefühle oder Emotionen in einem solch starken Masse, dass sie bald nicht mehr nur Gedanken wach werden liessen, sondern geradezu gebieterisch nach Ausführung verlangten, so dass sie bis zur Schwelle der Masturbation getrieben wurde, so wie sie sie früher einmal aus reiner Neugierde versucht hatte. Das wieder schien ihr bedenklich, denn sie wollte sich in allem an die Gebote jenes Gottes zu halten beginnen, den sie in sich stets mehr und lebendiger, ja geradezu als immer notwendiger und dadurch gesicherter zu fühlen begann. Wie ein Kind kam sie sich dabei vor, ein verirrtes Kind, das zwar wohl einen Vater hatte, aber in seiner gegenwärtigen Stellung dennoch das Los der Waisen teilen musste auf so lange hin, als es den Vater nicht bei sich wusste oder spürte. Was alles waren doch solche Gefühle zu bewirken imstande! Nie zuvor in ihrem Leben hatte sie derart Gefühle und Probleme; und nun stand sie am Rande der Vernunft, die ihr nicht mehr helfen zu können schien in ihrer Not der sie oft bedrängenden Gefühle. Und doch hatten anderseits eben erst diese Gefühle sie so sehr belebt und dadurch gerettet aus dem Tode der Verstandeswüste. Und doch würde hier gerade wieder der Verstand eher helfen, zu beschwichtigen und Falsches zu meiden, als die noch so schönen Gefühle, die eher noch dazu drängen. Hat sie möglicherweise denn doch den falschen Weg beschritten? Hätte sie nicht lieber mit dem Verbleib beim blossen Verstande ein nüchternes Leben führen sollen, anstatt so abenteuerlichen Gefühlen nachzuhängen? Manches Mal wünschte sie sich in solchen Momenten, sie wäre mit einem selbstsüchtig und eher etwas bösen und geilen Manne verheiratet gewesen, dann könnte sie, ihm dienend, besser nüchtern bleiben und das nun oft so sehnlich Begehrte als gebotenen Dienst auffassen, wenn es verlangt würde, sofern sich die Lust dazu nicht bei einem strengen Tagespensum von Erduldungen von allerlei Schikanen dann von selber verlöre. Der Verstand ist zwar wohl tot, aber er konnte gerecht sein, dachte sie; die Gefühle sind lebendig, aber sie zerren und bringen so leicht zu Fall, was ehedem noch aufrecht gestanden hat. Aber ist denn das Aufrechtstehen wichtiger als das Leben selbst? Liegt nicht das Kindlein zuerst in der Wiege und muss sein Leben zuerst kräftigen, bevor es nach und nach zu einem standhaften Mann werden kann? Ist es in seiner ursprünglichen Lebendigkeit nicht aufnahmebereiter und aufnahmefähiger für alles Gute als der standhaft begründete Verstand des späteren Mannes? Als sie über diese Schwelle, diesen Stolperstein, fiel, tat es ihr mächtig leid, weil sie spürte, dass sie dem wohlwollenden Willen ihres Gottes und Vaters nicht entsprechen konnte. Sie war zuinnerst verletzt. Denn dieser Fall war seit der Belebung ihres Gemütes – und der Erweckung ihres Geistes darin – ein anderes Erleben als in früheren Jahren, da sie noch nichts fühlte – und somit auch keine Schuld. Sogar ein Anflug von Verzweiflung war ihr Lohn dafür. Sie musste ihren Schöpfer nun enttäuscht haben, Sie wusste noch nicht, dass Gott solche Fehltritte oft zulässt, um den in seiner Gnade freudig Auflebenden, der durch die Zunahme an Kraft und Licht nur zu bald durch ein Anschwellen seines Selbstgefühles sich von Gott wieder lösen könnte, durch die demütigende und reinigende Erkenntnis eben solcher Schwäche ihn mahnend wieder zu sich ziehen zu können, damit er ständig mit ihm vereinigt bleibt. Als sie anderntags wieder unter den Vernünftigen weilte, bei ihrer Arbeit, da erst kam ihr ein eigenes, bisher nicht gekanntes Gefühl, das sie etwas beruhigte. Sie fühlte sich nicht mehr so schuldig. Sie empfand, dass sie wohl einen Fehler begangen hatte, aber dieser wog nur in ihrem liebenden Herzen. Im Verstande ihrer Kollegen wog er nicht nur nicht, sondern sie konnten ihn in ihrem Verstande schon gar nicht begehen, weil ihn nicht als solchen anerkennen. Nun, sie war an ihrem Schöpfer schuldig geworden und hatte deshalb von nun an nur zu ihm ein bestimmtes Verhältnis, ein Verhältnis der Schuld allerdings, aber dadurch auch ein Allerbestimmtestes. Eines, das zwar wohl auf der einen Seite stets beunruhigte; auf der andern Seite, von Gott her, aber auch immer wieder bereicherte durch die Erfahrung seiner Geduld, Erbarmung und Gnade. Ein eigentliches Verhältnis über ihren Verstand zu den andern, den bisherigen Arbeitskollegen, hatte sie hingegen seit diesem Vorkommnis nicht mehr; höchstens noch zu Menschen, die in irgendetwas Not litten und deshalb hilfebedürftig waren. Ihre Schuld aber, das begann sie zu verspüren, ist die Schuld der noch kleinen und unmündigen Kinder, wenn sie – ihrer sich erst entwickelnden Kraft noch nicht so richtig mächtig – immer wieder fallen. Und ein Vater, der ihnen zuruft: "Kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid", und zu den ihn Umstehenden sagt: "So ihr nicht werdet wie die Kinder, ...", der der Maria Magdalena Handlung an sich geschehen liess und sie vor dem Urteil der andern verteidigte, und der der Ehebrecherin Schuld in den Sand geschrieben hatte; ein solcher Vater, wie er allen in Jesus sichtbar und erlebbar geworden ist, nimmt seiner Kinder Kreuz gerne auf seine Schultern, wenn sie nur treu im Willen bleiben, ihm nachzufolgen. Bei solchen Gedanken verspürte sie jeweils auch, wie sehr sie die Liebe im Allgemeinen, aber im Besonderen auch die auf Gott gerichtete, zu reifen vermochte, zu beleben auch, und immer wieder zu beruhigen. Ihr fernerer Weg der Entwicklung war voller steiler Aufstiege, vorbei an jähen Abgründen und über glitschiges Geröll, aber es war denn doch im Ganzen eine recht schöne Bergwanderung durch die Landschaft ihres Gemütes, die überall das aus dem Stein und Fels der früheren Ichbezogenheit entbundene Leben als ein Grün der Hoffnung offenbarte – ähnlich den Pflanzen in der Welt der Materie. Wohl liess sie auch Gewitterstürme zu, aber füllte damit dann auch den belebenden Bach der stets demutsvolleren Liebe, und erzeugte den erfrischenden Wind der Gnade, den sie besonders an den steilsten Stellen ihrer äussern Aufgaben so recht herzenstief erleben konnte und durfte. Wie ganz anders war doch diese Wanderung durch ihr Gemüt, entlang der äussern Begebenheiten, wenn sie den Wanderer zeitweise auch noch so beanspruchen konnte, als jene über die Sanddünen der öden und leeren, bloss gedanklich erfassten Wüste der Welt aller Äusserlichkeit, in welcher keine Liebe verborgen liegt. Wie wenig brauchte sie dabei, und wie nahe war stets die rechte Hilfe von oben. Bei allem, was sie bewegte, zuweilen auch bedrängte, empfand sie doch, dass sie lebt, einem andern lebt und aus ihm sich alle Hoffnung schöpfte, während sie früher zwar wohl mehr Ruhe hatte, aber eine Ruhe ohne Aussicht, ohne Hoffnung und ohne wahrhafte Veränderung. Was macht nun dagegen auch eine manchmalige kleine Not aus? Nichts, als dass sie eine noch grössere innere Sammlung zur Folge hat! Und was kostet ihr all ihre Mühe mit ihren anwachsenden, starken Gefühlen? Nichts, als ihren frühern, innern Tod der zwar ohne Mühe, aber auch ohne Ziel war. Dem Äussern nach oft einsam scheinend, war sie dem innern Gefühle nach doch so vertraut an der Hand eines allmächtigen, gütigen Vaters, den sie aber für ihr Gefühl vorderhand noch gleichfort nicht so stark verspüren konnte, wie ein Kind die Hand seines bloss leiblichen Vaters, die es zuweilen doch an sich zu drücken vermocht hätte in einer Wallung seiner allzu grossen Liebe. Sie wurde dadurch frei von allen äussern Bindungen an die Welt und wurde mit der Zeit aber gerade von Weltmüden so gerne besucht. Und das alles erreichte sie mit nur ganz Wenigem aus der Bibel, das aber in einem liebeemsigen und liebehungrigen Herzen gar schnell in die Tat umgesetzt, und erst dadurch so recht lebenstief verstanden wurde. – Schade für all die vielen andern, die das ihrer Verblendetheit wegen nicht miterleben konnten, sodass sie daran keinen Anteil hatten! Es soll damit nicht dargelegt sein, dass die Sexualität aus der Sackgasse oder dem Tal der Depression führen könnte. Oh nein, ganz im Gegenteil, diese führte ja das damals noch junge Mädchen erst recht in diese Wüste der Äusserlichkeit, indem es diese intimste und mit den heftigsten Gefühlen verbundene Handlung schon in seiner Jugend in den Dienst seiner Selbstsucht stellte und sich deshalb am ehesten aller weitern Empfindung bar machte, sodass an ihre Stelle kalte Berechnung trat. Der Weg dieser Frau zeigt nur deutlich, dass alleine die Gefühle ein Angehör des Lebens sind und nur sie die Liebe zu wecken vermögen, welche die Kraft des Lebens schlechthin ist. Es zeigt sich aber auch, dass beim Aufleben der Gefühle die Kraft der Liebe noch lange nicht geordnet oder gar geübt ist, und deshalb auch ganz gut Schiffbruch erleiden kann – wie das Kind beim Gehen-Lernen gar oftmals einen Fall erleiden muss. Soll es deshalb nicht gehen lernen? Oder soll man deshalb auf die Stärkung der Liebe, und damit des Lebens, verzichten? Wer wird den Menschen dann aus seinem eigenen, in der Depression so schmerzlich gefühlten Tode erretten? Da aber der teilweise innere Tod, oder das Gebundensein der Liebe, eben erst durch sein Erfühltwerden zur Depression – zu deutsch: zum Drucknachlass – führt, so kann ja umgekehrt die Depression nicht anders überwunden werden, als dass wieder inneres Leben dadurch ermöglicht wird, dass in seinem Innersten durch ein Freiwerden der Liebe sein Druck wieder steigt. Was aber ist dem menschlichen Gemüt mehr Druck oder Ansporn als eine berechtigte Hoffnung und Erwartung? Wie aber will einer im bodenlosen Triebsand der Wüste bloss selbstsüchtiger Handlungen berechtigte Hoffnungen zum Fortschreiten hegen können? Muss er nicht zuerst auf irgendeinen festen Grund gelangen? Dieser feste Grund ist die volle (so weit möglich) Erkenntnis seiner ganzen Schlechtigkeit, die ihn erst in diese Situation gebracht hat. Eine volle Erkenntnis aber kann nur eine gefühlte sein, weil nur diese mit dem ganzen Leben durch das Lebensgefühl erfasst werden kann. Eine bloss gedachte Erkenntnis ist nur eine Hypothese – fern allen Lebens – vergleichbar dem Resultat einer Rechnung. Auf diesem festen Grund der erkannten eigenen Schlechtigkeit lässt sich dann erst hinweg schreiten zu einem besseren Grunde und einer besseren Ordnung, die ausserhalb der eigenen sein muss. Die beschriebene Frau hätte ja in ihrer früheren Jugend Gelegenheit gehabt, fühlend zu erkennen, wie schlecht sie war, angesichts der reineren Liebe des Ungeschickten. Nur hat sie diese Gelegenheit darum nicht genutzt, und folglich verschlafen, weil sie damals nicht in ihrem Leben – der fühlenden Liebe – tätig war, sondern in ihrem Verstande sich die günstigsten Weltpositionen und -Verbindungen gesucht hatte. Und in dieser Rechnung kamen die Grössen: Aufrichtigkeit, Wahrheit und Liebe nicht vor, die sie mit dem Gefühl ihres Herzens leicht erkannt hätte. Es ist Gnade von oben, dass dann solche Vorkommnisse im Menschen, als Erinnerung, dennoch aufbewahrt bleiben. Und wieder ist es Gnade, wenn sie zu einer Zeit des tieferen In-sich-Gehens – wenn auch wie durch äussere Zufälle erscheinend – wieder in der Erinnerung geweckt und belebt werden – wie es durch das Ansehen einer Abbildung der weiblichen Brust bei ihr geschehen ist. Dadurch kommt es dann zu einer gefühlten und dadurch lebenstiefen Erkenntnis des eigenen Grundes und Bodens, auf welchem man steht, beziehungsweise der Begründung, nach welcher man bisher gelebt hat. Nur – – woher soll ein solch Verkommener noch erwartende, berechtigte Hoffnung schöpfen? Diese ist nur möglich durch die Anerkennung des Guten und der Wahrheit ausserhalb seines Wesens. Der Christ müsste sie eigentlich kennen, wäre sein Glaube nicht blosse tote Gewohnheit ohne alle Lebensfolgen. Aber auch der Atheist könnte, wie diese Frau, wenigstens durch die Vollkommenheit äusserer Formen und deren belebend erbauendem Reiz auf ein fühlendes Gemüt, zur Schlussfolgerung kommen, dass ausserhalb seines Wesens bessere Gedanken tätig und wirksam sein müssen – denn Zufälle erschaffen solche Formen (wie die menschliche Gestalt) nicht. Dann erst kommt das mühsame Suchen nach der Herkunft und der Wesenheit solcher Gedanken voller Kraft, welche die Frau noch leicht – durch die Bibelzitate des Mitarbeiters zur rechten Zeit – hatte finden können. Erst damit erkeimt dann erstmals wieder eine berechtigte und begründete Hoffnung und der beseligende Druck hoffnungsvoller Erwartung beginnt das Gemüt sachte zu erheben, über das Tal der Depression hinweg. Freilich gibt es für den Unerfahrenen in einer Wüste auch andere Hoffnungsgründe, wie die Fata Morgana der erfolgreichen Behandlung einer Depression durch die Wissenschaft, das heisst: durch menschliche Kunst. Erst nach so mancher herben Enttäuschung mit erneuten Depressionen – weil Erwartungsdruck-Zusammenfällen – wird der Unerfahrene vorsichtiger, dadurch zwar noch viel weniger hoffnungsbereit, also kränker. Aber er hat dabei insofern auch eine grössere Chance der Gesundung, dass er immer mehr auf die völlige Nichtigkeit seiner Gründe stossen wird. Denn wie könnte einer, der nicht aus sich selbst geworden ist, in sich selber oder in seinesgleichen einen Grund der Hoffnung finden? Ist es nicht leichter, ihn dort zu suchen, wo er einzig liegen kann: in seinem wahren Grunde, der ihn erst hat werden lassen? Und wäre dieser auch noch so verborgen, so kann doch offenbar nur in ihm eine Chance liegen. Wer das einmal erkannt hat – nicht zuletzt durch die Erfahrungen der Depression und ihrer Unzugänglichkeit für andere – der wird auch danach zu suchen beginnen und ihn auch finden, weil dieser Grund auch fernerhin alles zur Erhaltung des von ihm Erschaffenen vorkehrt, aber eben nur unter der Voraussetzung wirksam werden kann, dass der von ihm geschaffene – wenn vor-erst auch noch so nichtige – neue Grund ihn an- und aufzunehmen bereit ist. Nur der Eingeweihte ersieht (und weiss es nicht nur bloss), dass selbst in den scheinbaren Erfolgen der psychiatrisch-wissenschaftlichen Medizin nur die Gnade der Erstreckung waltet und die so herbeigeführten Erfolge nur dann bleibend werden, wenn diese Erstreckungsfrist genutzt wird, bleibenden Druck geordneten und deshalb hoffnungsberechtigten Lebens zu erzeugen; andernfalls aber Scheinerfolge bleiben, was die laufende Verschlechterung des Zustandes der Menschen und ihre immer stärker aufeinander folgende Behandlungsbedürftigkeit verdeutlicht. Folglich ist eine Depression die grösste Chance des Lebens. Die Chance, vom trügerischen Erwartungsdruck frei geworden zu sein, und die Chance, auf dem zwar miserablen Grund der Wirklichkeit seines eigenen, endlich einmal lebenstief gefühlten Wesens fortschreiten zu können, wenn man nur einmal das Ziel ausserhalb der eigenen Wüste erkennt. Schade, dass diese Chance von so vielen nicht erkannt wird und schade, dass so viele damit reich werden, sie medizinisch zu vertuschen. (Ausserhalb des eigenen Grundes und Wesens ist aber nicht örtlich zu verstehen, denn Gott und sein Reich ist inwendig im Menschen; ausserhalb bedeutet nur: ausserhalb des gefühlten Zustandes, der vorderhand pur auf dem eigenen Schlechten gründet, wiewohl das Gute (jedoch noch schlafend und deshalb gesondert oder unvermengt) inwendig bereits vorhanden ist – wie ein Samenkorn im Dreck der Erde.) 3. 2. 1994 Aus der Reihe: "Wenn wir christlich leben würden" |